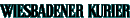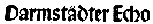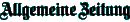|
Cerha-Oper "Der Rattenfänger" VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Als sich in den Nachweltkriegsjahren in Städten wie Darmstadt, Köln, Paris und Mailand Zentren neuer Musik bildeten, war Friedrich Cerha in Wien lange der einzige ernsthafte Statthalter der kompositorischen Fortschrittsideen, die gut 50 Jahre früher von dort ausgingen. Es hatte seine Logik, dass gerade Cerha zum Fertigsteller der Berg-Oper Lulu wurde, eines der (unvollständig hinterlassenen) Hauptwerke der Zweiten Wiener Schule. Höchst ungerecht wäre ein Urteil, das Cerha lediglich dafür einen wuchtigen Platz in der Kompositionsgeschichte zuwiese. Mit seinem eigenen Komponieren (etwa dem kompendiös-konstruktivistischen Orchesterzyklus Spiegel) gehört er ebenfalls zu den Gewichtigen.. Von seinen drei Opern wählte das Staatstheater Darmstadt jetzt die mittlere, den 17 Jahre alten Rattenfänger, der seit der Grazer Uraufführung noch nicht nachgespielt worden war. Die Realisierung entstand in Zusammenarbeit mit den Wiener Festwochen. Für Cerhas Knorrigkeit spricht, dass er mitten in den achtziger Jahren nicht zu dramenliterarischen Erlauchtheiten wie Hölderlin, Beckett oder Heiner Müller griff, sondern zu dem altmodischen Carl-Zuckmayer-Stück, das 1975 ohne allzuviel Aufsehen in Zürich uraufgeführt worden war. Der versierte alte Stückeschreiber erzählt die Hamelner Chronik des Spielmanns und Verführers episoden- und personenreich nach und arbeitet am Stoff zugleich seine Einsichten über das von ihm erlebte "Jahrhundert der Extreme" (Hobsbawm) ab. Dabei identifiziert er sich zum guten Teil mit dem Außenseiter, als den er die (namenlose) Titelgestalt sieht. Dieser Fremde beendet mit seiner Kunst (!) die Rattenplage, wird dafür aber vom verrotteten Etablishment nicht belohnt, vielmehr nur durch Einspruch der Kinder vor dem Tod am Galgen gerettet. Fast widerwillig nimmt der von Machtlust ganz freie Rattenfänger die ihm von den Kindern angetragene "Macht" an, sie aus der Stadt in eine bessere Zukunft zu führen. Kein Lemmingzug in die kalte Weser; der Verführer, als "guter" Führer umgedeutet. Ziemlich naiv nahm sich Zuckmayers durch 1968, die Rockmusik oder wodurch auch immer geweckte Hoffnung auf die Unkorrumpierbarkeit der jungen Generation wohl schon vor 29 Jahren aus. Das Stück nähert sich auch sonst mit einigen Motiven (tödlich mondäner Tanz der Stadtregentengattin, weiterer (Opfer-)Tod einer gläubigen Geliebten) der politischen Kolportage eines Georg Kaiser. Die unterschwellig expressionistische Motorik wird sprachlich indes in moderatere Bahnen gelenkt. Meisterlich unproblematisch Angesichts breit ausladender Dramaturgie und ungeheurer Textmengen könnte man angst und bange werden, wie aus dem Ganzen auch noch eine Oper zu zimmern wäre. Doch Cerha macht alle Bedenken schnell vergessen. Dabei illustriert er nicht simpel filmmusikalisch. Geschickt und phantasievoll findet er zu nahezu geschlossenen Formen, wendet kunstreich Kanon- und cantus-firmus-Techniken an. Mit sicherem Zugriff gestaltet und steigert er größere Szenenkomplexe, schafft vielfältige orchestrale Überleitungen, Kommentare, Vorbereitungen (auch er, wie Berg, ein "Meister des kleinsten Übergangs"). Dem aufs Altdeutsch-Holzgeschnitzte sich berufenden Sujet entspricht ein Bänkelsängerton, der insbesondere die Hauptfigur entpathetisiert (sie stellt sich gleich zu Beginn verblüffend schlicht-volksliedmäßig a cappella vor). Der Vokalstil, bald sprechmusikalisch gehalten, bald expressiv glühend, beachtet durchweg die (durch Übertitelung bei dieser Aufführung ohnedies gewährleistete) Textverständlichkeit. Klug unterläuft Cerha auch das drohende Rosarot des finalen Kinderaufbruchs, indem er ihn mit einem undurchdringlichen Gewebe aus erstickt oder tastend anmutenden Streicherclustern verbindet. Alles in allem eine anhörenswerte Sache, nicht unbedingt rabiat eigensprachlich pointiert, aber auf beeindruckende Art meisterlich in der unproblematischen Adaptation (überwiegend, aber nicht dogmatisch) atonaler Klanglichkeit für einen großen musikdramatischen Zusammenhang. Sehr respektabel auch Intensität und Qualität der Darmstädter Darstellung. Ein enormer Wurf das Bühnenbild von Hartmut Schörglhofer: Enge Gassen mit steilen schiffsbauähnlichen, von Geländern und Eisenleitern besetzten Architekturteilen, aber auch einem großen, kühl ausgestalteten Prunkraum. Friedrich Meyer-Oertels Regie und die Kostüme von Ulkrike Rulle unterstreichen die "zeitlose Gegenwart" der szenischen Parabel. So gerät die Handlung, in dichter Personenspannung, "als wär's ein Stück von uns". Überzeugende Besetzung auch kleinerer Partien. Überaus ansprechend der Rattenfänger des Tenors John Pierce; enflammierend die sopraneske Vehemenz der Rikke von Morenike Fedayomi, auch die gleisnerische Diktion der femme fatale Divana von Jennifer Barrette Arnold. Stefan Blunier dirigierte mit souveräner Um- und Übersicht. |
|
Der Rattenfänger verheißt eine glänzende Zukunft Von Andreas Bomba Die Geschichte lässt sich auf zweierlei Weise erzählen. Zur Strafe dafür, dass man ihm den Lohn für seine schmutzige Arbeit nicht zahlt, entführt der Rattenfänger die Kinder der knickerigen Bürger. Oder: Weil die Kinder keine Zukunft in ihrer Stadt sehen, folgen sie dem Rattenfänger wie einem Guru oder Messias. Diese Version entwarf Carl Zuckmayer in seinem letzten,1975 entstandenen Stück. Ihr folgt die Oper, ein Auftragswerk aus dem Jahr 1986. Cerha hat den Text selbst eingerichtet, eine kraftvolle, bisweilen altertümelnde und Pathos berührende Sprache nicht ohne ironische Beimischungen. Diese Qualitäten korrespondieren mit der Musik. Cerha konstruiert eine klangflächenartige, von feinsten Strukturen durchwebte Klangwelt, die bisweilen fast illustrativ den Text unterstützt, an anderen Stellen Personen und Hörern Regionen zum Ausleben von Gedanken und Fantasien eröffnet und eine bemerkenswerte dramaturgische Spannung erzeugt. Stefan Blunier gibt sie mit dem Staatsorchester fesselnd wieder. Besonders an zwei Stellen: Zum Schluss des ersten Akts lähmt ein bedrohlich wachsendes Crescendo in Berg'scher Manier die Aktion auf der Bühne zu angstvollem Erstarren; gegen Ende klingt die Musik aus dem Bühnenhintergrund, ätherisch schwebend, und erhebt mit einer gregorianisch-sakralen Aura die Vision des Rattenfängers ins Messianische. Diese Figur hat Ulrike Rulle in einen "Easy-Rider"-Mantel gesteckt, während die jüngere Generation, ein paar Drogensüchtige und Schulmädchen in Alltagsklamotten, ihm schweigend in den Nebel folgt. Die Zurückbleibenden versprechen sich, anzupacken und eine bessere Welt aufzubauen – nimmt man diese Parabel politisch für den Zustand von Staat und Gesellschaft, wäre heute, anders als in den siebziger und achtziger Jahren, auch ein anderer Schluss denkbar. Darauf aber will Friedrich Meyer-Oertel seine Inszenierung nicht festlegen. Zwar ist seine, von Hartmut Schörghofer auf eine schiefe Bühne gebaute Stadtlandschaft von heute: ein trostloses Ambiente zwischen Kläranlage, Müllabfuhr-Betriebshof und elenden Wohninterieurs, die durch die Drehbühne immer neue Konstellationen für diese nebenhandlungsreiche Oper eröffnen. Die vielen Menschen aber (24 Rollen sind zu besetzen!) sind, obwohl sie vom Pfarrer bis zum Kanalarbeiter in zeitgemäßer und oft fantasievoll zusammengeschusterter Kluft auftreten, exemplarische, zeitübergreifende Typen. Korruption, Sumpf, Kleinstadtmief sind schließlich immer und überall. Gefühle und Leidenschaften erscheinen merkwürdig überdreht; die Frauenfiguren sind in sich selbst gefangen (Jennifer Barrette Arnold als sich zu Tode tanzende Stadtregenten-Gattin) oder in ihrer kindlichen Unschuld stark typisiert (Morenike Fadayomi als Henkerstochter Rikke). Aus dem insgesamt hervorragenden, spielfreudigen, aus vielen Charakteren bestehenden Ensemble seien John Pierce in der Titelpartie, Thomas Meyer als Stadtregent, Hubert Bischof und Michael Witte in mehreren kleineren Rollen sowie Andreas Wagner und Hans Christoph Begemann genannt. Ein denkwürdiger Abend. Starker Beifall. |
|
Als Kinder noch protestierten Deutsche Erstaufführung von Friedrich Cerhas Oper "Der Rattenfänger" in Darmstadt
Tödlicher Tanz: Der Rattenfänger (John Pierce) und Jennifer Barrette-Arnold als Divana. Illius Von Volker Milch Wenn Luder zu viel tanzen, das lehrt die Operngeschichte, kann das nicht gut gehen. Im Fall der Salome fällt, wie bekannt, das Haupt des Jochanaan. Eine gewisse Divana nun, die in Friedrich Cerhas Zuckmayer-Oper "Der Rattenfänger" ihr laszives Unwesen treibt und ihrem aparten Namen alle Ehre macht, tanzt sich selbst in den Herztod, während die Partitur nach allen Regeln der Kunst die musikalische Ekstase beschwört. Spätestens in dieser Szene der deutschen Erstaufführung von Cerhas 1987 in Graz uraufgeführter Oper wünscht man sich eine Regie, die das Pathos in Wort und Ton nicht ganz so naiv bebildert, sondern in einer stilisierenden Verfremdung aufbricht. Wohl nur so, denkt man in der Darmstädter Premiere von Friedrich Meyer-Oertels Inszenierung, ließen sich dem grundsympathischen Anachronismus dieses Opern-Unterfangens aktuelle Reizwerte abgewinnen. Carl Zuckmayers letztes Stück, 1975 mit Helmut Lohner (und Gottfried von Einems Schauspielmusik) in Zürich uraufgeführt, führt schnurstracks ins Märchen-Mittelalter der bekannten Sage und ist mit seinen vollmundigen Reflexionen über Macht und Moral, mit seinen nach "Cannabis" lallenden Blümchenkindern, Generationskonflikten, einem veritablen Guru und sinistren Führerfiguren doch ein Kind seiner Zeit. Das dürfte denn auch einer der Gründe für die ziemlich verspätete Rezeption der Oper in Deutschland sein. Auch wenn Cerha den Text für sein Libretto bearbeitet hat, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Ort der theatralischen Erfüllung des Zuckmayer-Stückes heute nicht das Staatstheater, sondern eine Freilichtbühne vor dekorativer Ruinenkulisse wäre. Das Idiom des 1926 geborenen Wiener Komponisten, der nicht zuletzt für seine Vervollständigung des Schlussaktes von Alban Bergs "Lulu" bekannt ist, erinnert stark an die historischen Avantgarde-Traditionen seiner Heimatstadt: Sein Espressivo, vom Mitleid für die "armen Leut´" durchglüht und mit solchen "Wozzeck"-Assoziationen in der Büchner-Stadt Darmstadt bestimmt nicht deplatziert, sucht oft die große, geradezu ariose vokale Linie, während der Orchestersatz äußerst kunst- und reizvoll zwischen verschiedenen historischen Klang-Schichten changiert. Das Mittelalter und seine sakrale Aura ist musikalisch ganz konkret präsent, der Rattenfänger bezirzt sein Publikum mit dem Sopransaxofon, und selbst ein Hauch von Liedermacherluft weht mit Gitarrenklängen hinein. Das geräuschhafte Kontrastprogramm zu diversen Klang-Idyllen ist das unheimliche, die Handlung immer wieder grundierende Rascheln der Ratten. Ein Manko des Werks ist das doch arg längliche Entlanghangeln am (sehr klar gesungenen und gesprochenen) Text, dem gegenüber die Musik manchmal nur wie beflissenes akustisches Illustrationsmaterial wirkt: Als sei diese Oper eine hypertrophe Schauspielmusik, die in einigen großorchestralen Kulminationspunkten aus dem Ruder läuft. Indes hatte das Staatstheater Darmstadt in seiner Koproduktion mit den Wiener Festwochen das engagierte Werk szenisch wie musikalisch fest im Griff. Das Premieren-Publikum zollte den Solisten, dem Orchester unter Stefan Bluniers Leitung, dem Regisseur Meyer-Oertel und nicht zuletzt dem Komponisten selbst sehr herzlichen Applaus. Herausragend unter den nicht weniger als 26 Partien der Oper: John Pierce, der als charismatischer Rattenfänger in der korrupten Stadt-Gesellschaft auftaucht und zum Erlöser der Kinder werden wird, und Morenike Fadayomi, die als mit der Macht liebäugelnde Rikke ihren Sopran großartig aufleuchten lässt. Atmosphärisch reizvoll ist Hartmut Schörghofers an eine desolate Bunker-Landschaft erinnerndes Bühnenbild. Aus den Nebeln, in denen er später mit den Kindern verschwinden wird, taucht der Rattenfänger auf - wie ein Bürgerschreck aus dem Mittelalter. Topaktuell und todchic geht es hingegen in der Machtzentrale des Stadtregenten und seiner Frau zu (Thomas J. Mayer und Jennifer Barrette-Arnold). Hier begegnet man auch den in solchen Fällen immer wieder beliebten Paramilitärs in schwarzer Lederkluft. Kein Wunder, dass die Kinder dieses korrupten Paares aufbegehren und im Zentrum der Protestbewegung stehen. Waren das noch Zeiten! |
|
Oper: Deutsche Erstaufführung von Friedrich Cerhas Werk „Der Rattenfänger" nach Carl Zuckmayer im Staatstheater Darmstadt Von Heinz Zietsch DARMSTADT Wenn der Rattenfänger seinem Instrument beschwörende, einschmeichelnde Töne entlockt, dann kommen alle aus ihren Löchern. Man sieht den Rattenfänger nicht, aber man hört ihn auf seinem Sopran-Saxofon blasen. Man sieht auch nicht, wie die Ratten herauskommen, wohl aber die Menschen, die staunend und erschauernd zugleich nach draußen laufen. Auch manche Zuschauer werden am vergangenen Samstag im Großen Haus des Staatstheaters Darmstadt Gänsehaut bekommen haben bei den durchdringenden, beißenden, kratzenden Tönen des Saxofons, beim Rascheln im Schlagzeug und beim Anschwellen der Töne im Orchester, als würde ein Wind hindurchfegen. Das ist die wohl faszinierendste Szene in Friedrich Meyer-Oertels Inszenierung von Friedrich Cerhas „Der Rattenfänger". Sie ist das Finale des ersten Teils dieser Oper. Zum zweiten Mal hat jetzt das Staatstheater Darmstadt eine Cerha-Oper als deutsche Erstaufführung herausgebracht. 1981 war es „Baal". Kurt Horres hatte damals dieses Werk kurz nach der Uraufführung bei den Salzburger Festspielen in harter Schwarzweißzeichnung inszeniert. Auch „Der Rattenfänger" stellt wie „Baal" einen Außenseiter in den Mittelpunkt. Doch im Gegensatz zum „Baal" des stürmischen jungen Brecht, basiert „Der Rattenfänger" auf einem Spätwerk, auf Carl Zuckmayers letztem Schauspiel, das 1975 in Zürich erstmals auf die Bühne kam. Cerhas Oper wurde zwölf Jahre später während des Steirischen Herbstes in Graz uraufgeführt. Cerha hat das Schauspiel selbst als Libretto umgearbeitet, gestrafft und zwischen 1984 und 1986 das Stück komponiert. Es dauerte damals, 1987, fast vier Stunden. Seitdem wagte sich niemand mehr an eine Neuinszenierung. Für die Darmstädter Version wurde die Oper ein weiteres Mal einer Revision unterzogen und gestrafft. Jetzt dauert das Werk einschließlich Pause dreieinviertel Stunden. Dennoch sind Längen geblieben, und man fragt sich, ob der „Rattenfänger" nicht zusätzliche Kürzungen von zwanzig Minuten gut vertrüge, vor allem im heute arg moralisierend wirkenden Zeigefingertheater des zweiten Teils. Das mag auch an Zuckmayers Text liegen, vor dem Cerha wohl solchen Respekt gehabt hatte, dass er hier eher ein Schauspiel mit Musik geschrieben hat. Denn es wird oft mehr gesprochen als gesungen. Das sind sowohl die Stärken als auch die Schwächen dieser Oper. Die Stärken: Man versteht den Text fast komplett, auch ohne dessen Einblendung durch Übertitelung (ein grundsätzlich löbliches Unterfangen, das auch künftig bei deutschsprachigen Opern beibehalten werden sollte). Die Schwächen: Sobald sich die Musik zurückzieht, spärlicher wird, zieht sich das Stück in die Länge. Es ist die Magie der Töne, die hier fasziniert. Der Rattenfänger, mit Hose und einem dem schottischen Kilt ähnlichen Rock bekleidet, darüber ein fast herrschaftlich-fürstlicher Ledermantel, ist als Musikant und Spielmann ein lebendes Beispiel für diese Magie der Töne. Auf seinem Saxofon spielt er der First Lady, Divana, der Frau des Stadtregenten, zum nächtlichen Tanz auf und treibt sie damit sichtbar in die Enge; sie wird atemlos und stirbt, weil man ihrem Herztrank Gift beigemischt hat. John Pierce als Gast in der Titelpartie, der in Darmstadt schon als Lohengrin und Spielmann (in Schrekers „Spielwerk") zu hören war, beherrscht seinen Part nahezu perfekt. Er zeichnet seine Rolle einschmeichelnd, aber auch fordernd und nachdenklich; nur im zweiten Teil merkt man ihm bei leicht belegter Tenorstimme die Anstrengungen an, die diese Partie fordert. Beklemmend die ohnmächtige Trauer, die er im „Requiem für Rikke" in seine Stimme hineinlegt. Stimmungen, Atmosphäre macht der Komponist Cerha wirkungsvoll hörbar. Da sind die liebevollen Annäherungen zwischen dem Rattenfänger und Rikke, die ariosohaften Lieder und Einsprengsel in der Titelpartie und in der Rolle des Kleinen Henkers, dessen Lamento Christoph Begemann mit lyrischer Intensität gestaltet. Rhythmisch faszinierend, mit Elementen des Jazz spielend, ist der Beginn des zweiten Teils angelegt, wenn sich die Kinder und Jugendlichen dem Cannabis-Rausch hingeben, den sie besingen. Vor allem die vielen rein instrumentalen Zwischenspiele sind äußerst effektvoll komponiert und ziehen den Hörer sogartig in das Geschehen hinein. Hier herrscht Hochspannung dank der Intensität dieser Musik. Cerha verfügt virtuos über die unterschiedlichsten Stilmittel und packt in seine Oper problemlos mittelalterliche Tänze und gregorianische sowie protestantische Choräle im Stile Bachs hinein. Gewiss hat diese Faszinationskraft der Musik ihre Ursachen im fabelhaften Spiel des Orchesters, das unter der Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Blunier Bewundernswertes vollbringt: das reichhaltige Schlagwerk wird klanglich klar durchhörbar aufgefächert, der virtuose Gitarrenpart (dank elektrischer Verstärkung) ist bestens integriert, und Blunier baut mit dem Orchester raffiniert die verschiedenartigsten Steigerungsverläufe auf. Wirkungsvoll der leise Schluss mit dem lang gezogenen Ton a in der Orgel. Wohin gehen die Kinder? In ein wüstes, einsames Land? Steht dieser Ton für das Alpha eines Neubeginns, den der aufklärerische Dekan (der Sänger Horst Schäfer in einer Sprechrolle) am Ende anspricht: „Man muss nochmals anfangen, ganz von vorn"? Alle Sänger, viele darunter sind Gäste, in dieser gemeinsam mit den Wiener Festwochen erarbeiteten Aufführung leisten in diesem personenreichen Stück Vorzügliches: Jennifer Barrette Arnold mit ihrer ausdrucksstarken Altstimme als Divana, Thomas J. Mayer mit wendigem Bariton als ihr Mann, der Stadtregent, Morenike Fadayomi als Rikke. Engelhaft-leicht kommt sie daher, um so diesseitiger und kräftiger ist ihre Sopran-Stimme bis in die enormen Höhen hinein. Durchdringend der hohe Tenor von Wojciech Halicki, jungenhaft- frisch Diana Tomsche-Beikircher als Maria und Marian Olszewski als Martin. Beachtlich, wie Andreas Wagner den gelähmten Johannes singt und darstellt. In weiteren Rollen, teilweise auch mehrere Partien ausführend: Elisabeth Hornung als Elken, Friedemann Kunder als Stiftsprobst, Hubert Bischof, Thomas Fleischmann, der trotz Indisposition sang, die quirlige Melanie Nawroth in der Sprechpartie der draufgängerischen blinden Stina und viele andere mehr. Die Drehbühne, auf der Bühnenbildner Hartmut Schörghofer zwei kalte, beziehungslose, einander fremde Welten aufbaute, in denen sich jeder einzubunkern schien, sorgte für raschen Ortswechsel und markierte deutlich die gesellschaftlichen Gegensätze, die für Konfliktpotenzial sorgten: oben die Designerwelt der Reichen, tiefer liegend und durch einen Graben getrennt die Welt der Armen. Die Kostüme von Ulrike Rille passten sich gut den sozialen Gegebenheiten an und verbanden mit viel Fantasie geschickt Mittelalter und Gegenwart. Denn Meyer-Oertel verlegte die ursprünglich im Mittelalter spielende Rattenfänger-Geschichte in unsere Gegenwart. Auch wenn sich Hexenglaube, Zauberei, Henker und Galgen heute anachronistisch reiben, so bleiben Probleme wie der Fremdenhass und eine Jugend mit wenig Zukunfshoffnung nach wie vor aktuell. Doch selbst diese Bezüge können über die Längen im Stück nicht hinweghelfen. Das Publikum applaudierte am Ende begeistert, vor allem wohl wegen der glänzenden Bewältigung des Stückes durch sämtliche Mitwirkende. Weitere Aufführungen im April in Darmstadt: am 3., 7. und 28. Beginn jeweils um 19.30 Uhr. |
|
Aus einem fernen Land Friedrich Cerhas Zuckmayer-Oper "Der Rattenfänger" in Darmstadt Von Johannes Bolwin Eine Aura des Spukhaften: Über dunklen Gräben, zwischen den schäbigen Bretterbuden der Vorstadt, schimmern Rauchschwaden im fahlen Gegenlicht; das Gelände wirkt zerfurcht, modrig. Ein Henker im Bürokratenoutfit wuselt umher - jemandem ist gerade die Hand abgehackt worden, weil er Ratten erschlagen hat. Das aber ist verboten, denn der Regent der von einer Rattenplage heimgesuchten Stadt will die Kornpreise hoch halten, auf dem Rücken der Bürger, zur Stabilisierung seines Regimes. "Die Lage ist wie trockenes Stroh - ein Funke, und es lodert", vermeldet der Spitzel, ein fetter Hostienbäcker. Wie ein Trabant des Todes zieht ein metallisches Blutgerüst seine Kreise; hier wird geköpft, gebrochen, gehenkt. Doch längst nagt der Tod auch an den Stützbalken der herrschaftlichen Paläste. Unruhiges Tackern und Rascheln im Untergrund. Friedrich Cerhas Oper "Der Rattenfänger" basiert auf Carl Zuckmayers gleichnamigem Schauspiel; der 1926 im zwölftönigen Wien geborene spätere "Lulu"-Vollender hat den sprachgewaltigen Text leicht gestrafft und ihr eine zeitlose Modernität gegeben. Uraufgeführt wurde die Oper erst 1987 in Graz. Im Beisein des Komponisten erlebte das sozialkritische Werk nun am Staatstheater Darmstadt in Zusammenarbeit mit den Wiener Festwochen seine deutsche Erstaufführung - und eine Sternstunde. Es ist die trotz aller Dramatik und dunkel-grausamer Grundierung sehr melancholisch gefärbte Geschichte eines Sonderlings (hünenhaft, auch stimmlich überragend: John Pierce), der "von weit her" kommt. Sozialem Anpassungsdruck und Herrscherwillkür entzieht er sich durch Courage und "Spaß am Musizieren". Sein Instrument ist ein klarinettenartiges Sopransaxophon, leitmotivisch ist ihm leise Gitarrenmusik und eine alte Balladenweise zugeordnet. Zum infernalisch sich auftürmenden Orchestertutti lockt der Außenseiter die Ratten aus den Löchern und entsorgt sie vertragsgemäß. Doch die Machthaber wollen ihn für ihre Politik der Repression einspannen. Mit den Kindern, die in verehren, stiehlt er sich durch den Nebel davon, begleitet von mystisch schwebendem Orchesterklang, auf der Suche nach einem neuen Land. Ein verkrüppeltes Kind (anrührend: Andreas Wagner) bleibt zurück. Friedrich Meyer-Oertels in der Personenführung trennscharfe Regie geht virtuos mit dem Sagen-Stoff um. Alles passt organisch zusammen, von den moderat modernen, eher das Jetzt denn uralte Zeiten spiegelnden Kostümen bis zur Lichtregie. Über das Geschehen auf der aparten Drehbühne (Hartmut Schörghofer) schmiegt sich illustrierend eine atmosphärische, reich instrumentierte Musik (Leitung: Stefan Blunier) - magisch, fremd, sprachempfindlich, teils spätromantisch, wie eine Botschaft aus einem fernen Lande. Drei hochspannende Opernstunden von starker Suggestivkraft! |
|
Moralische Fabel mit Längen Bereits das erste Bild dieser Oper vereinigt die wesentlichen Merkmale dieser Vertonung eines bekannten Stoffes in sich. Ohne einen einzigen Ton aus dem Orchestergraben als Einleitung oder Begleitung - geschweige denn eine Ouvertüre - beritt der Rattenfänger (John Pierce) eine unwirtliche Bühnenlandschaft, angesiedelt zwischen Vorstadt-Beton und Kläranlage, und sinnt über den grund seines Hierseins nach. Nichts hat ihn hierher getrieben, nichts hat er hier zu suchen, nichts lockt ihn hier. Und doch such er hier nach einer Bleibe. Erst langsam setzt zu seinem Sprechgesang zögernd Musik ein, nur wenige Akzente setzend. Alles ist auf die Stimme und die textliche Aussage konzentriert. Carl Zuckmayer hat die Geschichte vom Hamelner Rattenfänger in den siebziger Jahren in ein Theaterstück transformiert und dabei gesellschaftskritisch gehörig zugespitzt. Bei ihm nutzt die Obrigkeit um den Regenten (Thomas j. Mayer) und seine kapriziöse Frau (Jennifer Barrette Arnold) die Rattenplage. Rattenschlagen ist bei schwerer Strafe verboten, um dadurch am hohen Getreidepreis zu verdienen. Die Kirche beteiligt sich - wie wir es aus der Geschichte kennen - skrupellos am Spiel um Macht und Geld, und nur die Angst vor dem langsam aufbegehrenden Volk zwingt die Herrschenden zum Handeln. Der Regent geht auf das Angebot des Rattenfängers ein, die Schädlinge mit Hilfe seiner Flöte aus der Stadt zu locken, jedoch mit dem Hintergedanken, ihn danach loszuwerden. Rikke, die Tochter des biederen Vorstadt-Henkers, sieht in dem Rattenfänger den möglichen Retter des Volkes und verliebt sich in ihn. Auch die Kinder des Regenten, ganz im Sinne der 68er-Generation, wenden sich dem Rattenfänger zu und von ihren Eltern ab. Nachdem dieser die Ratten vertrieben hat und es ablehnt, mit seiner Flöte auch das unruhige Volk fern in den Osten (in die Sklaverei zu führen - die Assoziation an die "Endlösung der Judenfrage" ist unübersehbar -, nimmt man ihn fest und verurteilt ihn wegen Hexerei zum Tode. Die Regentin jedoch - ebenfalls von ihm fasziniert - erbittet sich ihn als Spielmann zu einem nächtlichen Tanz aus, bei dem sie sich verausgabt und schließlich an einem von ihren Kindern verabreichten Gifttrank stirbt. Dafür fälschlich zum Galgen geschickt, sieht sich der Rattenfänger erst vom Henker selbst gerettet, der plötzlich nicht mehr den jahrelang pflichtgemäß befolgten Befehlen der Obrigkeit gehorchen will - auch hier wieder der Hinweis auf den Befehlsnotstand im Dritten Reich - und sich selbst als Opfer anbietet. Als dieser Strohhalm nicht trägt, naht die Botschaft, dass sich die Kinder des Regenten umbringen wollen, wenn der Rattenfänger stirbt. Vom Tode seiner Frau, dem Aufstand des Volkes und vom Abfall seiner Kinder tief verstört, steigt der Regent selbst aufs Schafott. Mittlerweile haben jedoch Landsknechtbanden mordend und plündernd die Macht in der Stadt übernommen, und Rikke kann sich der Vergewaltigung nur durch Selbstmord entziehen. Der an ihrer Leiche trauernde Rattenfänger wird wiederum des Mordes bezichtigt und kann sich nur mit Mühe der Hinrichtung entziehen. Von der allgemeinen Dekadenz, Habgier und Selbstsucht der Einwohner dieser Stadt angewidert, findet er in den Kindern Bundesgenossen und zieht schließlich mit ihnen in eine ungewisse aber hoffnungsvollere Zukunft. Man sieht in dieser Ausprägung des bekannten Märchens deutlich die Handschrift der siebziger Jahre, mit der deutlichen Polarisierung in Herrschende und Beherrschte. Die große moralische Geste mit dem Anspruch der Erneuerung kommt auch bei Zuckmayer voll zur Geltung. Mehr oder minder alle Themen kommen zur Sprache: die Ausbeutung, die persönliche Raffgier, der Verrat an der eigenen politischen oder geistlichen Verantwortung, kurz: das Übel des kapitalistischen Staates. Das Bühnenbild unterstützt die Polarisierung, indem es die Welt der Oberen in einem "Designer-Loft" ansiedelt und durch einen "Abwassergraben" aus Beton gegen die schäbigen Behausungen der "Unterstadt" abgrenzt. Die Drehbühne rückt mal diese, mal jene Welt in den Vordergrund, lässt aber jeweils die andere Welt im Hintergrund erahnen und drohen. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Stücks erlebte der Kommunismus vor allem in den Ländern des von ihm unberührten Westens eine verbale und intellektuelle Blüte, die ihm auch den Ruf des ungebrochenen Erfolgs in seinen Ursprungsländern einbrachte. sein sang- und klangloser Zusammenbruch war zu dieser Zeit undenkbar. So gesehen, konnte Zuckmayer diese Ideologie mit ihrer Einteilung der Welt in Gut und Böse noch -fast - naiv kolportieren ohne anzuecken. Heute jedoch, da die Welt zwar nicht unbedingt besser aber dafür unübersichtlicher geworden ist, mutet der moralische Zeigefinger bisweilen etwas hausbacken an. Dieser Einwand gegen das Stück richtet sich jedoch nicht grundsätzlich gegen die Oper selbst, denn wir wissen, dass die beeindruckendsten Opern nicht unbedingt auf logischen und konsistenten Libretti basieren. Cerha nähert hat sich dem Stoff aus respektvoller Distanz. Das Wort steht im Vordergrund, und er vermeidet es, den Text mit Klang zuzudecken. Das kommt natürlich der Verständlich außerordentlich zugute, so dass man der Handlung mühelos folgen kann. Es mag Cerha auch gefährlich erschienen sein, den an vielen Stellen mit eindeutigen Assoziationen an das Dritte Reich befrachteten Text zu ändern, weil leicht ein falscher Zungenschlag sich ungewollt hätte einschleichen können. So lässt er die Worte wirken und räumt ihnen dazu einen weiten Freiraum ein. Die Musik tritt vo allem bei den Dialogpassagen weit gehend in den Hintergrund und läasst diese oft wie ein barockes Rezitativ im neuen klanglichen Gewand erscheinen. Das will jedoch nicht heißen, dass sich Cerhas Musik auch durchsetzen kann. In den großen expressiven Momenten, so beim Auszug des Rattenfängers mit den Ratten oder bei den dramatischen Szenen, schwingt sich sie sich zzu einem geradezu Atem beraubenden Crescendo auf, das den Raum vollständig füllt. Auch die betörende Wirkung der Rattenfänger-Flöte - hier ein Saxophon - kommt musikalisch zwingend zum Ausdruck. Und jedes Mal, wenn dieses Instrument ertönt, simuliert das Schlagzeug in geradezu unheimlicher Weise das unterirdisch Rascheln der Rattenbeine. Ansonsten trägt Cerhas Musik über weite Strecken erstaunliche tonale, ja fast herkömmliche Züge, was nicht heißen soll, dass sie abgestanden oder überholt wirkt. Ihm gelingt ein erstaunliche Verbindung von wirklich moderner Klangfärbungen und harmonischer Strukturen mit Elementen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. In diesem Sinne baut Cerhas Musik eine Brücke zur Musik von Richard Strauss oder Gustav Mahler, ohne sich diesen anzubiedern. Auch in den expressiven Momenten wirkt seine Musik nie anstrengend oder gar quälend. Da, wo sie quälen soll, tut sie es auch, aber nicht ungezielt, sondern als Ausdruck einer quälenden Situation. Und ohne jede falsche Süßlichkeit weiß er auch lyrische - so im Verhältnis zwischen Rikke und dem Rattenfänger - und tragische - die Trauer des Rattenfängers nach ihrem Tod - musikalisch umzusetzen. Dennoch bleiben neben der moralischen "Deutlichkeit" weitere Kritikpunkte. Vor allem im ersten Teil weist die Inszenierung deutliche Längen auf. Die Betonung langer Dialoge in rezitativer oder gar reiner Sprechform ohne großen Handlungsfortschritt wirkt sich nicht gerade belebend aus, zumal sich der Inhalt oftmals als belanglos oder als reine Wiederholung und Verstärkung der gesellschaftskritischen Aspekte herausstellt. Leider verfällt die Inszenierung bisweilen in den alten Fehler, ein Thema etwas breit zu treten und Dinge drei Mal zu sagen, die der Zuschauer auch bei ersten Mal versteht. Weniger wäre hier mehr gewesen. Im zweiten Teil gewinnt das Stück dann jedoch an Dichte und Dramatik, und auch die Verzahnung von Musik und Handlung wird enger und dynamischer. Es treten keine Längen auf, und die Handlung schreitet konsequent und mit steigender Intensität voran, von der Musik nicht nur begleitet, sondern zeitweise richtig gehend getrieben. Der Auszug des Rattenfängers mit den Kindern vollzieht sich dann langsam, fast schleppend, mit einem großen, sinnenden musikalischen Fragezeichen, das die Unsicherheiten aller Utopien und die Möglichkeit des Scheiterns ausdrückt. Schließlich verschwinden die gestalten im imaginären Weser-Nebel und die letzten leisen Kläng im Raum. Das gesamte Ensemble bestach bei der Premiere durch hohe Präsenz, Genauigkeit und Konzentration. Da ist vor allem der allgegenwärtige John Pierce als Rattenfänger zu nennen, der allein schon durch seine schiere Größe beeindruckt. Doch auch stimmlich und darstellerisch wird der dieser Größe gerecht. Ihm zur Seite überzeugte Morenike Fadayomi als Rikke mit einem strahlenden Sopran, der auch in den Höhen viel Kontur zeigte, und durch ein temperamentvolles und variables Spiel. Jennifer B. Arnold stattete die Stadtregentin Divana mit einer gelungenen Mischung aus Dekadenz, Langeweile und Ichsucht aus, die letztlich nur die tiefe Frustration dieser Figur übertünchen. Auch sie stimmlich und darstellerisch ein klarer Pluspunkt. Thomas J. Mayer musste sich als Stadtregent eher im "halbsprachlichen", d.h. rezitativen Bereich bewegen. Große gesangliche oder darstellerische Momente blieben ihm als Vertreter einer vor allem kalt und rational agierenden Obrigkeit versagt, er meisterte diese Rolle jedoch überzeugend. Ähnliches gilt für den Stiftsprobst (Friedemann Kunder), den Stadtrichter (Hubert Bischof) und den Roggenherzog. Horst Schäfer hat als "liberaler" Dekan und Wissenschaftler - jede Rolle hat bei Zuckmayer auch einen Zeitbezug - sogar eine reine Sprechrolle. Diana Tomsche-Beikircher und Marian Olczewski spielen die rebellierenden Oberschichtkinder Maria und Martin mit viel frische und jugendlichem Elan, Melanie Nawroth gibt überzeugend eine aufsässige "Punkerin" aus dem Volk, Andreas Wagner mit viel physischem Aufwand und stimmlicher Variabilität den gelähmten Johannes und Wojciech Halicki einen verschlagenen Hostienbäcker. Elisabeth Hornung tritt diesmal als Kammerfrau Elken etwas in den Hintergrund. Das Orchester näherte sich Cerhas Musik mit viel Gespür für die Zwischentöne und für die stetig wechselnden musikalischen Strukturen. Stefan Blunier und seinem Ensemble war es zu verdanken, dass diese Musik nie als störend und doch nie als belanglos empfunden wurde. Die Balance zwischen Spannung, lyrischen Momenten und Herausforderung blieb bis zum Schluss in einer wohl ausgewogenen Form erhalten, so dass keinen Moment das Gefühl eines Bruchs zwischen Bühne und Orchester entstand. Das Premierenpublikum nahm Regisseur Friedrich Meyer-Oertel und dem anwesenden Komponisten auch die Längen des ersten Teils nicht übel und bedachte beide sowie Ensemble und Orchester einhellig mit lang anhaltendem Beifall. Keine "Buhs", einige "Bravos" - vor allem für die Protagonisten - und rundherum das Gefühl einer gelungenen Uraufführung. |
|
Vienna esalta Cerha Le recensioni della prima esecuzione assoluta di "Der Rattenfanger", avvenuta a Graz nel 1987, ne avevano spesso criticato la sua intricata trama e la faticosa lunghezza. La versione riveduta a cui abbiamo assistito a Vienna, invece, convince proprio per la simbiosi tra momento drammatico e musicale, con una regia che si muove negli ambiti di una teatralità più asciutta, rinunciando agli eccessi tipici di molte regie operistiche. Il richiamo ai principi teorici di Brecht è molto forte, e anche le scenografie ricordano i precetti del maestro tedesco. I luoghi della vicenda vengono solo accennati, caratterizzati da alcuni elementi, ma non proposti sulla scena in modo realistico: le strutture di metallo e legno si ispirano alle utopie architettoniche del costruttivismo sovietico degli anni Venti, gli interni sono essenziali e i costumi delineano la funzione del personaggio senza sfoggio e sfarzo. I cantanti si adattano bene a questa scelta di purismo registico, con chiarezza di esposizione e dizione e rinuncia a voluttà esibizionistiche, L'orchestra del teatro di stato di Darmstadt stupisce e ancora una volta ci convince il fatto che non è il gran nome che conta. La lettura quasi strutturale della partitura non solo ne chiarisce quasi sempre gli intenti, ma sottolinea in maniera efficiente tutte le sfumature drammatiche della vicenda, senza però scadere nel descrittivismo e soprattutto senza temere alcun eccesso, passeggiando dal pianissimo al fortissimo (purtroppo a volte coprendo il canto) lungo un arcobaleno inesauribile di timbri e impasti sonori. Grazie a questo esemplare allestimento, la lunghezza, la complessità e l'intricato sviluppo dell'opera non hanno influito sulle facoltà ricettive del pubblico, che ha dedicato calorosi applausi al cast, in particolar modo al compositore e all'orchestra. Juri Giannini |