|
Messer, Mühlrad, Menschlichkeit VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Gibt es das: die tönende Darstellung eines Messers? In Leos Janacek erster berühmt gewordener Oper Jenufa (1904) erklingt gleich zu Beginn ein erregt pochendes Motiv auf dem Xylophon, ein "Klopfen auf Holz", das, zusammen mit einem Dreierrhythmus, Unglück ankündigt. Das Messer löst im Verlaufe des Stückes eine dramatische Kettenreaktion aus. In der Hand des eifersüchtigen Laca verunstaltet es mit impulsivem Schnitt das Gesicht der schönen, unerreichbaren Jenufa und macht ihr den Bräutigam Steva abspenstig. Katastrophaler noch: Um die Verlassene doch noch unter die Haube zu bringen, tötet die Küsterin und Ziehmutter Jenufas deren und Stevas Kind nach der geheimgehaltenen Geburt. So kann Jenufa (die nichts von dem Mord weiß) den ihr ergebenen Laca heiraten. Während der erste Akt dieses Dramas sich fast wie eine Milieustudie aus dem mährischen Bauernalltag anlässt, sorgt hier doch das kontinuierliche Xylophon für Spannung, die auf Außergewöhnliches deutet. Der Klopfrhythmus kann natürlich auch mit Lacas Unruhe und Getriebenheit assoziiert werden, mit der Unerbittlichkeit tödlicher Ereignisse, wie Musik immer einen weiten Hof von Vieldeutigkeit um sich verbreitet. Gleichwohl möchte man ihr so etwas wie eine Zoom-Qualität zumessen, die Fähigkeit zu schneidender Markierung, ja Sezierung: Musik als Messerschärfe, Musik als Messer. Schärfer denn je fokussiert der Regisseur Tilman Knabe (in Frankfurt bekannt seit Berns Loebes Einstandspremiere des Schubert'schen Fierrabras vor drei Jahren) diese krasse, blutige Opernerzählung, die im Mittelakt kulminiert. Hier wird die Küsterin zur monumental einsamen dramatis persona, die in einem finsteren Augenblick ihr "Seelenheil" verliert und eine Untat begeht, um Jenufas Unbescholtenheit für die dörfliche Moral zu retten. Im dritten Akt kommt das Verbrechen ans Licht - ausgerechnet während Lacas und Jenufas Hochzeitsfeier. Die Grenzüberschreitung Um die verdächtige Jenufa zu entlasten, muss die Küsterin ein umfassendes Geständnis vor der versammelten Dorfgemeinschaft ablegen. Von diesem Moment an überschreitet Janacek den bis dahin noch einigermaßen für seine Oper passenden Rahmen des "Verismo" und wird zum wunderbaren Sprecher von Menschlichkeit. Jenufa und Laca verzeihen der Abgeirrten, die dem Zugriff der juristischen Gerechtigkeit nicht entgehen kann. Ihrer beider leidgeprüfte Liebe zueinander wölbt sich in einem großen, hymnischen Schlussgesang utopischer Versöhnung entgegen. Tilman Knabe marktet dieser Finalvision nichts von ihrer - nur noch mit dem Beethoven'schen Fidelio-Schluss vergleichbaren - Würde und Größe ab. Doch er exterritorialisiert diese Szene, indem er die Sänger vor den nun immer lichter werdenden Bühnenrahmen postiert. Und Jenufa hält das Messer in ihrer Hand als unauffällige, hinfällig gewordene Reliquie böser Erinnerung. Es war beinahe unglaublich, dass Knabes Inszenierung die letzte, äußerst eindringliche Frankfurter Jenufa-Optik von Alfred Kirchner (1979) noch übertreffen konnte. Es gelang ihm durch den strukturellen Aplomb einer mirakulösen Übereinstimmung mit Janaceks besonderer musikalischer Idiomatik, deren unredseligem Lakonismus, ihrer zeichnerischen Klarheit, der Wucht ihres lapidaren Gefühlsambitus'. So sind Askese, Schmucklosigkeit und jäher Zugriff die entscheidenden Merkmale einer auf den Punkt gebrachten, umweglos das Drama realisierenden Bühnenerzählung. Einen wesentlichen Anteil dabei hatten die suggestiven Bühnenbilder von Alfred Peters. Sie funktionierten schlüssig als quasi filmische Aufblendungen aus der bei den Aktanfängen völlig schwarzen Bühnenfläche. Das öffnete sich aus winzigen Rechtecksegmenten niemals als volles Bühnenformat, sondern nur in Teilausschnitten. Schon im ersten Akt fehlte die Höhe. Der zweite beschränkte sich auf die enge, karg möblierte Bauernstube der Küsterin. Bei deren Wahnsinns-Ausbrüchen gegen Schluss verengte sich der Raum um sie nochmals zum schmalen Spalt. Bei Jenufas Ave Maria tat sich links ein imaginärer Traum- und Hoffnungsraum strahlend auf, fast eine Strandlandschaft. Auch die Hochzeit im dritten Akt vollzog sich in der engen, bei der Turbulenz um die überraschend aufgefundene Kinderleiche drangvoll mit aufgeregter Menschenmasse gefüllten Bauernstube. Drohend ließ Knabe den Chor zunächst von einer Seite anstürmen; während der Beichte der Küsterin beruhigt sich das Kollektiv und folgt atemlos von beiden Seiten dem grauenhaften Bericht. Rettung der Heimat Einen phänomenalen Zug der Inszenierung könnte man Rettung der "Heimat" dieses Stückes nennen. Sein Element ist ja (gerade auch musikalisch) eine sehr konkrete Lebenswelt: ein mährisches Dorf um 1900. Das Bühnenbild scheut sich nicht, naturalistische Schauplätze anzudeuten, so im ersten (und als Hintergrund nochmals im dritten) Akt eine Bauernhausfront und ein mächtiges Mühlrad, konterkariert von einem schimmernden kasettierten Glasboden. Bewusst weniger konsequent die Kostüme (Birgitta Lohrer-Horres) mit einer größeren Bandbreite zwischen modern (einige Baseballkappen) und altertümlich (besonders bei der Küsterin in prüdem Schwarz und dem konservativ-linkischen Hochzeiter Laca). Als Vokalsolisten waren keine "Schönsänger" zu erleben, aber engagierte und kompetente Espressivo-Künstler. Ann-Marie Backlund war eine konzentriert intonierende, lyrisch ausschwingende Jenufa, Nadine Secunde, eine erfahrene Bühnenpersönlichkeit, die mehr auf verklemmte Wärme als matriarchale Dämonie hingelenkte Küsterin, Yves Saelens der stimmmächtig tenorale Schön- und Jämmerling Steva, Stuart Skelton der darstellerisch differenzierte Laca mit markantem Charaktertenor, Simon Bailey der profilierte Altgesell, June Card die prägnante Burya. Vorzüglich einstudiert die Chordiktion (Alessandro Zuppardo), bei den folkloristisch inspirierten Lied- und Tanzstrophen mehr "leggiero" als frenetisch. Auf Eleganz und Transparenz setzte auch der Gastdirigent Shao- Chia Lü, GMD in Hannover, der auch die typischen Härten und Schroffheiten Janaceks meisterlich und dramatisch zupackend mit dem exzellent präsenten Opernorchester zu realisieren vermochte. Auch musikalisch: Messerschärfe. Zu hoffen, dass eine von solchen Großtaten wie Jenufa beflügelte Frankfurter Oper gedeihlichen weiteren Zeiten entgegengeht. [ document info ] Dokument erstellt am 20.06.2005 um 15:48:14 Uhr Erscheinungsdatum 21.06.2005 |
|
Janaceks "Jenufa" an Oper Frankfurt
Jenufa kümmert sich um einen Topf Rosmarin - und Oma Buryja schält Kartoffeln. Das Mühlrad fehlt auf der Bühne ebenso wenig wie später die katholische Puppenstuben-Atmosphäre im Hause der Küsterin. Ganz realistisch richtet Tilman Knabe seine Frankfurter Neuinszenierung von Leos Janaceks Oper "Jenufa" aus. Bilder aus dem mährischen Landleben sozusagen, für die der Regisseur Wort für Wort die Szenenanweisungen des Komponisten berücksichtigt hat. Mancher Premieren-Abonnent, der jüngst noch seinem Unmut über die Gewaltexzesse in Calixto Bieitos Frankfurter "Macbeth"-Inszenierung Luft gemacht hatte, dürfte sich danach wieder mit der Oper Frankfurt versöhnt haben. Tilman Knabe wurde am Ende ausnahmslos bejubelt. Freilich entgeht der Realismus seines Regie-Konzepts nicht immer der Gefahr, die Darstellung ins Klischeehafte abgleiten zu lassen: Man trinkt offenbar viel Bier in osteuropäischen Dörfern, trägt eher alltagstaugliche Kleidung wie vom Wühltisch (Kostüme: Birgitta Lohrer-Horres) und ist sehr, sehr katholisch. Ein Eindruck, der durch die gemäßigte Verlagerung in die Jetztzeit eher noch verstärkt wird - die bereit gestellten Bierkästen sind heutige handelsübliche Ware. Immerhin: Ganz ungebrochen bleibt Knabes Regie nicht. Zum Beispiel ist das pittoreske Mühlen-Bild des ersten Aktes in einen schwarzen Rahmen wie im Spielfilm-Format gerückt, der sich für die heimelige Stube der Küsterin im zweiten Akt noch verengt (Bühne: Alfred Peter). Und als die Küsterin den Entschluss fasst, das uneheliche Kind ihrer Ziehtochter Jenufa zu ermorden, fokussiert sich der Blick durch den noch weiter verengten Rahmen allein auf sie. Dass Jenufa und Laca am Ende aus ihm heraustreten, ist konsequent. So hängt, trotz sorgfältiger Personenführung der Regie, die szenische Überzeugungskraft der einzelnen Sänger zu einem deutlichen Teil von ihren darstellerischen Fähigkeiten ab. Über jeden Zweifel erhaben ist in dieser Hinsicht die amerikanische Sopranistin Nadine Secunde, die in Frankfurt als Küsterin debütiert. Keine bloß dämonische Kindsmörderin, sondern eine spürbar in sich zerrissene, fast fragile Gestalt, von Nadine Secunde mit der Ausdruckskraft intensiver Wagner-Erfahrung gesungen. Daneben wirkt die noch ganz jugendlich helle Jenufa von Ann-Marie Backlund eigentümlich passiv, etwa wenn sie im Pyjama durch die Stube der Küsterin geistert; den Kindvater Steva gibt Yves Saelens als auch vokal recht robusten Gesellen. Ob allerdings Stuart Skelton als dessen Halbbruder Laca ständig wie ein gutmütiger Bär über die Bühne trotten muss, ist Geschmackssache; Skeltons Tenor wirkt zwar stabil, aber nicht allzu wandlungsfähig. Als alte Buryja ist mit June Card eine erfahrene Sängerin zu erleben, die vor gut 25 Jahren selbst die Jenufa in Frankfurt sang. Für die musikalische Leitung ist Shao-Chia Lü, Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover, verantwortlich. Sein Janácek klingt nicht gerade hart oder markant, eher geschmeidig, verbindlich und entfaltet dabei doch eine unterschwellige Sogwirkung, zumal das opulent besetzte Orchester nie die Solisten akustisch zu überlagern droht - sorgfältige Stütze für die Inszenierung in ihrer spürbaren Walter-Felsenstein-Tradition, immerhin tschechisch (mit deutschen Übertiteln) gesungen und vom Publikum eben dankbar aufgenommen. AXEL ZIBULSKI |
|
Zoom in die menschliche Seele Von Michael Dellith Die Frankfurter mögen die "Jenufa". Allein in den vergangenen 25 Jahren erlebte die Janácek-Oper dort drei Neuinszenierungen, zuletzt 1995 unter Sylvain Cambreling. Ein Grund für diese Vorliebe mag die zeitlose Aktualität des Stoffes sein. Da ist ein junges, hübsches Mädchen namens Jenufa, das zwischen zwei Männern steht: Sie selbst liebt den Draufgänger Steva, von dem sie ein Kind erwartet, doch dieser lässt sie im Stich. Sein Stiefbruder und Rivale, der Bauernbursche Laca, hingegen empfindet aufrichtig für Jenufa, kommt aber zunächst nicht zum Zuge – eine tragische, fast alltägliche Geschichte, möchte man meinen, die allerdings durch die Figur der Ziehmutter, die Jenufas Kind aus Angst vor der Schande ertränkt, beinahe antike Dimensionen erhält. Janácek ließ sich am Beginn des 20. Jahrhunderts von diesem Sujet zu einer Musik inspirieren, die in ihrem Gebrauch von Motiven und Orchesterfarben avantgardistisch anmutet – und das alles, um die wechselnden Seelenzustände der Protagonisten auf der Bühne für den Hörer klanglich erfahrbar zu machen. Die "filmische" Montagetechnik der Komposition hat auch den Regisseur Tilman Knabe ganz offensichtlich auf die Grundidee seiner Inszenierung gebracht. Gemeinsam mit Alfred Peter und der Kostümbildnerin Brigitta Lohrer-Horres (sie steckt die Sänger in Alltagskleidung, wie man sie in der tschechischen Provinz heute noch antreffen kann) entwickelte er ein schwarzes Bühnenbild, das sich wie eine Kamerablende allmählich öffnet und wieder schließt. Sie gibt den Blick frei auf verschieden große Tableaus: im ersten Akt auf eine "realistische" Dorf-Darstellung mit Mühlenrad, Blumeninsel und Häuschen, im zweiten und dritten Akt auf eine karge mährische Bauernstube mit Marienaltar. Dieser Zoom-Effekt ist nicht bloß Spielerei, er visualisiert kongenial die innere Dramatik des Stücks und zeigt die handelnden Personen als Gefangene ihrer eigenen Wirklichkeit – der Kamerablick wird so das Fenster zur Seele. Sängerisch bewegte sich die im tschechischen Original gegebene Premiere auf einem bis in die kleinste Nebenrolle hinein ausgeglichenen Niveau. Die Amerikanerin Nadine Secunde gewann der Partie der Küsterin weit mehr als die wahnhaften Ausdrucksmomente ab. Sie brachte auch mütterliche Gefühle in ihr Spiel mit ein. Vom Timbre nicht unähnlich gab Ensemblemitglied Ann-Marie Backlund ihr Rollendebüt als Jenufa, emotional bemerkenswert wandlungsfähig und mit großem stimmlichen Ambitus. June Card, die 1979 in Frankfurt noch als Jenufa zu hören war, sang diesmal die Großmutter Buryja, warmherzig und mit feiner Ausstrahlung. Bei den Männern gefiel Stuart Skelton in der Partie des Laca als leidenschaftlicher Sänger-Darsteller zwischen Aggressivität und Sanftmut, wie auch Yves Saelens bei dem Trunken- und Raufbold Steva nicht nur den Charakterzug des Schürzenjägers hervorhob. Hervorragend zusammengehalten wurden Ensemble und Chor, der wie immer von Alessandro Zuppardo sehr präzise vorbereitet war, von Shao-Chia Lü am Pult des Museumsorchesters. Dem aus Taiwan stammenden Dirigenten, seit 2001 Generalmusikdirektor in Hannover, gelang die Gratwanderung zwischen Ausdruck und Kantabilität. Bei aller Farbigkeit und Schroffheit der Musik vergaß er nie das Melos, ließ Janácek zuweilen wie Puccini klingen. Am Ende viele Bravos – auch für die Regie! |
|
Mährisches Landleben in bester Tradition Von Axel Zibulski
FRANKFURT Jenufa kümmert sich um einen Topf Rosmarin, und Oma Buryja schält Kartoffeln. Das Mühlrad fehlt auf der Bühne ebenso wenig wie später die katholische Puppenstuben-Atmosphäre im Hause der Küsterin. Ganz realistisch richtet Tilman Knabe seine Frankfurter Neuinszenierung von Leos Janaceks Oper "Jenufa" aus. Bilder aus dem mährischen Landleben sozusagen, für die der Regisseur Wort für Wort die Szenenanweisungen des Komponisten berücksichtigt hat. Mancher Premieren-Abonnent, der jüngst noch seinem Unmut über die Gewaltexzesse in Calixto Bieitos Frankfurter "Macbeth"-Inszenierung Luft gemacht hatte, dürfte sich danach wieder mit der Oper Frankfurt versöhnt haben. Tilman Knabe wurde am Ende ausnahmslos bejubelt. Freilich entgeht der Realismus seines Regie-Konzepts nicht immer der Gefahr, die Darstellung ins Klischeehafte abgleiten zu lassen: Man trinkt offenbar viel Bier in osteuropäischen Dörfern, trägt eher alltagstaugliche Kleidung wie vom Wühltisch (Kostüme: Birgitta Lohrer-Horres) und ist sehr, sehr katholisch. Ein Eindruck, der durch die gemäßigte Verlagerung in die Jetztzeit eher noch verstärkt wird - die bereit gestellten Bierkästen sind ganz heutige, handelsübliche Ware. Immerhin: Ganz ungebrochen bleibt Knabes Regie nicht. Zum Beispiel ist das pittoreske Mühlen-Bild des er-sten Aktes in einen schwarzen Rahmen wie im Spielfilm-Format gerückt, der sich für die heimelige Stube der Küsterin im zweiten Akt noch verengt (Bühne: Alfred Peter). Und als die Küsterin den Entschluss fasst, das uneheliche Kind ihrer Ziehtochter Jenufa zu ermorden, fokussiert sich der Blick durch den noch weiter verengten Rahmen allein auf sie. Dass Jenufa und Laca am Ende aus ihm heraustreten, ist konsequent. Über jeden Zweifel erhaben ist in darstellerischer wie musikalischer Hinsicht die amerikanische Sopranistin Nadine Secunde, die in Frankfurt in der Partie der Küsterin debütiert. Keine bloß dämonische Kindsmörderin, sondern eine spürbar in sich zerrissene, fast fragile Gestalt, von Nadine Secunde mit der Ausdruckskraft intensiver Wagner-Erfahrung gesungen. Daneben wirkt die noch ganz jugendlich helle Jenufa von Ann-Marie Backlund eigentümlich passiv, etwa wenn sie im Pyjama durch die Stube der Küsterin geistert; den Kindsvater Steva gibt Yves Saelens als auch vokal recht robusten Gesellen. Ob allerdings Stuart Skelton als dessen Halbbruder Laca ständig wie ein gutmütiger Bär über die Bühne trotten muss, ist Geschmackssache; Skeltons Tenor wirkt zwar stabil, aber nicht allzu wandlungsfähig. Als alte Buryja ist mit June Card eine erfahrene Sängerin zu erleben, die vor gut 25 Jahren selbst die Jenufa in Frankfurt sang. Für die musikalische Leitung ist Shao-Chia Lü, Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover, verantwortlich. Sein Janácek klingt nicht gerade hart oder markant, eher geschmeidig, verbindlich, entfaltet dabei doch eine unterschwellige Sogwirkung, zumal das opulent besetzte Orchester nie die Solisten akustisch zu überlagern droht - sorgfältige Stütze für die Inszenierung in ihrer spürbaren Walter-Felsenstein-Tradition, immerhin tschechisch (mit deutschen Übertiteln) gesungen und vom Publikum eben dankbar aufgenommen. |
|
Oper Frankfurt È consolante trovare che musicisti italiani si facciano apprezzare come validi professionisti oltre i confini alpini, verso quell’Europa che oggi, in pieno dibattito sulla sua Costituzione, dovrebbe rappresentare, per tutti i paesi aderenti, il paradigma con il quale confrontarsi e con cui fare i conti al momento delle valutazioni. Francoforte, città simbolo, in qualche senso, di questa continentalità (la sede della Banca europea è proprio di fronte al Teatro dell’Opera), ha come direttore musicale e direttore del coro due italiani: rispettivamente Paolo Carignani e Alessandro Zuppardo. La stagione 2004/2005, ormai vicina alla sua conclusione, ha compreso nelle settimane scorse l’allestimento di una nuova Jenůfa di Leoš Janáček, capolavoro assoluto del musicista moravo che raggiunge cosě uno dei punti fondamentali delle sue intenzioni compositive: "L’essenziale dell’opera è creare una melodia parlata dietro alla quale appaia, come per miracolo, un essere umano colto in un momento della sua vita". La produzione dell’Oper Frankfurt ha affidato la realizzazione dello spettacolo a Tilman Knabe che con la collaborazione di Alfred Peter per le scene e di Birgitta Lohrer-Horres per i costumi ha sottratto la vicenda della figliastra alla dimensione propria del teatro d’opera proponendo una via originale mutuata dall’iconografia cinematografica e fotografica. Così, il palcoscenico apertosi nel primo atto su un totale che comprende la casa della vecchia Buryja, con accanto un muro con graffiti contemporanei e, sulla sinistra, una specie di gru di legno, a evocare la foresta che raccoglierà la fuga di Laca, si trasforma via via in tanti quadri più piccoli, significativamente racchiusi in un buco determinato dallo spazio ritagliato da quattro sipari neri (due orizzontali e due verticali) che delimitano la scena come in un fotogramma. Evidente la dimensione intima che ne scaturisce, capace di mettere il fuoco sul dramma della madre che, per conservare intatto l’onore della sua unica figlia, sacrifica il suo bambino condannando se stessa e il mondo a fare i conti con le strutture coercitive delle convenzioni borghesi. Una sintesi che è stata ben ripresa anche dalle interpretazioni nobili di un cast quasi tutto al giovanile e ben preparato. Ottimo il Laca espresso da un "giovinottone" Stuart Skelton che ha dato prova di voce ben timbrata dotata di un registro intermedio di eccezionale efficacia. Credibile e ben calata nel ruolo di Jenufa Ann-Marie Backlund, che soffre qualche spigolosità nelle note più acute ma che domina con buoni accenti e con intonazione sicura tutto il resto della tessitura. Benissimo hanno anche fatto il Mugnaio Franz Meyer, che ha scoperto un timbro di eccellente chiarezza, poggiato su un sostegno sempre sicuro che ne ha permesso una declamazione perfettamente impostata. Ottima anche la prova offerta da Nadine Secunde, che impone alla propria Sagrestana un’autorevolezza scolpita su suoni d’intonazione precisa emessi su un prezioso equilibrio di spessore/portamento. Meno convincenti sono apparsi lo Števa di Yves Saelens, un po’ sopra le righe sia in recitazione che nel canto, e la Vecchia Buryja, interpretata con una certa approssimazione, dovuta forse all’usura del mezzo, da June Card. Leggermente forzato il canto del basso Jaques Does, il Sindaco; buona la prova di Margit Neubauer, la Moglie del sindaco; Karolka, loro figlia e sposa di Števa, è interpretata in maniera incolore da Lisa Wedekind. È brava Barena, interpretata da Birgit Treschau; molto più che corretto è il giovane Jano di Anna Ryberg, encomiabile per espressione drammatica. Shao-Chia Lü ha diretto il Frankfurter Museumorchester ottenendo un eccesso di amalgama sonora, saltando qualche staccato che avrebbero reso più netto il fraseggio ritmato della partitura di Janacek, ma con un risultato complessivo più che positivo. Allo spettacolo impostato da Knabe va il plauso per avere sperimentato forme originali accompagnato dal dubbio se la rinuncia agli spazi ampi non abbia sacrificato alcuni aspetti dell’universalità dei temi proposti dal soggetto tratto da Jejĭ pastorkyňa (La sua figliastra) di Gabriela Preissová. |
|
Oper Frankfurt, Janacek: Jenufa by Michael Sinclair The only real gimmick in this production was the use of a lens like effect using the front curtain, opening and closing like the shutter of a camera lens. This allowed the action to be played out in a cinematic sort of way, either in wide screen format for Act 1 or zoomed in for the final two acts, with the claustrophobic feeling of the scenes in the Kostelnicka's house particularly effective.
Dramatically the success of the work depends on the crucial relationship between the four principal characters. Half-brothers Steva and Laca vie for Jenufa's attention, with the deep-rooted rivalry between the two adding a sense of danger to their relationships. Steva is strongly portrayed both physically and vocally by Yves Saelens, particularly as the drunken brute in Act 1. I would have liked a little more sexual chemistry to understand why Jenufa was attracted to Steva as opposed to his half-brother. Laca is more of the country bumpkin type, putting up with his more flamboyant half -brother with growing frustration. He is sensitively portrayed by Stuart Skelton using his warm, rich tenor voice to great effect, impressing particularly at the top of the range.
Despite a number of excellent individual performances, this Jenufa never really took flight. It seems odd to be criticising a traditional production that has been so meticulously prepared, but musically and dramatically it fell short of the harrowing experience that Janacek must have envisaged. Perhaps it was simply not gruesome enough. © 2005 Michael Sinclair |




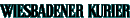



 Against this backdrop Janacek's score plays an important part in the drama. As is the current trend, the performance version used in Frankfurt is Janacek's original orchestration. I did, however, wonder if conductor Shao-Chia Lü might have hankered back to the later Kovarovic version with its lusher, more romantic approach. Lü seemed happier with the big emotional sweep of the score, rather than bringing out the brittle, angular rhythms and textural hues that actually bring the work to life. Lü drove his orchestra hard, with the balance between pit and stage sadly compromised on a number of occasions.
Against this backdrop Janacek's score plays an important part in the drama. As is the current trend, the performance version used in Frankfurt is Janacek's original orchestration. I did, however, wonder if conductor Shao-Chia Lü might have hankered back to the later Kovarovic version with its lusher, more romantic approach. Lü seemed happier with the big emotional sweep of the score, rather than bringing out the brittle, angular rhythms and textural hues that actually bring the work to life. Lü drove his orchestra hard, with the balance between pit and stage sadly compromised on a number of occasions.  Jenufa has been brought up by her guardian, the Kostelnicka. The score at the beginning of Act 2 clearly tells us that this is a warm, loving relationship, but it is tempered by Jenufa's relationship with Steva, and the Kostelnicka's insecurity as an outsider within the Buryja family. The Kostelnicka is a gift of a part and American soprano Nadine Secunde played it for all it was worth, looking a little like Bette Davis in one of her less savoury roles. She sang with great expression and colour, lacking only an icy menace in the upper register.
Jenufa has been brought up by her guardian, the Kostelnicka. The score at the beginning of Act 2 clearly tells us that this is a warm, loving relationship, but it is tempered by Jenufa's relationship with Steva, and the Kostelnicka's insecurity as an outsider within the Buryja family. The Kostelnicka is a gift of a part and American soprano Nadine Secunde played it for all it was worth, looking a little like Bette Davis in one of her less savoury roles. She sang with great expression and colour, lacking only an icy menace in the upper register.  Ann-Marie Backlund's Jenufa suffered most from the rampaging orchestra. She was practically inaudible during the first scene and also at other significant points of the opera. While she gave an affecting performance of a character that starts out rather naively, she struggled to portray the development of the character effectively, depriving us of the emotional core of the drama.
Ann-Marie Backlund's Jenufa suffered most from the rampaging orchestra. She was practically inaudible during the first scene and also at other significant points of the opera. While she gave an affecting performance of a character that starts out rather naively, she struggled to portray the development of the character effectively, depriving us of the emotional core of the drama.