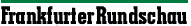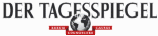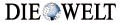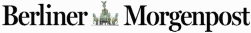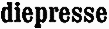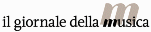|
Begierden kennen nicht Raum noch Zeit Der Saal erhebt sich, als Hans Werner Henze in der Loge erscheint. Dann wird es dunkel in der Staatsoper Unter den Linden. Stockdunkel, nicht einmal die Pulte der Instrumentalisten sind beleuchtet. Die scheinbar minutenlang währende Nacht wandelt sich zur Schwärze des ersten Klanges. Gedämpfte Posaunen und Klavier intonieren ein Es. Geheimnisvoll eingefärbt von Thai Gong, Riq und einem vom Band zugespielten Urgeräusch scheint es die Idee des "Rheingold"-Anfangs zu radikalisieren. Henzes neues Werk taucht auf aus einem synästhetisch aufgeladenen Grenzbereich zwischen Ton und Geräusch. Als im Sommer 2003 Henzes Oper "L'Upupa und der Triumph der Sohnesliebe" bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde, war allenthalben von einem Vermächtnis die Rede. Doch die typischen Merkmale eines Spätstils suchte man in der exotisch schillernden Morgenland-Oper vergebens. Auch aus seiner Konzertoper "Phädra" wird man schwerlich einen Ton der Resignation, eine Neigung zu unverbundenen Kontrasten oder zur Auflösung ausmachen können. Doch scheint in ihr der Tod allgegenwärtig. Henze und sein Librettist, der Lyriker Christian Lehnert, lassen die Geschichte von Phädra, der zweiten Ehefrau des Theseus, die aus unerwiderter Liebe zu ihrem Stiefsohn Hippolyt zur Furie wird, in jenem Labyrinth beginnen, in dem Theseus den Minotaurus besiegte. Aus den herumirrenden Echos schälen sich die Gestalten einer neuen Geschichte heraus: Hippolyt und Phädra, gefolgt von Artemis und Aphrodite, jenen Göttinnen, an deren langer Leine sie gehen. Empört darüber, dass der schöne Hippolyt nur der Jagdgöttin huldigt und die Liebe verschmäht, pflanzt Aphrodite Phädra jenes unheilvolle Begehren in den Leib, das den Dandy zwar nicht bekehren kann, ihm dafür aber einen grausamen Tod beschert. Zurückgewiesen hängt Phädra Hippolyt eine Vergewaltigung an. Theseus, der bei Henze nicht auftritt, ruft daraufhin Poseidon an, der den Minotaurus aus dem Meer auferstehen lässt. Hippolyts Pferde scheuen und schleifen ihn zu Tode. Phädra erhängt sich. Doch dabei wollte Henze es nicht belassen. So wird in einem zweiten Akt die römische Fortsetzung der griechischen Sage ausgesponnen, die im Heiligtum der Artemis/Diana am Nemi-See, unweit von Henzes eigenem Wohnsitz in Marino, spielt. Hippolyt wird frankensteinartig wieder zusammengesetzt, von Artemis (einer Countertenorpartie) in einem Käfig, schließlich in einer "feuchten Höhle" festgehalten und zu alledem auch weiterhin bedrängt von Phädra, die als hässlicher Vogel umherschwirrt, sowie von der als Opfer ihrer eigenen Triebhaftigkeit dargestellten Aphrodite. Der Held befreit sich und lebt fortan als Waldgott. Das Schlussbild gestaltet einen musikalisch zwischen Tod und Wiedergeburt changierenden, irisierend in sich kreisenden, gespenstisch statischen Tanz aller vier handelnden Personen, der angeführt wird vom Minotauros als der fünften, hier erstmals singenden Figur. Henzes Musik ist meisterhaft komponiert wie eh und je, wirkt ebenso anspielungs- und beziehungsreich wie farbig und von unmittelbarer dramatischer Kraft. Geschrieben für ein Ensemble mit mehrfach besetzten Bläsern, umfangreichem Schlagzeug, Klavier, Celesta, Harfe und Streichquartett, steckt sie voll berückender Effekte, belcantistischem Glanz, instrumentalem Raffinement und jongliert virtuos mit allen denkbaren Abstufungen der Stimmbehandlung, vom reinen Sprechen bis zur Koloratur. So souverän stehen diese Mittel heute wohl wirklich nur Henze zu Gebote. Stärker als in anderen Werken klingt nun jedoch auch jene Sphäre mit an, die zuvor mehr oder weniger explizit ausgesperrt erschien in Henzes ästhetischem Credo einer verzweifelten Schönheitssuche. Vernahm man aus den Schreckenspassagen der Mishima-Oper, ja selbst der Neunten Symphonie, noch auf irritierende Weise stets den Meister verheißungsvoller Oberflächen, so erscheinen Schmerz, Angst und Aggression in der "Phädra"-Oper plötzlich als präsentere, glaubhaftere Möglichkeiten - gerade dort, wo die Musik diese Ausdrucksbereiche nicht direkt "anfasst", sondern im Zweideutigen verbleibt, die Nähe eines Abgrunds markiert. Strukturell und atmosphärisch, von der Zweiteilung der Formanlage bis zur Parallelführung von Stimmen, scheint das ganze Werk vom Bewusstsein jener Grenze getragen, der Henze selber im Herbst 2005 biographisch nahe kam, als er mitten in der Komposition der "Phädra" steckte. Sein Lebensgefährte Fausto Moroni und ein Freund hätten "große Mühe gehabt, mich vor dem Abdriften zu bewahren", schreibt Henze in einem pünktlich zur Uraufführung bei Wagenbach erschienenen Arbeitstagebuch. Nach einer schweren gesundheitlichen Krise sei er dann Ende November "irgendwie ins Leben zurückgekehrt". Es war eine glänzende Idee des Regisseurs Peter Mussbach und des Raumkünstlers Olafur Eliasson, die dreiundzwanzig Instrumentalisten des Ensemble Modern unter dem großartigen Michael Boder auf einem Podest über den hintersten Reihen des Parketts zu plazieren. Von dort aus führte ein Steg durch die Mitte des Publikums zur Bühne, die von einer flexiblen, durchlässigen Spiegelwand beherrscht wurde. Wie in Jean Cocteaus "Orphée"-Film schien sie die Scheidewand zum Jenseits zu markieren, zugleich einen Blick hinter den Tod zu gestatten. Mussbachs Personenregie bediente sich einer drastischen, expressionistisch überzeichneten Gestensprache, ohne die das Sujet auf der Bühne wohl schnell ins Pathetische hätte kippen können. Die grotesken Züge der Henze-Musik traten auf diese Weise deutlich hervor. Zu den Tangorhythmen der Verführungsszene im zweiten Akt sah man eine Vergewaltigung. Die Wiedererweckung des Hippolyt zu Beginn dieses Aktes - musikalisch eine schrille Polyphonie aus Klingeltönen, Schreien, Klaviergehämmer, OP-Schellen und Sägegräuschen - zeigte den nackten Helden in einem prismatisch gebrochenen Spiegelraum. Mit John Mark Ainsley als tenoral strahlendem, dem jungen Henze nicht unähnlichem Hippolyt und Axel Köhler in der Rolle der überfürsorglichen Artemis hatte man sich zweier famoser, zudem henzeerfahrener Künstler versichert. Marlis Petersen stattete die Aphroditenmusik mit Lulu-Glamour aus und Maria Riccarda Wesseling, eingesprungen für die vor wenigen Wochen erkrankte Magdalena Kozena, gestaltete die Titelpartie glaubhaft und markant. Dem Minotauros verlieh Lauri Vasar imposante Bassbaritonfülle. Nach stehenden Ovationen grüßt Henze noch einmal herab von seiner Loge. Er sieht inzwischen aus wie sein eigenes Monument: die mächtige Statur, das irreal faltenarme, porzellanartige Gesicht, die hellen, wachen Augen. Die Andeutung eines feinen, leicht ironischen Lächelns umspielt seine beinahe unbewegliche Miene. Dann schalten die Techniker den Scheinwerfer aus. Die Erscheinung verschwindet. JULIA SPINOLA |
|
Auf Wiedersehen, Mythos Die Uraufführung von Hans Werner Henzes "Phaedra" an der Berliner Lindenoper mit Zweitbesetzung Maria Riccarda Wesseling ist stürmisch gefeiert worden. VON JÜRGEN OTTEN Schwierig, diese Mythen. Zugleich faszinierend: in ihrer Fremdheit und Vieldeutigkeit, in der schillernden Unantastbarkeit, die uns begehren lässt, sie zu entschlüsseln. Das gilt auch für den (griechischen) Mythos, der von Phaedra berichtet, jener Königin, die aus nicht erwiderter Liebe den Hass entdeckt, sowie von Hippolyt, ihrem Stiefsohn, der, weil er die Liebe ablehnt, dem Tod anheim fällt, heimtückisch. Die Ironie daran: Hätte Hippolyt (verboten) geliebt, das Drama wäre so gar nicht erst in Gang gesetzt worden: Der Mythos hätte seine Identität, ja seinen Sinn verloren. Aber ist da ein Sinn, wo nur noch Rache waltet? Weder Euripides noch Racine und sein Übersetzer Friedrich Schiller und auch nicht Sarah Kane vermochten dem tragischen Ende etwas Positives abzugewinnen. Sie alle beließen es bei der düsteren Dramatik, ließen das Fehlverhalten der handelnden Personen gleichsam ins Nichts laufen, in den Abgrund. Anders Christian Lehnert und Hans Werner Henze. Der Librettist und der Komponist fügen dem Drama ein ausladendes, halbstündiges lieto fine hinzu. Und berufen sich dabei auf einen Teil der "Metamorphosen" von Ovid, darin der tödlich verwundete Hippolyt von der Göttin Artemis auf der Insel Nemi wieder zum Leben zusammengeflickt wird. Am Donnerstagabend war das Ergebnis, die zweiaktige Konzertoper "Phaedra", in der Berliner Staatsoper Unter den Linden zu bestaunen (im wahrsten Sinn: das Enigmatische löst automatisch die Verwunderung aus), als Uraufführung eines Auftragswerks der Lindenoper, des Théàtre Royal de la Monnaie Bruxelles, der Alten Oper Frankfurt, der Wiener Festwochen und der Berliner Festspiele. Michael Boder dirigierte das Ensemble Modern, Staatsopernintendant Peter Mussbach musste einmal nicht über Sanierungskosten sinnieren (geschätzt sind, nach neuesten Berechnungen, inzwischen etwa 230 Millionen Euro), er durfte Regie führen. Das Bühnenbild gestaltete der isländische Künstler Olafur Eliasson. Wobei Bild stimmt, Bühne jedoch kaum noch. Ein Vexierbild aus Spiegeln hat Eliasson ersonnen, ein Universum aus Irritationen und Verfremdungen, das die Hierarchie des Raumes tatsächlich aufkündigt. Und uns, das Publikum, in eine neue Perspektive zum Werk selbst versetzt. Wir schauen auf einen riesig dimensionierten Spiegel, in dem das Orchester zu sehen ist, das wiederum in unserem Rücken sitzt. Bühne und Zuschauerraum sind gleichgestellt, womöglich sogar Gleichgesinnte. Fremde am selben Ort. Und wieder nicht. Vom Orchesterpodium führt ein Laufsteg hin zur eigentlichen Bühne: Laufweg für die Akteure, Ort für Begegnungen auf einem Grat. Erste Überraschung für all jene, die zuvor nicht das Getuschel der Spatzen vernommen hatten: Nicht Magdalena Kozená sang wie vorgesehen die Titelpartie, sondern Maria Riccarda Wesseling, die geplante Zweitbesetzung. Sie tat es bravourös, mit einem warm getönten Timbre, sicherer Höhe und einigem Glanz und Nuancenreichtum in der Stimme. Gleiches ist über die Darbietung von Marlis Petersen als Göttin Aphrodite zu sagen. Was angesichts der Positionierung der beiden Frauen mitunter dazu führte, dass man nicht in jeder Sekunde wusste, wer wo und was sang - eine mythische Konstellation. In die der Countertenor Axel Köhler als Artemis für Augenblicke eindrang; hysterisch die ohnehin unordentlichen Verhältnisse in Unordnung bringend. Hippolyt hingegen (profund: John Mark Ainsley) war eben jener von der Liebe unangetastete Nihilist. Fast so düster-dämonisch wie eine Dostojewski-Figur, sagen wir: Kirilow. Henzes Notentext liebt, wie das Libretto, diese Vermischung der Partikel. Sie ist Amalgam, Lebenswerkzitat, darin aber weit näher dem kammermusikalischen Reiz der "Elegie für junge Liebende" als beispielsweise dem gewaltig aufgeladenen Idiom der "Bassariden": Das Pathos ist dieser Partitur völlig abhanden gekommen. Das Klangbild setzt sich zusammen aus Splittern, aus abgesetzten, differierenden Motiven, aus Fragmenten und Fetzen. Kaum je entwickelt sich eine narrative Grundhaltung, immer wieder stoßen die Blechbläser in den ohnehin diffusen Klangraum hinein wie scharfe Messer, häufig genug zerstört das Schlagwerk (Rumi Ogawa, Rainer Römer) den Melos, der von den Holzbläsern, dem Klavier (Ueli Wiget) und der vierköpfigen Streichergruppe versucht (und gesucht) wird. Es scheint, als habe Henze, bewusst oder unbewusst, einer schlüssigen Dramaturgie entgegenwirken wollen; als habe er das Ausgemergelte, das Ausgedörrte in seiner Musik geradezu herbeigesehnt. Was ihm dabei unterläuft, ist - trotz (oder wegen) der sachkundigen, das Material in seiner Skelettiertheit gleichsam nackt darstellenden musikalischen Leitung durch Michael Boder - nicht unbeträchtlich: eine kunsthandwerkliche Attitüde, die einem Komponisten seines Könnens eigentlich nicht gut zu Gesicht steht. Von der Inszenierung ist, ausgenommen die Faszination der Imago-Spiegelwelt Eliasssons, kaum anderes zu berichten. Sie verweilt im Vagen, in Andeutungen, Anspielungen. Nur selten vermag es Mussbach, aus diesem Zwischenreich der ungezählten Möglichkeiten etwas Konkretes herauszuschälen, was den Mythos aus seiner entfernten Existenz uns näher bringen könnte. Handlungen und Haltungen der Protagonisten werden so zusehends und besonders im zweiten Teil immer pauschaler, leider auch banaler. Hippolyts vergewaltigende Explosion macht wirklich wenig Sinn. Eine antisinnliche Entladung wird hier demonstriert, die weder das mythische Sujet anbietet, noch die Musik, noch sonst irgendjemand. Seltsam genug. Aber was, obschon ästhetisch völlig veraltet, für Sekunden aus der Beklemmung reißt, ist die vom Band eingespielte Geräuschmusik im zweiten Teil, zumal just an der Stelle, als auf der Bühne nichts zu sehen ist als herumirrende Partikel im Weltraum. Was sie bedeuten? Schwierig zu sagen. Nächste Vorstellungen: www.staatsoper-berlin.de [ document info ] |
|
OPER Versinken im unverwandten Blick: Hans Werner Henzes Oper „Phaedra" als Uraufführung an der Berliner Staatsoper erzählt von der Unmöglichkeit der Liebe und der Schönheit des Todes. VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY Diese Oper hat das Ohr an der Unterwelt. Mystisch-mephistophelische Schattenwesen, badekappenbemützt und in Neoprenschläuchen steckend, huschen durch den Saal, Lichter kreisen, splittern, tänzeln, das Orchester thront ausnahmsweise hinten im Parkett, das Publikum darf sich in einem bühnenfüllenden Spiegel selbst betrachten, ein Spuk, das Ganze, ein knapp 90-minütiger Schnappschuss – und die Musik hält es bei aller Grazie, allem arkadischen Leuchten sicher gern mit Wolfgang Wagner (auch wenn sie nichts davon weiß). Der 88-Jährige nämlich, heißt es, folge derzeit ganz dem Überlebensmotto seines alten Hundes, das da lautet: radikal Energie sparen. Mit dem Überleben hat sich Hans Werner Henze, 81, seit jeher zu plagen gewusst. Seine Flucht aus der deutschen Adenauer-Kälte in die Milde des italischen Südens, das Ausgegrenztsein aus der Avantgarde der sechziger Jahre, das politische Engagement, seine Erfolge gerade in der ach so verderbten Kunstform Oper, schließlich die strahlende Rückkehr des verlorenen Sohnes in die Musentempel und Institutionen auch nördlich der Alpen, Ämter, Ehrungen, Preise – alles Zweifelslagen, ja Prüfsteine für ein westfälisches Gemüt wie das seine. Und immer öfter das gleiche Bild: Der alternde Komponist, eine zunehmend buddhaeske, sich mit dem eigenen Körper wie mit mythischen Stoffen („Venus und Adonis", „L'Upupa und Der Triumph der Sohnesliebe") gegen alle Wirklichkeiten panzernde Gestalt. Der alternde Komponist und wie er mit fürstlicher Grandezza ins Publikum grüßt – im Münchner Nationaltheater, im ehedem kleinen Salzburger Festspielhaus, in Luzern und nun eben auch in der Berliner Staatsoper bei „Phaedra", seiner 14. Oper – aus der Königsloge, versteht sich. Und restlos alle erheben sich. Auch diesmal. Das Stsück erforderte Geduld mit dem Tod Ein rührendes, ein Ehrfurcht gebietendes Bild. Der alte Mann und der Abschied. Der alte Mann und seine vielen letzten Male. Kein anderes Stück hat Henze dem eigenen Überleben so abgetrotzt, ja abgekämpft wie diese Konzertoper für fünf Sänger und 23 Instrumentalisten. Kein anderes Stück hat ihm solche „Geduld mit dem Tod" abverlangt (wie Henzes Librettist, der Lyriker und Pastor Christian Lehnert, die Liebesgöttin Aphrodite sagen lässt). Ein existenzieller physischer Zusammenbruch zwischen erstem und zweitem Akt („der Sarg war schon bestellt"), der Tod seines Lebensgefährten Fausto Moroni, kaum dass die Partitur vor fünf Monaten abgeschlossen war: Wie Kunst und Leben sich bisweilen durchdringen, das hat Henze hier in ganz anderer Weise erfahren müssen als bei früheren Krisenstücken (beispielsweise beim „Floß der Medusa"). Und der Verdacht des Eskapismus, der musikalischen Weltflüchtigkeit liegt naturgemäß näher denn je. Da ist zunächst der Stoff, der von nichts anderem handelt als von der Unmöglichkeit der Liebe und der Schönheit des Todes. Vergleichsweise frei nach Euripides und Ovid (ein bisschen auch nach Racine, Schiller und Sarah Kane) erzählen Lehnert und Henze die Geschichte der kretischen Königin Phaedra, Gattin des Minotaurus-Bezwingers Theseus, die sich in ihren Stiefsohn Hippolyt verliebt und dessen Verweigerung mit einer Intrige straft, woraufhin ein theatralisch den Meereswogen entsteigender Stier ihn zu Tode schleift. Phaedra selbst erhängt sich, und Hippolyt wird von der Jagdgöttin Artemis nach Italien verbracht, an den Nemi See (unweit des Henzeschen Anwesens südlich von Rom!), wo sie ihm neues Leben einhaucht. Göttliche Hybris als letzter heidnischer Trost? Den Stoff fand Henze also gewissermaßen vor der eigenen Haustür, und die auratische Dichte und Leichtigkeit seiner latinischen Lebenslandschaft sind es auch, ihre Farbenpracht, ihr Duft, ihre Melancholie, die einem hier musikalisch entgegenwehen. Ein Stück klingende Autobiografie, das Dokument eines programmatischen Versinkens im unverwandten Blick. Handwerklich bedeutet dies: ein Saxophon für Hippolyt (konzentriert: John Mark Ainsley), ein Horn für Phaedra (expressiv: Maria Riccarda Wesseling), ein Englischhorn für Artemis (Axel Köhler) und eine Posaune für Aphrodite (hervorragend: Marlis Petersen) – nur vier der 23 Musiker des vorzüglich kenntnisreich spielenden Ensemble Modern unter Leitung von Michael Boder sind Streicher, der Rest verlangt doppelte Bläser, außerdem Harfe, Celesta und Klavier sowie ein reiches, teils exotisches Schlagwerk nebst elektronischem Zuspielband. Fabelhaft glitzernd instrumentiert, das Ganze, nahezu schwerelos. Henze, der genuine Musikdramatiker Und eine Besetzung, die Bände spricht. Wie Luftgeister schmiegen sich die Instrumente den diversen Sängerkonstellationen an, allzeit bereit, den Atem ausgehen zu lassen über Phaedras Begierde, Theseus’ hysterischem Entsetzen oder Hippolyts Klage. Röhrenglocken läuten dröhnend seinen Tod ein, und nicht nur bei solch klassisch-apokalyptischem Aufruhr bleibt Henze, der genuine Musikdramatiker, sich treu und aus Überzeugung einem sanft zwölftönigen Wohllaut verpflichtet. Hübsch xanthippisch hingegen Phaedras Häme angesichts des geretteten Hippolyts; und die finale Apotheose des Tanzes („Wir dringen zur Sterblichkeit vor") ist von einer magisch-silbrigen Schwärze erfüllt. Bei allen Déjà-entendus des Abends, allen Allusionen an Richard Strauss, Strawinsky, Bach, Messiaen, ja – dank zweier Wagner-Tuben – sogar an Richard Wagner: Diese Partitur bietet eine klare Essenz. Und hat, um mit dem Bühnenbildner Olafur Eliasson zu sprechen, ihren „Fluchtpunkt" gefunden. Ausgerechnet von Henze eine Neujustierung der Oper zu erwarten, wäre auch absurd gewesen. Eliasson und Regisseur Peter Mussbach indes tragen sich durchaus mit solchen Absichten – und scheitern kläglich. Gewiss, der Raum, jene zeitweise Verkehrung von Bühne und Saal im Spiegelbild, der Auszug des Orchesters aus dem Graben, der dunkle Steg, der das Parkett teilt und den Sängern als Catwalk dient, Eliassons irisierende Lichteffekte, das Kaleidoskop etwa, das Hippolyts Käfig darstellt – dies alles ist von einer bestechend professionellen, technisch vielleicht sogar visionären Machart. Nur mit dem Stück und seiner Musik hat es partout nichts zu tun. Und daran kann oder will auch Mussbach nichts ändern, der den Protagonisten ein hochprätenziöses, blöde antikisierendes Gestenrepertoire andichtet und sie ansonsten hin und her flitzen lässt. Wer den Tod nicht fühlt, der wird ihn so schnell auch nicht erjagen. Wieder am 8./9./10.9. – Im Wagenbach Verlag ist Henzes Arbeitstagebuch zu „Phaedra" erschienen (96 Seiten, 13,90 €). |
|
Die Antike vor der Haustür Von Manuel Brug Wir sind Henze! Es hatte durchaus etwas Päpstlich-Huldvolles, wie der 81-jährige Hans Werner Henze, den kantigkahlen Schädel in helles Scheinwerferlicht getaucht, in der Mittelloge der Berliner Staatsoper Unter den Linden Einzug hielt. Ein mit vielen renommierten deutschen Komponisten durchsetztes Publikum zollte stehend dem - neben Karlheinz Stockhausen - Doyen der hiesigen Tonsetzer seine Ehrerbietung. Was dann folgte, hatte nichts staatstragend Zeremoniöses, das war einfach große, gute, zeitgenössische Opernkunst. Henze wurde, das ist längst kein Geheimnis mehr, im Herbst 2005 schon totgesagt, die Nachrufe lagen schon bereit. Und obwohl er sein 2003 in Salzburg uraufgeführtes selbstgedichtetes persisches Märchenspiel vom Wiedehopf zu seiner letzten Oper erklärt hatte, ist er nun mit einem weiteren, von Partnern in Brüssel, Frankfurt und Wien koproduzierten Bühnenwerk wiedererstanden. Und wie! Wo "L'Upupa" altmeisterlich sanft noch einmal alle Instrumentierungsregister zog, aber auch ein wenig harmlos ihre Parabelschwingen ausbreitete, da führt die herb-strenge Konzertoper "Phaedra" einen erstarkten, kampfeslustig blitzenden Henze vor. Keinen resignierten Komponistengreis, sondern jemanden, der durchaus noch etwas zu sagen hat und das auch tut. Und der ausgerechnet in der vom deutschen Kulturbetrieb ausgerufenen Romantik-Woche mit einem mythologisch-klassizistischen, schon oft dramatisch wie auch musiktheatralisch gedreht wie gewendeten Stoff an den Start tritt. Wie schon 1951 im Ballett "Labyrinth", erzählt die "Phaedra" zunächst vom Minotauros. In der Posaune wispernde, im Klavier klagende, in der Harfe raunende Echos von dessen (Vor)Geschichte formen sich zur neuen Fabel von der Theseus-Gattin Phaedra, die sich in ihren Stiefsohn Hippolyt verlieben muss - weil dieser einzig die Göttin Artemis umschwärmt; was Aphrodite nicht zulassen will. Das Göttinnen-Menschen-Quartett mäandert sich durch den weiteren Verlauf des von dem sächsischen Pfarrer Christian Lehnert auf den Quellen von Euripides, Seneca und Racine mit Sinn für musikalische Poesie zu einer so präzisen wie hochfahrenden Prosa neugefassten Librettos. Der gar nicht netten, bisweilen megärenhaften Phaedra und dem "Hippie - so ein Jüngelchen" Hippolyt (Henze in seinem diesmal schmalen Arbeitsbuch bei Wagenbach) sind jeweils die Göttinnen auch musikalisch zugeordnet, Zweistrukturen ziehen sich durch die klangliche Faktur. In vierzig Minuten wird bündig und zum Teil als Mauerschau der Mythos erzählt, der zum schuldhaft verknüpften Tod der beiden Menschen führt. Zu sehen ist der freilich kaum. "Konzertoper", Zustand, nicht Handlung, das haben Peter Mussbach und sein Ausstatter Olafur Eliasson, einer der weltweit gefeierten Licht-Künstler, ernst genommen. Bei ihnen werden Bühne wie Auditorium der Lindenoper zum Resonanzraum, mit nur wenig angedeutet Bildhaftem. Mitten durch die Zuschauer läuft ein Steg. Er beginnt unter der Loge, wo die formidablen 23 Spieler des Ensemble Modern und der sie präzise anleitende Michael Boder platziert sind, und mündet in einer weiteren Spielfläche vor und auf der Bühne. Die ist zunächst verschlossen. Ein Lichtbogen wölbt sich kreiselnd durch den Saal, gebiert Planeten. Später sehen wir uns selbst im Spiegel, der durchlässig werden kann. Durch ihn tritt (wie schon bei Cocteau) Hippolyt in die Unterwelt - einen weißen Raum, in den eine komplex verspiegelte Kugel ihre Reflexsplitter wirft. Musik und Andeutung von Handlung fließen so durch den Raum, das Geschehen wird nie wirklich dingfest. Auch weil Peter Mussbach seine vier großartigen Sänger bewegt, aber nichts wirklich durch sie erzählt. Bernd Skodzig hat sie in stilisiert schwarze Konzertkleidung aus Neopren gepackt - gehrockartig für den markanten, auch tenoral weichen Hippolyt John Mark Ainsley, reiterhosenähnlich für die sich als Countertenor mit Baritonfunktion aufplusternde Artemis Axel Köhlers, schlauchförmig für die jungmädchenhaft höhenstrahlende Aphrodite Marlis Petersen - und für die überragend textdeutliche, voluminös, aber auch zart singende Maria Riccarda Wesseling. Die war eigentlich nur Zweitbesetzung, macht aber die kranke Magdalena Kozená vergessen. Dieser erste, von Henze vor seiner Krankheit fertiggestellte Teil klingt eindrucksvoll geschlossen. Aus dem anfänglichen Dunkel ballen sich bedrohlich Klangkaskaden, schlagwerk- und blechdominiert. Es ist nur ein einfaches Streicherquartett im Einsatz. Das Klavier klingt immer wieder hell auf. Leichtfüßig, doch vehement wird Handlung absolviert, wird gestritten und gelitten, eine düstere Zwölfton-Offenbachiade. Solches wird nach der Pause deutlicher. Auf Ovids Spuren geht es jetzt zum Nemisee bei Rom. Hier, quasi vor Henzes Haustür, hat die Antike lange vor den Römern in den Albaner Bergen und den Castelli Romani ihre Spuren hinterlassen. Und die werden jetzt der sich auflichtenden, weniger dicht gewebten, die zum Vogelwesen mutierte Phaedra sogar als eine Art Barsängerin präsentierenden Partitur untergemischt. Artemis hat Hippolyt zusammenflicken lassen - hier geschieht das in einem spiegelglänzenden Trichter - und versteckt ihn jetzt in ihrem Heiligtum. Auf dem Klavier liegend, lässt ihn Mussbach doch noch die Stiefmutter nehmen, bevor er zum Herrn der Wälder wird. Gewitter bricht elektronisch herein, so wie vorher schon Zikadengezirp. Die Götter streiten weiter, bis sie vom schließlich wieder erscheinenden Minotauros (Lauri Vasar) in einem gläsernen Quintett erstarren. Diese bannend neugedeutete "Phaedra", so "kretisch, maritim, urzeitig" (Henze) lässt sich bestimmt erhellender visualisieren. Trotzdem: Die Berliner Opernsaison hat mit diesem tollen Spät-, nicht Alterswerk auf höchstem Niveau begonnen. |
|
Erschlagen von der Wucht der Bilder Von Klaus Geitel Musikkritiker der Berliner MorgenpostDie Staatsoper - ein großer Bahnhof. Auf Zeit verwandelt in eine Triumphpforte für den alten, gebrechlichen Hans Werner Henze bei seinem Einzug in die Staatsloge, der Uraufführung seiner "Phaedra" beizuwohnen, seiner "Konzertoper in zwei Akten". Das Publikum erhob sich bei seinem Anblick spontan, anhaltend und herzlichst applaudierend, zu einer Standing Ovation. Henze hat sie verdient. Der Jubel verstand sich wohl auch als späte Wiedergutmachung der Tumulte aus alten Zeiten, auf die Berlin seinerzeit offenbar abonniert war. Der erste Akt mit seinen 45 Minuten fegt mit ungebrochener, schier überwältigender kompositorischer Kraft daher. Das Frankfurter "Ensemble modern", das unter Michael Boders imponierender Leitung im Rücken des Publikums in den hinteren Reihen des Parketts postiert ist und sich vorzüglich aus Bläsern und Schlagzeugern rekrutiert, ergeht sich in feurigen Instrumentalattacken von ungebrochener Ausdruckskraft. Die Tragödie der Liebe, Liebesklage, Liebesrache, Liebeshass fetzen sich musikalisch geradezu hin. Ein Laufsteg ist durch das Parkett geschlagen. Auf ihm schreiten, wanken, kriechen singend die Sänger zur Bühne hinüber, die ein haushoher Spiegel verstellt. Einzig in ihm zeigt sich das Orchester und ein Dirigent - gleichzeitig mit der Pracht des Staatsopernsaals. Ein Bild für die Götter. Olafur Eliasson hat den Raum für die Aufführung überaus wirkmächtig gestaltet, wenn auch in steigendem Maß auf Kosten der Musik. Das Bild drängt den Klang selbstherrlich ins Abseits. Gegenüber dem szenisch höchst originellen, diesem noch nie dagewesenen, nie gesehenen Aufwand spielt die Musik unversehens die zweite Geige. Man muss sich schon, wenn auch ungern, überwinden, die Augen zu schließen, um Henze zu hören, seine unerhörte Kunst der Instrumentation, die seine Musik derart dramatisch packend macht. Henze, der unerschöpfliche Musikdramatiker ganz und gar eigener Schule, zeigt noch einmal die spitzen Krallen, mit denen er sich ins tragische Geschehen zu schlagen versteht. Leider wird dieses Geschehen um die unselige Phaedra nicht recht anschaulich. Schuld daran ist vor allem der Verzicht auf die Textprojektion, um nicht von den Abenteuern der immensen Installationen Eliassons abzulenken. So aber wächst allmählich Konfusion herauf. Im Grunde ist keines der gesungenen Worte des Librettisten Christian Lehnert auch nur halbwegs zu verstehen. Bernd Skodzig hat überdies die männlichen Protagonisten in feinste dunkle, frackähnliche Abendgarderobe gesteckt. Der fabelhafte John Mark Ainsley als Hippolyt, der Tenor als Liebesopfer, sieht geradezu aus wie der junge Henze persönlich. Maria Riccarda Wesseling wühlt sich, von Liebe besessen und von ihr vernichtet, mit aller, durchaus erstaunlicher Kraft durch die Titelpartie. Marlis Petersen gibt ihren göttlichen Beistand, der freilich wenig bewirkt, der jubelstimmigen Aphrodite, während Axel Köhler, der stimmmächtige Countertenor, im durchaus männlichen Frack in die Rolle der Artemis kriechen muss. Lauri Vasar singt, wie aus dem Modejournal geschnitten, tiefstimmig einen Laufsteg-Minotaurus. Henze rang anhaltend mit dem Tod, als er den ersten Akt seiner Oper beendet hatte. Der zweite, nach der Genesung niedergeschrieben, besitzt nicht mehr den künstlerischen Schub des Beginns. Er wirkt etwas erschöpft und ausgebrannt, obwohl sich am Ende so etwas wie ein klingendes Satyrspiel in die Tragödie einschmuggelt. "Alles ist Spaß auf Erden", hat schon der alte Verdi gewusst. Vielleicht ist auch Henze diese Erkenntnis gegen Ende seiner Operntage gekommen. Peter Mussbach hat das Geschehen in Szene gesetzt. Aber gegen die Wucht der Eliasson-Bilder kommt auch er nicht an. Sie säen ihre Überraschungen bis zum Schluss. Doch die Saat geht nicht auf. Es verbietet sich nun einmal, in der Oper der Musik den Hals abzuschneiden, unter dem lausig opulenten Vorwand, ihr Freund und Helfer zu sein. |
|
Konkurrenz der Göttinnen Peter Uehling Hans Werner Henze war während der Komposition seiner jüngsten Oper "Phaedra" dem Tode nah. Nachdem er schon beim Abschluss seiner vorletzten Oper "L'upupa oder Der Triumph der Sohnesliebe" gesagt hatte, er denke, es lange nun, kann jedes Werk das letzte sein. In Interviews scheint der sonst so eloquente Mann wie verstummt und abwesend. Schwer beladen mit Abschiedsgefühlen ging man der Uraufführung der "Phaedra" am Donnerstag in der Staatsoper Unter den Linden entgegen. Einige Wochen zuvor konnte man sich bereits einstimmen mit einem kleinen, bei Wagenbach erschienenen Büchlein, dessen Werkstattberichte von Henze selbst und seinem Librettisten Christian Lehnert allerdings eher zur Anekdote tendieren als dass sie Einsicht in Gedankengänge und Machart erlaubten. Die Phaedra der dramatischen Fassungen von Euripides oder Racine bildet nur den ersten Teil ("Am Morgen") dieser Oper. In ihm liebt Phaedra Hippolyt, den Sohn ihres Gatten Theseus und seiner ersten Frau. Hippolyt aber interessiert nur die Jagd, nicht die Stiefmutter. Darüber ist Phaedra so erbost, dass sie Hippolyt bei Theseus anschwärzt, er hätte sie vergewaltigt. Theseus verflucht seinen Sohn und lässt ihn von Poseidon und seinen Meeresgewalten zerreißen. Henze und Lehnert gestalten diesen Teil in Anlehnung an das Prinzip der Götterwette: Phaedra und Hippolyt sind Spielfiguren der Göttinnen der Liebe, Aphrodite, und der Jagd, Artemis. Im zweiten Teil ("Am Abend"), auf römischen, von Vergil und Ovid aufgenommenen Sagen fußend, setzt Artemis den zerrissenen Hippolyt wieder zusammen. Und noch immer geht die Konkurrenz der Göttinnen weiter: Aphrodite und Phaedra, die sich nach dem Verrat selbst getötet hat, fordern von Artemis, den geflickten Hippolyt an die Unterwelt auszuliefern. Es gibt ein Duett zwischen Hippolyt und Phaedra, an dessen Ende sie verschwindet und aus dem Hippolyt als Gott des Waldes hervorgeht. Eine seltsame Handlung, und manches an ihr mag biografisch in Henzes Lebensumständen begründet sein: die Sehnsucht des kranken Mannes nach Auferstehung in einem neuen Körper, das bemerkenswerte Detail, dass der Sage nach das Geschehen des zweiten Teils in unmittelbarer Nähe von Henzes italienischem Anwesen am Nemi-See angesiedelt ist. Für den Zuschauer und Zuhörer zunächst interessanter aber ist, dass der im Wort nahezu verstummte Henze eine Musik geschrieben hat, deren Beredsamkeit gerade in ihrer Ökonomie liegt. Waren Henzes Partituren sonst überfüllt von melodischem Überschwang, mehrfach geschichteter Polyphonie und illustrativen Details, so überrascht die "Phaedra" durch gehärtete Klänge, transparente, oft zweistimmige Führung der Instrumente und verdichtete Zeichenhaftigkeit. Wie befreit klingt diese Musik, befreit von gar zu traditionellen Vorstellungen des Schönen und Theatralischen. Schlug die Opulenz früherer Werke oft in Vagheit in Form und Ausdruck um, so erscheint die "Phaedra" außerordentlich präzis gearbeitet. Wenn der Beginn des Prologs an Theseus' Kampf gegen den Minotaurus erinnern soll, so genügen Henze einige enge Schritte des tiefen Blechs, um das Monstrum und die Finsternis des Labyrinths zu charakterisieren, weiterer Ausmalung bedarf die Musik nicht, sie bricht ab, bevor sie sich verlieren würde. Was nicht heißt, dass sie sich nicht verlieren könnte: Kurz vor Schluss, in dem erwähnten Duett, breitet sie sich herrlich aus, um dann mit einem raschen Tanz voller tonaler Irrlichter zu enden. Das Stück ist ohnehin nicht lang, keine zwei Stunden, Henze hat den Zeitverlauf aber überdies so sicher in der Hand, dass es nie langweilig wird. Dazu handhabt er das kleine Ensemble aus vier Streichern, Schlagzeug und einer Übermacht an Bläsern mit ungeheurer Souveränität. Die Streicher haben immer Raum um sich, klingen nie forciert, die Bläser sind mit einer geradezu Mozartschen Delikatesse gehandhabt - auch die Wagner-Tuben und Saxophone. "Phaedra" nennt sich eine "Konzertoper", ein Begriff, hinter dem man ein dramaturgisches Experiment vermuten würde, der sich aber letzten Endes nicht recht erschließt, es sei denn, man verstünde darunter schon die in Klangzeichen aufgelöste Narration des Stücks. Es gehörte von vornherein zum Plan, dass das Ensemble modern, von Michael Boder fabelhaft ruhig und dennoch ausdrucksvoll und farbintensiv geführt, auf der Bühne sitzt. In der Staatsoper haben Peter Mussbach und sein Bühnenbildner, der Raum- und Lichtkünstler Olafur Eliasson, das anders gelöst, indem sie das Ensemble hinten im Parkett, direkt unterhalb des Ranges platzierten, von dort einen Laufsteg zur Bühne bauten. Statt eines Raumes aber ist hinter dem Vorhang meist ein riesiger Spiegel. Durch eine kleine Tür können die Personen hinter den Spiegel treten. Im zweiten Akt wird hinter dem Spiegel ein wiederum verspiegeltes Kabinett sichtbar, in dem Hippolyt als vervielfältigter Klon wieder zusammengebaut wird. An optischer Pracht, an überraschenden Effekten mangelt es der Aufführung nicht, und ihr abstrahierender Zugriff mag mit den abstrahierenden Tendenzen des Stücks nicht ungünstig zusammenstimmen. Dass die Rätselhaftigkeit damit forciert erscheint, das Schlussbild etwa mit den im Licht kreisenden weißen Splittern zugleich die Sänger ungünstig verdeckt und aus der Wahrnehmung löscht, gehört zu den unangenehmen Nebenwirkungen der gleichwohl überaus bemerkenswerten Produktion. Magdalena Kozena, die mit dem Ensemble modern zu den ersten Fixpunkten der entstehenden Oper gehörte, hat ihre Mitwirkung abgesagt. Maria Ricarda Wesseling sang an ihrer Stelle die Phaedra, und sie sang sie sehr gut. Wie auch ihre Kollegen Marlis Petersen als Aphrodite, John Mark Ainsley als Hippolyt und Axel Köhler als Artemis insgesamt sehr gut sangen, lediglich die Ausflüge des Altus Köhler in die Bariton-Lage klangen etwas fahl. Henze wurde schon vor dem Stück beim Betreten seiner Loge gefeiert. Am Ende waren die Reihen ein wenig gelichtet, der Applaus eines stehenden Publikums dennoch herzlich. Die Opernbühnen sind mit der "Phaedra" um ein gut handhabbares und zugleich vielfältige Entdeckungen heischendes Stück reicher. |
|
Eine Fachfrau für das Leiden Von Esteban Engel Hans Werner Henze, der „Fachmann für Angst und Leiden", wie er sich einmal nannte, blickte auf sein Werk: Als sich der Komponist nach der Uraufführung in der Berliner Staatsoper erhob, brandete Applaus im Saal auf. Gerührt nahm Henze den Beifall für sich und seine Oper „Phaedra" entgegen, an der er in den vergangenen, von Krankheit und Todesnähe gezeichneten Jahren gearbeitet hatte. Der 81-Jährige hatte sich eigens aus Marino bei Rom auf den Weg nach Berlin gemacht. Hier hat Henze schon große Triumphe gefeiert. Und auch die Uraufführung seiner 14. Oper wurde nun wieder ein bewegender Abend, obwohl Peter Mussbachs Inszenierung sich von der Wucht der Musik kaum anstecken ließ. Henze, „der Westfale, der in die Welt zog", hat sich immer wieder mit Mythen beschäftigt, von Che Guevara und dem Kommunismus bis zu „Venus" und „Phaedra". In seiner „Konzertoper" für fünf Sänger geht es um Liebe, Eifersucht und Rache. Phaedra, die Frau des Theseus, hat sich in ihren Stiefsohn Hippolyt verliebt. Doch dieser hat nur Augen für die Jagdgöttin Artemis. Gekränkt behauptet Phaedra gegenüber Theseus, der junge Mann habe sie vergewaltigt. Der erzürnte Gatte lässt Hyppolyt vom Meeresgott Poseidon töten. Phaedra erhängt sich. Henze, der ursprünglich das Libretto selber verfassen wollte, engagierte den Lyriker Christian Lehnert, der sich im ersten Teil an die altgriechische Tragödie des Euripides anlehnt. Im zweiten Teil greift Lehnert auf Ovids „Metamorphosen" zurück: Der zu Tode verwundete Hippolyt wird von der Göttin Artemis auf der Insel Nemi wieder zusammengesetzt, um unter dem Namen Virbius ein neues Dasein zu erleben. Es ist wohl diese Verbindung von klassischem Stoff und realer Existenz, die Henze zu dem Werk geführt haben: Phaedra und Hippolyt sind sozusagen Nachbarn des Komponisten in den Albaner Bergen, wo viele „heroische Frauengestalten" lebten, wie Henze schreibt. Auf der Bühne jedoch ist wenig Leidenschaftlichkeit zu erblicken. Mussbach und der dänisch-isländische Lichtkünstler Olafur Eliasson haben eine höchst artifizielle Welt geschaffen – von arkadischen Landschaften keine Spur. Ein Laufsteg durchkreuzt den gesamten Opernsaal, die 25 Musiker des Ensemble Modern aus Frankfurt (Leitung: Michael Boder) sitzen im Rücken des Publikums. Auf der Brücke zur Bühne liefern sich die in Gummianzügen gepressten Sänger ihre Wort- und Gesangsgefechte. Eliasson, einer der bekanntesten bildenden Künstler der Gegenwart, hat noch nie zuvor für die Oper gearbeitet. Der Durchbruch gelang ihm in der Londoner Tate Modern, wo zwei Millionen Besucher seine Experimente mit Licht, Wasser und Spiegeln gesehen haben. Über alle Zweifel erhaben sind dafür die Sänger. Maria Riccarda Wesseling glänzt als Phaedra mit dramatischem Ausdruck und präziser Aussprache genauso wie Countertenor Axel Köhler als Artemis. Ein Gastspiel in der Alten Oper Frankfurt ist für den 10. Juni 2008 geplant. |
|
Jungbrunnen Kraftvoll, sensibel und sinnlich ist diese Musik. Man merkt es ihr kaum an, dass sie in einer der schwierigsten Lebensphasen des Komponisten entstand. Henze selbst war lange schwerkrank, dann starb der Lebensgefährte. In seinem die Arbeit begleitenden Tagebuch notiert Henze lange Phasen der Lustlosigkeit, sich überhaupt übers Notenpapier zu beugen. Aber man merkt auch, das Sujet sollte eine Art Jungbrunnen für ihn sein: diese Geschichte von Hippolyt, der von seiner Stiefmutter Phaedra bedrängt, der Vergewaltigung beschuldigt, von rivalisierenden Göttern erst im Meer versenkt und dann an einem neuen Ort wieder zum Leben erweckt wird. Dieser Ort liegt nahe von Henzes italienischem Landsitz am Nemi-See. "Konzertoper" nennt der 81-jährige Hans Werner Henze sein jüngstes Werk. Das Libretto, im Wesentlichen Racine und Ovid folgend, wollte er sich ursprünglich selber einrichten, hat die Arbeit dann aber dem Dresdner Lyriker Christian Lehnert überlassen. Entstanden ist ein überraschend starkes 90-minütiges Stück für fünf Solisten und Kammerensemble mit einem sehr spezifischen, stark bläsergefärbten, gelegentlich auch an Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos" erinnernden silbrigen Klang. Die Assoziation liegt nahe. Phaedra ist die zweite Gattin von Theseus, dem Minotauros-Bezwinger. Am Ende taucht der Minotauros auch selber auf und tanzt durch die Wälder, oder hier über einen Tisch. Der Regisseur Peter Mussbach nimmt den Untertitel "Konzertoper" so wörtlich wie möglich. Er minimalisiert die Vorgänge, bemüht die Gestensprache von Stummfilm und Expressionismus. Etwas befremdlich, wie er die beiden Frauenfiguren führt, Phaedra und die ebenfalls um Hippolyt buhlende Göttin Aphrodite: lüstern, hysterisch; vielleicht sollte der gelernte Psychiater Mussbach einmal sein Frauenbild auf die Couch legen. Erzählt wird die Geschichte vom gejagten Jäger Hippolyt vor allem mittels des von Olafur Eliasson gestalteten Raums. Der dänische Künstler, Opernnovize, teilt das Parkett der Berliner Staatsoper in der Mitte mit einem Steg. Das Orchester sitzt hinter dem Publikum im rückwärtigen Bereich. Die Zuschauerreihen sind nach vorn gezogen bis über den Orchestergraben. Der erste, in der Götterwelt spielende Teil ist hauptsächlich auf dem Steg angesiedelt. Den zweiten, in der Menschenwelt verorteten Akt verlegt Eliasson mehr auf die Bühne. Mit einer raffiniert sowohl reflektierenden wie transparent zu machenden Spiegelwand im Bühnenportal, mit Prismen und splitternden Lichteffekten will Eliasson eine gesplittete Wahrnehmung von optischen und akustischen Eindrücken erreichen. Der Zuschauer ist gefordert, muss sich in seinem Sitz mit bewegen, sieht sich gelegentlich auch auf der Spiegelwand reflektiert. Die Überlegungen von Eliasson dahinter, Oper nicht als illusionistisch-träumerische Reise von der Welt weg, sondern als mikroskopische Annäherung an diese Welt zu begreifen, sind vielleicht etwas naiv. Die Durchhörbarkeit von Text und Musik förderte dieses Raumkonzept aber entschieden. Unverständlich, dass man mit einer ausgedehnten, überflüssigen Pause sich teilweise der Gesamtwirkung des Abends begab. In einer Loge nahm Henze kindlich strahlend auch den starken Schlussapplaus entgegen – eine göttliche Szene für sich. Das Publikum feierte aber auch das ganze Ensemble, die Musiker des Ensemble Modern mit Michael Boder am Pult und das homogene Solisten-Quintett, voran John Mark Ainsley als Hippolyt. Die Aufführung, eine Koproduktion mit dem Musikfest Berlin, reist noch weiter nach Brüssel, Frankfurt und Wien – ein in vieler Hinsicht erstaunlicher Abend. GEORG-FRIEDRICH KÜHN |
|
Wenn wir uns drüben wiederfinden... Die Regie von Intendant Peter Mussbach stellt sich dabei produktiv in den Dienst der Neuheit Von Joachim Lange Als Hans Werner Henze die Mittelloge betrat und das Publikum dem alten Herrn schon mal vorab applaudierte, hatte das seine Richtigkeit. Beweisen muss Henze schon lange nichts mehr. Umso besser, wenn er es dennoch tut, wenn er nun seiner elegischen Märchenoper L’Upupa eine kraftvoll irisierende "Konzertoper" nachfolgen lässt. bezahlte EinschaltungFür den 81-jährigen Henze ist weder eine ambitionierte Verneinung der schon existierenden Musik der Bezugspunkt, noch betrachtet er sie als eine Art Selbstbedienungsladen. Er schöpft vor allem aus sich selbst und seiner künstlerischen Weltsicht und der Aura seiner Wahlheimat Italien. Die von Michael Boder mit Präzision geleiteten 23 Musiker (Ensemble Modern), mit Solostreichern und einem Schwergewicht auf Bläsern und Schlagwerk, produzieren im Rücken des Publikums ein Klanguniversum von spröder Schönheit und Kraft. Mit fünf herausfordernden Partien wird nach dem Libretto von Christian Lehnert eigenwillig die Geschichte des Jünglings Hippolyt erzählt. Er verweigert sich dem Begehren seiner Stiefmutter Phaedra, wird von ihr der Vergewaltigung bezichtigt und vom Ehemann Theseus zu Tode geschleift. Alles an den Fäden der Götter, die auch nur ihr Süppchen kochen. Ob nun Artemis, der Hippolyt verpflichtet ist, oder Aphrodite, die hier nicht nur Phaedra ins Rennen schickt, sondern eigene Ambitionen lasziv auslebt: bei Henze findet das alles, im zweiten Teil, eine Fortsetzung in einer anderen Welt und mit einer anderen Identität. Hippolyt wird als Virbius wieder zusammengesetzt, kennt sich aber selbst nicht mehr und ist wie Homunculus im Käfig gefangen, stürzt sich jetzt wie wild sogar auf die verwandelte Phaedra. Am Ende bleibt eine rätselhafte Verwandlung in einen anderen Zustand. Vielleicht ist es ja die fröhliche Hoffnung auf ein befreites Jenseits. Nicht ohne ein großes Beben von ebenso jenseitiger, auch augenzwinkernder Schönheit. Regie als Chefsache Die Oper erzählt diese Geschichte und berührt damit zugleich. Freilich ohne dabei jedes ihrer eingeflochtenen Geheimnisse mit leichter Hand zu lüften oder den persönlichen Subtext allzu bereitwillig preiszugeben. Da bleibt viel Raum, sich auf die Spiegelungen einzulassen. Dass eine Henze-Uraufführung für den Intendanten-Regisseur Peter Mussbach Chefsache ist, war klar. Dass diese Produktion so überzeugend gelingt, ist nicht nur ein Glücksfall, sondern auch ein Statement. Hier wird auch der Zuschauerraum zur Bühne. Die Protagonisten singen und agieren, mal hinten beim Orchester, dann auf dem Laufsteg zur Bühne und dort sowohl vor als auch hinter der Spiegelwand. Mussbachs Neigung zur etwas versponnenen Psychologisierung ist hier genau die Form, die den narrativen Pfad nachvollziehbar macht, aber zugleich die assoziativen Räume abseits davon öffnet. Das ist auch ein Klang-Raum-Experiment, noch dazu eins, bei dem ein Opernneuling wie Olafur Eliasson den prägenden Rahmen liefert. Doch sowohl die Riesenspiegelwand, die die Opulenz des Saales und das Orchester ins Sichtbare holt, als auch die Lichtreflexionen, mit denen er magisch das Labyrinth, den Wald oder den Hain von Nemi imaginiert, biedern sich nie illustrierend an, sondern halten die Distanz zum Geschehen ebenso gekonnt wie die Musik. John Mark Ainsley ist mit Schmelz und klarer Diktion nicht nur ein exzellenter Hippolyt, er könnte gut ein jüngeres Alter Ego des Komponisten sein. Das Verführerische von Phaedra und Aphrodite wird von Maria Riccarda Wesseling und Marlis Petersen ebenso lustvoll ausgespielt, wie sich Axel Köhler mit erstaunlicher Verve die Counterpartie der Artemis anverwandelt und Lauri Vasar am Ende als Minotaurus seinen kurzen Auftritt hat. |
|
Wenn Mama den Stiefsohn liebt WILHELM SINKOVICZ Niveau hat das ja nicht sehr viel. Aber: So ein Reißer", so soll sich einst Franz Molnár über Hugo von Hofmannsthals schwer verständliches Drama „Der Turm" geäußert haben. In Berlin sah man nun Hans Werner Henzes jüngste Oper, „Phaedra" – was Molnár zum Drama der Königin gesagt hätte, die sich in den Stiefsohn verliebt? Von brennender Aktualität scheint die antike Parabel nicht. Das meint offenbar Peter Mussbach, Intendant der Berliner Staatsoper „Unter den Linden", und verzichtet darauf, in seiner Uraufführungsinszenierung so etwas wie eine Handlung zu erzählen. Vielmehr vertraut er auf die Stimmungen von Olafur Eliassons Theaterraum, ganz in Schwarz, dann wieder von vielfach prismatisch gebrochenem Scheinwerferlicht erhellt. Das Orchester musiziert unter der Ehrenloge, in der der Komponist schon bei seinem Eintritt mit Standing Ovations empfangen wird. Henze und seine deutsche Heimat, das ist ein Kapitel für sich. Es muss den 81-Jährigen mit Genugtuung erfüllt haben, zur eigenen Legende geworden zu sein, wo man ihn vor Jahren noch kräftig gescholten hat: Den Hörern war seine Musik „zu modern", den Kritikern und Kulturphilosophen zu retrospektiv, weil keinem „Ismus" zuzurechnen. Erinnerungen an Dur und Moll Schon in den Fünfzigerjahren ist Henze nach Italien entflohen, wo er in der Nähe von Rom seine wahre Heimat gefunden hat. Von dort schickte er Musiktheaterwerke in die Welt, große Opern, Kammerspiele, politische Tendenzstücke. Von Mal zu Mal wechselte er Formen und Ausdrucksmittel. Seine Musiksprache aber hat sich stetig entwickelt. Klangsinnlich und farbenfroh war sie stets. In den vergangenen Jahren fand Henze zu einer üppig wuchernden, gleichwohl feinsinnig differenzierten Vielstimmigkeit, deren Gespinste immer wieder von altvertrauten Dur- und Mollakkorden durchzogen werden, die das Klanggebäude wie Traversen zu tragen scheinen. Das erleichtert das Verständnis. Jedenfalls ist von mangelndem Zuspruch nichts mehr zu bemerken. Die Premiere der „Phaedra" war restlos ausverkauft. Der Erfolg glänzend. Das Ensemble Modern, das unter Michael Boder den instrumentalen Part übernahm, hat immensen Anteil daran. Denn die Musiker loten Henzes Partitur nach Herzenslust aus, zaubern von dunklen, aus Fagott- und Klarinettenklängen aufsteigenden Bildern bis zu duftigen Harfen- und Klavierarpeggien immer neue, abwechslungsreiche Tableaus, in denen die Sänger als Zentralfiguren herrlich aufgehen können. Die Besetzung für das kammermusikalisch instrumentierte Drama ist exquisit: Marlis Petersen jubiliert koloraturgewandt als Aphrodite, weiß aber auch die karikativen Momente mit Biss und Schärfe zu zeichnen. John Mark Ainsley schenkt dem Hippolyt, um den sich die Damen reißen, die verzehrend schönen, virtuos modellierten Tenor-Melismen, die den immer diffuser werdenden Gang der Handlung als Protokoll wachsender Verzweiflung begreiflich werden lassen. Henzes Werk spiegelt die Handlung des ersten Abschnitts, die mit dem Tod des Hippolyt endet, nach der Pause ins Metaphysische und strebt einem Ende von abgehobener Heiterkeit zu. Abschied in transzendenter Leichtigkeit Der abschließende, schwebende Rundtanz klingt wie eine visionäre Parodie von Mozarts „Entführungs"-Finale; nur dass diesmal keine bösen Mächte hereinbrechen wie Osmin. „Wir sind nackt geboren. Wir dringen zur Sterblichkeit vor und tanzen", lässt der Komponist zuletzt singen. Ein Abschiedsrondeau von transzendenter Leichtigkeit, die dank des Dirigenten Sinn für rhythmische Finesse den rechten Charakter erhält. Lauri Vasar steuert dem zuvor des Öfteren mit den gefährlicheren Tönen des Minotauros entgegen. Und Maria Riccarda Wesseling nützt ihre Chance, als Einspringerin für Magdalena Kozena ihren schön entwickelten Mezzo nach allen Regeln der musikdramatischen Kunst hören zu lassen, lustvoll oder zornig, begehrlich oder beschwörend, im Duett mit Aphrodite auch keck, ja kabarettistisch. Dem kann die Jagdgöttin Artemis, die bemerkenswerterweise mit einem Countertenor besetzt ist, kaum Gleichwertiges entgegensetzen: Axel Köhler punktet lediglich mit seiner aparten Stimmfarbe, nicht mit expressivem Variantenreichtum derselben. Blieb am Premierenabend lediglich die Frage, warum nicht auch ein wenig von den Handlungssträngen, die sich da musikalisch verknoten, zumindest andeutungsweise auch in szenische Aktion umgewandelt werden konnte. Vielleicht klappt das bis zur Wiener-Festwochen-Präsentation im kommenden Frühjahr? |
|
Gefangen von den eigenen Spiegelbildern VON GERALD FELBER BERLIN. Die Liebe höret nimmer auf. Oder: frei, aber einsam. Und jedenfalls: zurück zur Natur: Es sind Bruchstücke europäischen Aufklärungsguts, aus denen sich die seltsame „Phaedra" Hans Werner Henzes formiert; sie schwimmen um einen herum wie die kaleidoskopischen Puzzleteile und Lichtbögen der symbolschwangeren Bilder Olafur Eliassons für die Uraufführung an der Berliner Staatsoper. Librettist Christian Lehnert hat die Geschichte der Titelheldin, die sich in ihren Stiefsohn Hippolyt verliebt und diesen, als er sie zurückweist, mittels einer Intrige umbringen lässt, zu einem Stellvertreterkrieg der Göttinnen Aphrodite und Artemis gemacht und auch über den irdischen Tod hinaus fortgeschrieben - der Geliebte ist nun eine Art Golem geworden. Doch es gibt ein merkwürdiges Happy-End: Hippolyt mutiert zum Waldgott, und die verfeindeten Parteien beschließen einträchtig, vorerst die Dinge zu nehmen, wie sie nun mal sind. Man kann das zu durchdringen versuchen, fährt aber jedenfalls leichter, wenn man sich, statt die Feinheiten des philosophischen Hintergrunds zu ergründen, zuerst auf Aura und Atmosphäre einlässt, auf dieses Schwingen und Klingen herbstlich satter, von Trauer durchsetzter Farben, die viel vom Abschied wissen und sich ihm doch nicht ausliefern wollen. Hans Werner Henze, der inzwischen 81 ist, komponiert ja schon seit geraumer Zeit Gesänge der Loslösung. Nun hat sich daraus eine Art Götterdämmerung en miniature geformt, 80 Minuten lang und im Kammerformat. Aber das spielt eben nicht auf dem Walkürenfelsen, sondern in mediterraner Szenerie, und so mischen sich auch Süße und milde Weichheit in die Musik des 23-Mann-Orchesters, unter den oft spröd-klassizistischen Deklamationston der Akteure. Die Sicherheit der Farbgebung, der charakterlichen Binnendifferenzierung verdient einmal mehr Respekt; der große, herausfordernde Schwung ist wohl nicht gewollt und wird jedenfalls nicht erreicht. Michael Boder führte das fast streicherlose Ensemble modern mit gelassener Souveränität, und die vier Hauptakteure (Maria Riccarda Wesseling, Marlis Petersen, John Mark Ainsley und Axel Köhler) sangen sich zunehmend frei, nachdem anfangs erst einmal Genauigkeit statt Expression angesagt war. Die Akteure waren in Schwarz- und Beige-Tönen auch sonst optisch neutralisiert: Reduzierung, Lehrstück-Theater mit fernöstlichen Anklängen. Damit allein wäre Peter Mussbachs Inszenierung wohl kaum glücklich geworden, aber seine Szenen waren ja den oft starken, kühl-mystischen Bildern Olafur Eliassons eingeschrieben, lebten in ihnen und durch sie. Spiegelnde Folien, die Zuschauerraum und Orchester doppelten; harte Lichtschläge und prismatische Brechungen - am beeindruckendsten, wenn sich der durch Artemis wiederbelebte Hippolyt im Käfig seiner eigenen Spiegelbilder gefangen sieht: eine Bühnen-Kosmologie, ganz anders als die musikalische Henzes, aber in ihrem Zug zur abstrahierenden Ästhetisierung doch wieder mit ihr verbunden. |
|
Heiterer Triumph Berlin. Eigensinnig, lässig und originell: Uraufführung von Hans Werner Henzes Konzertoper „Phaedra". Kai Luehrs-Kaiser Vor einigen Monaten starb Fausto Moroni, der Lebensgefährte von Hans Werner Henze. Noch kürzlich hatte er den todkranken Henze gesund gepflegt. Man erwartete nun von dem Tonschöpfer, als er für die Uraufführung von „Phaedra" nach Berlin kam, beinahe ein Requiem. Für jenen Menschen, mit dem er jahrzehntelang zusammengelebt hatte - obwohl der mit Henzes Musik wenig anfangen konnte. Stattdessen geriet „Phaedra" zu einer mehrfachen Überraschung - und zum fast heiteren Triumph für den 81-Jährigen. Leichthändig wie ein Zauberkünstler, der noch einmal tief in die Trickkiste greift, hatte Henze ein Vexierspiel musikalischer Einflüsse komponiert, die kunstvoll und souverän durcheinander gemischt werden. Erstes Bühnenbild von Olafur Eliasson Aus der Königsloge der Berliner Staatsoper huldvoll winkend, ließ sich der greise Henze, fahl und kantig dasitzend wie eine Figur von Max Beckmann, bei der Premiere feiern. Diese „Phaedra", weit entschlussfreudiger und unkonventioneller klingend als seine letzten Werke („L‘Upupa" und die zehnte Symphonie) wirkt endgültig wie ein verklärendes Spätwerk: eigensinnig, lässig und originell. Unbekümmert auch um die Strömungen und Moden um ihn herum. Es soll (wieder einmal) die letzte Oper Henzes gewesen sein. Mit dem in Berlin lebenden und lehrenden Künstler Olafur Eliasson, bekannt unter anderem durch seine grandiose Lichtinstallation für den Münchner Kunstbau und durch das Sonnen-Projekt „Weather Project" in der Londoner Tate Modern, hatte man einen Bühnenbild-Debütanten engagiert, der Henzes Musik nicht kannte, als er sein Konzept abschloss. Die Bühne endet bei ihm dort, wo sie normalweise anfängt: an der Rampe. Das Parkett ist durch einen riesigen Spiegel, in dem wir uns sehen, vom Bühnenhaus abgetrennt. Das Orchester sitzt hinten - im Rücken des Publikums. Laser-Seifenblasen, eine astronomische Discokugel, die statischen Licht-Flitter an die Wände wirft, und ein Hippolyt im Spiegeltrichter sind die bizarren Schaueffekte dieses philosophisch überfrachteten, aber doch neuartigen Aufführungs-Designs. Mit der Musik Henzes hat es (vielleicht durch Zufall) gemein, dass auch Henzes Spiegelungen von Messiaen, Wagner und Bach in sich ein Spiel changierender Reflexionen bilden. Man versteht nicht immer, wie das alles zusammenpasst. Und bleibt merkwürdigerweise doch gebannt dabei. Die Oper war ursprünglich für die Mezzosopranistin Magdalena Koena komponiert worden und musste durch deren Absage ohne den heiß ersehnten Star auskommen. Koena, die sich einer ärzlichen Behandlung unterziehen muss, aber schon wieder gesichtet wurde, will die Rolle zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen. Maria Riccarda Wesseling singt nun die Phaedra mit der Begehrlichkeit einer Männerjägerin. Mit John Mark Ainsley - großartig als Hippolyt - und Marlis Petersen als zwitschernde, zirpend eifersüchtige Aphrodite stehen endlich einmal wieder bedeutende, exzellente Sänger im gebeutelten Berlin auf der Bühne. Lauri Vasar (Minotaurus) und der keifende Axel Köhler als Jagdgöttin Artemis lenken gekonnt vom konfusen Libretto Christan Lehnerts ab. Der lässt die Handlung größtenteils im Wald spielen - von dem man indes wenig sieht. Hippolyt darf nach seiner Ermordung als Waldgott wieder auferstehen. Stört alles nicht. Sogar Regisseur Peter Mussbach, der meist am besten ist, wenn er gar nichts macht, kann durch wenige, aufrechte Gänge, auf die er sich beschränkt, das heterogene Glück des Abends kaum mindern. Wie ist das alles möglich? Ganz einfach: Durch die Idee einer „Konzertoper" hat sich Henze von vornherein gegen die Labilität seiner Mitstreiter abgesichert. Kaum von der Hand zu weisen ist der Verdacht, der Begriff „Konzertoper" kaschiere nur die Tatsache, dass das Werk nicht ganz fertig geworden sei. Der Komponist gab auf Anfrage zu, sein Opus laviere „zwischen Oratorium und Musikdrama". Es strebe eigentlich in den Konzertsaal. Im Klartext: Henze wünscht sich seine Musik als Hauptakteur und Mittelpunkt des Abends. Ein verständlicher Wunsch. Der Komponist hatte auf diese Weise gleichsam alle Geschäfte in die eigene Hand genommen. Und prompt gewonnen. Später Klassiker mit Charme Nach über 20 Opern wird niemand von ihm erwarten, dass er sich als Komponist neu erfindet oder definiert. Noch immer ist seine Musik, hier transparent durchleuchtet vom Ensemble Modern unter Michael Boder, zwölftönig inspiriert. Sein kantabler, farbintensiver Tonfall spannt besonders im zweiten Teil lange Bögen, stiftet musikalischen Sinn, statt wie sonst üblich in Ächzen und Fiepen zu zerbröseln, sodass er gekonnt zu einem musikalischen Erzählstil zurückfindet. Üblich wäre eher das Gegenteil. In einer Phase, wo Gesundheit und Leben ihn fast gebrochen hatten, zeigt Henze erstaunliche Überlegenheit und Charme. Mit „Phaedra" hat er einen späten Klassiker vorgelegt. Die Handlung Phaedra verliebt sich in ihren Stiefsohn Hippolyt und verleumdet ihn, als sie auf keine Gegenliebe stößt. Sein Vater Theseus lässt ihn daraufhin töten. Phaedra bringt sich um. Das Libretto stützt sich auf Schillers Übersetzung Racines, verlängert das Drama jedoch um Szenen im Diana-Hain bei Rom, in dessen Nähe Hans Werner Henze heute lebt. Die Besetzung |
|
Hans Werner Henzes "Phädra" in Berlin uraufgeführt An diesem Abend ist alles umgekehrt. Als der inzwischen 81-jährige Komponist Hans-Werner Henze vor Beginn der Vorstellung den Balkon im ersten Rang der Berliner Staatsoper betritt, spendet ihm das Publikum Standing Ovations - einfach weil er da ist und weil er eine weitere Oper schrieb, deren Vollendung ihm nach "L"Upupa" 2003 keiner mehr zutraute. VON SUSANNE BENDA Henze genießt den Jubel, hebt die Hand zum dankenden Gruß - fast wie ein Segen sieht das aus, und es erinnert irgendwie an den alten Papst Johannes Paul II., wie er aus dem Fenster auf den Petersplatz hinauswinkte. "Phädra" heißt das neue Werk. Wir begegnen Hippolyt, jenem Sohn des Theseus, den dessen zweite Frau Phädra begehrt; als er sich der Stiefmutter verweigert, übt diese tödliche Rache. Die von Euripides und Racine dramatisierte Handlung ergänzen Henze und sein Librettist, der Lyriker und Theologe Christian Lehnert, um einen Schluss, der auf Ovids "Metamorphosen" zurückgreift: Die einzelnen Körperteile des von Poseidon Getöteten werden von seiner Schutzgöttin Artemis zu einem neuen Menschen zusammengesetzt. An diesem Abend ist alles umgekehrt. Nicht nur findet das Ende vor dem Anfang statt, sondern hinten ist auch vorne. Für ihre szenische Aufbereitung des Stücks, das Henze selbst eine "Konzertoper" nannte, konnte der regieführende Berliner Staatsopernintendant Peter Mussbach den dänisch-isländischen Lichtkünstler Olafur Eliasson als attraktiven Mitstreiter für die Gestaltung des Bühnenraums gewinnen - und der lässt das Publikum erst einmal im Dunkeln hocken. Dort lauscht es schönen, fein ausgehorchten Bläsersätzen. Diese jedoch erklingen von der falschen Seite, denn Michael Boder und 23 Musiker des Ensembles modern sitzen hinten im Parkett. Aus dem instrumentalen Geschehen schälen sich fast unbemerkt die Sänger heraus: Maria Riccarda Wesseling als Phädra, Marlin Petersen als Aphrodite, Axel Köhler in einer Art "Rockrolle" als Artemis und vor allem der mit bewundernswerter Prägnanz singende John Mark Ainsley als Hippolyt - eine starke Vokalgruppe. Wenn sich die Darsteller auf den Laufsteg begeben, der das Orchester mit der Bühne verbindet, wird der Vorhang vorne plötzlich zum Spiegel. Verwirrend ist das, betörend (auch wenn sich der Effekt mit der Zeit abnutzt): Von hinten kommen die Klänge, und vorne betrachten wir nicht nur ihre Produktion, sondern auch uns selbst als Publikum, das reflektieren soll, was da in spiegelnder Lichtbrechung reflektiert wird, und dem am Ende zudem noch eine ähnliche gedankliche Synthese abverlangt wird, wie sie Artemis vorne bei der Rekonstruktion Hippolyts aktiv an den Tag legt. Die Bilderwelt dieser "Phädra" hat faszinierende Momente. Ebenso die Musik. Vor allem in der Instrumentation, in immer wieder überraschenden Mischungen der Klänge zeigt Henze wieder große Meisterschaft, und er spielt immer wieder so subtil mit Versatzstücken der Musikgeschichte, dass ihm eine geradezu fröhliche Altersgelassenheit attestiert werden muss. Viel Schönheit liegt über der Musik und über dem sehr poetischen Text. Doch das ist (leider) nicht alles. Denn der Regisseur setzt - wie zuletzt auch bei der Uraufführung von Hans Zenders Oper "Chief Joseph" - die Bilder des Stücks in so plumpen Naturalismus um, dass man sich ernsthaft fragen musste, warum Uraufführungen an der Staatsoper eigentlich zwangsläufig Chefsache sind. Wobei das Problem bei "Phädra" letztendlich auch im Stück selbst wurzelt. Gerade weil Henzes Musik so fein und schön, gerade weil Lehnerts Zeilen so elaboriert sind, haben sie mit packendem Bühnenspiel eigentlich gar nichts mehr im Sinn. Mit seiner nun womöglich wirklich letzten Oper hat sich Hans Werner Henze klammheimlich von der Bühne verabschiedet. |
|
Nürnberger Nachrichten Jubel für einen wagemutigen Opernabend Ein bewegender Abend: Für seine Oper "Phaedra", an der er in den vergangenen, von Krankheit gezeichneten Jahren gearbeitet hatte, wurde der 81-jährige Komponist Hans Werner Henze in Berlin stürmisch gefeiert. Ein markantes Zeichen zum bislang matten Saisonauftakt setzt an der Staatsoper Unter den Linden der Doyen der deutschen Nachkriegskomponisten, Hans Werner Henze. Eine "Konzertoper" nennt er "Phaedra", zu dem ihm der Lyriker Christian Lehnert den Mythos formte, der schon Euripides und Seneca, später Racine und den Komponisten Rameau reizte. Liebe und Eifersucht Es geht um die Gattin des Theseus, die in Liebe zu ihrem Stiefsohn Hippolyt entbrennt und ihn beim Vater der Vergewaltigung zeiht, als er sich ihr entzieht. Theseus will Hippolyt töten lassen, Phäedra erhängt sich. Der tödlich verwundete Hippolyt wird von der Göttin Artemis gerettet und unter dem Namen Virbius am Nemi, einem See südlich Roms, zusammengeflickt - ebendort wo Hans Werner Henze seit vielen Jahren lebt. In der Ehrenloge der Staatsoper wird er verehrungsvoll mit standing ovations begrüßt und nach zwei Stunden spannenden, vitalen, fantasievollen, ausgefeilten, keinesfalls matt abgeklärten Musiktheaters begeistert gefeiert. Das Ensemble Modern, so sensibel wie straff von Michael Boder geführt, spielt eine Komposition voll Charakter: Nur vier Streichern steht eine breit gefächerte Bläserpalette gegenüber, ein differenziertes Schlagwerk setzt starke Akzente, auch die Stellung des Klaviers in der Partitur ist markant. Ein farbreiches, temperamentvolles Unwetter im zweiten Teil wird für Henze zum kompositorischen Triumph. Die dramatischen Konstellationen und Charaktere sind durchaus heiklen, bestens gemeisterten Partien zugeordnet. Phaedra (Maria Riccarda Wesseling) und Aphrodite (Marlis Petersen) haben expressive, auch in Koloraturen aufschwingende Gesangslinien, die sie in Mezzo- und Sopranfülle aufblühen lassen. Axel Köhler als Artemis brilliert mit ausdrucksstarkem Altus, Lauri Vasar als Minotaurus ist ein höchst lebendiger, junger Bariton. Im Zentrum aber steht John Mark Ainsley als Hippolyt, Objekt der Begierde wie des Zorns von Menschen und Göttern mit hinreißend männlichem Tenor, vitaler Statur und einem Aussehen wie der junge Henze selbst. Peter Mussbach führt dieses herausragende Ensemble entsprechend dem Druck von Zorn und Leidenschaft sehr expressiv. Der Clou seiner Inszenierung ist, dass er den dänisch–isländischen, zwischen Raum, Zeit und Architektur vagabundierenden, in Berlin lebenden Lichtkünstlers Olafur Eliasson mit ins Boot geholt hat. Lohnender Wagemut Gemeinsamer Wagemut aller macht den Abend überragend. Das Orchester wird am hinteren Ende des Parketts platziert. Ein Laufsteg führt vom Dirigenten durchs Publikum zur Bühne. Die schließt eine Spiegelwand ab, die durch Licht wieder weggeleuchtet wird und bis zum weißen, leeren Raum veränderbar ist. Hier wird ein Flügel auch zum Kampf- und Liebesplatz. Und hier wird der Hain zu Reparatur und Heilung des zer-stückelten Hippolyt zum wunderbar rotierenden,silbern schimmernden Kaleidoskop. Die Reduktion auf Material und Form, auch in den strengen Kostümen von Bernd Skodzig, bannt zwar die Gefahr von Kitsch und Schwulst, die Abstraktion und Konzentration führt aber auch zu Unübersichtlichkeit. Die lyrische Grundierung der Fabel, ihre Fassung im dramatischen Musikgestus sind für den Zuschauer oft schwer nachvollziehbar, weil die hier dringend notwendigen Übertitel ausgespart sind. Dem Jubel und der Bewunderung für diesen starken Abend tut das indes keinen Abbruch. LORENZ TOMERIUS |
|
Erstaunlicher Abend Von Georg-Friedrich Kühn Verstoßene Liebe, Rache und Unheil ist ein Thema der Phaedra. Nun hat sich der 81-jährige Komponist Hans Werner Henze der Fortführung der Sage angenommen. Sensibel, sinnlich, kraftvoll ist diese Musik. Man merkt es ihr kaum an, dass sie in einer der schwierigsten Lebensphasen des Komponisten entstand. Henze selbst war todkrank, dann starb der Lebensgefährte. In seinem die Arbeit begleitenden Tagebuch notiert Henze lange Phasen der Lustlosigkeit, überhaupt über das Notenpapier sich zu beugen. Aber man merkt auch, das Sujet sollte eine Art Jungbrunnen für ihn sein: diese Geschichte von Hippolyt, der von seiner Stiefmutter Phaedra bedrängt, der Vergewaltigung beschuldigt, von rivalisierenden Göttern erst im Meer versenkt und dann an einem neuen Ort wieder zum Leben erweckt wird. Dieser Ort liegt nahe von Henzes italienischem Landsitz am Nemi-See. "Konzertoper" nennt der 81-jährige Hans Werner Henze sein jüngstes Werk. Das Libretto, im wesentlichen Racine und Ovid folgend, wollte er sich ursprünglich selber einrichten, hat die Arbeit dann aber dem Dresdner Lyriker Christian Lehnert überlassen. Entstanden ist ein überraschend starkes 90-minütiges Stück für fünf Solisten und Kammerensemble mit einem sehr spezifischen, stark bläsergefärbten, gelegentlich auch an Richard Strauss' "Ariadne auf Naxos" erinnernden silbrigen Klang. Nicht zufällig: Phaedra ist die zweite Gattin von Theseus, dem Minotaurus-Bezwinger. Am Ende taucht der Minotaurus auch selber auf und tanzt durch die Wälder. Regisseur Peter Mussbach nimmt den Untertitel "Konzertoper" so wörtlich wie möglich. Die Aktionen beschränkt er auf ein Minimum, bemüht die Gestensprache von Stummfilm und Expressionismus. Erzählt wird die Geschichte vom gejagten Jäger Hippolyt vor allem durch den von Olafur Eliasson gestalteten Raum. Erstmals arbeitet Eliasson für das Musiktheater. Er teilt das Parkett in der Mitte mit einem Steg. Das Orchester sitzt hinter dem Publikum im rückwärtigen Bereich. Die Zuschauerreihen sind nach vorn bis über den Orchestergraben erweitert. Der erste in der Götterwelt spielende Akt ist hauptsächlich im Zuschauerraum angesiedelt. Den zweiten, in der Menschenwelt verorteten Teil verlegt Eliasson mehr auf die Bühne. Eliasson: "Das ganze Projekt war dann für mich schon so eine Art Prozess, wo ich von ganz draußen kam. Und jetzt weiß ich, dass ich sehr wenig darüber weiß." Mit einer raffinierten sowohl reflektierenden wie transparent zu machenden Spiegelwand im Bühnenportal, mit Prismen und splitternden Lichteffekten will Eliasson eine getrennte Wahrnehmung von optischen und akustischen Eindrücken erreichen. Der Zuschauer ist mit gefordert sich zu bewegen, sieht sich gelegentlich auch auf der Bühne gespiegelt. "Quasi nicht, dass Oper als illusionistische Trennung, als träumerische Reise von der Welt hinweg, aber Oper eher als Mikroskop, als Annäherung an das, wie setzten wir uns in unserer Welt durch?" Die Überlegungen von Eliasson sind vielleicht etwas naiv, die Durchhörbarkeit von Text und Musik förderte dieses Raumkonzept aber entschieden. Unverständlich dass man mit einer ausgedehnten, überflüssigen Pause sich teilweise der Gesamtwirkung des Abends begab. Auf wackeligen Beinen war Hans Werner Henze zu Beginn in die Loge der Staatsoper geleitet und vom Publikum stehend mit Ovationen begrüßt worden. In der Loge nahm Henze auch den Schlussapplaus entgegen - eine göttliche Szene für sich. Das Publikum feierte aber auch das ganze Ensemble, die Musiker vom Ensemble Modern mit Michael Boder am Pult und das homogene Solisten-Quintett, voran John Mark Ainsley als Hippolyt. Die Aufführung, eine Koproduktion mit dem Musikfest Berlin, reist noch weiter nach Brüssel, Frankfurt und Wien - ein in vieler Hinsicht erstaunlicher Abend. |
|
IN REVIEW BERLIN — Phaedra, Staatsoper Unter den Linden, 9/6/07 T he must-see classical event of the season in Berlin was the latest work from eighty-one-year-old composer Hans Werner Henze. Phaedra — Henze's fourteenth opera — is a dark, morbid work, whose existential themes of fate and the possibility of redemption seem naturally suited to an artist now in his ninth decade. Billed as a "Konzertoper," Phaedra arrived at the Berlin Staatsoper on September 6, with the house's artistic manager, Peter Mussbach, staging the event. On the podium was the capable Michael Boder, a maestro equally at home with classical and contemporary music; the orchestra was the estimable Ensemble Modern.Christian Lehnert's libretto, freely adapted from Ovid, tells of the desperate love that the queen Phaedra harbors for her stepson, Hippolytus. He, in turn, worships the hunting goddess Artemis, who thwarts Phaedra's attempts to woo Hippolytus. Aphrodite, also in love with Hippolytus, bands together with Phaedra to seek revenge. Mezzo Magdalena Kožená had been scheduled to sing the title role but was taken ill. Instead, the task of creating the opera's heroine fell to Maria Riccarda Wesseling, an artist whose diverse resumé spans Handel and Zemlinsky. Making her Staatsoper debut, Wesseling sang her demanding, often melismatic role with vocal and physical conviction. Her three costars were well matched. British tenor John Mark Ainsley sang Hippolytus with urgency and lyricism. Marlis Petersen, a veteran Lulu, made Aphrodite seem an intense fury. Countertenor Axel Köhler made a particularly vivid impression, alternating between carefully sculpted falsetto and heroic speech as Artemis. Mussbach opted for an entirely abstract staging that was, at times, reminiscent of Robert Wilson. The alluring, moody — and often blinding — lighting was designed by Olaf Freese. The rubber costumes of Bernd Skodzig were as perplexing as they were strangely appropriate. But most arresting was the dizzying "Raumkonzept" (space-concept) by Olafur Eliasson, which included a variety of optical novelties, including concentric rings of light projected onto the curtain via a suspended orb; a fractured disco-ball that created a big-bang light show; and a hexagonal prism that reflected the naked, supine Hippolytus like a kaleidoscope. In any flashy production, there is the risk of the visuals upstaging the music. But despite the profusion of mirrors, catwalks and light-projections, the music took center stage. Henze has fashioned a contemporary opera that sounds fresh and new yet has links to both Modernism and Classicism — an ambitious chamber piece with the immediacy and daring of the Second Vienna School. Situated somewhere between lyricism and cacophony (the percussion section alone contains twenty-eight different instruments), Phaedra includes unexpected elements such as nontraditionally Western instruments, pre-recorded sounds and vocal distortions. Such elements make Phaedra a dark atonal creation, with allusions to tango, jazz and even Bach. Comparisons with Stravinsky's Oedipus Rex and Strauss's Elektra — two other modernist works based on classical source-material — are not out of place. Henze seemed also to be channeling Berg, in particular in his searing vocal writing. The vocal line is often echoed in distorted form by an accompanying instrument, suggesting parallel worlds, personae and fates. At the end of the evening, the audience gave the singers and musicians a thunderous ovation. The loudest applause, however, was reserved for Henze, who had been watching his musical meditation on love, death and leave-taking from the emperor's box. A. J. GOLDMANN |
|
Berliners Cheer Composer Henze at World Premiere of `Phaedra' By Catherine Hickley A frail yet beaming Hans Werner Henze waved regally to an audience standing and applauding at Berlin's Staatsoper last night after the premiere of his opera ``Phaedra.'' The 81-year-old composer, who needed help getting to his seat at the opera house on Unter den Linden, made an arduous journey from his home in Italy for the premiere. No wonder he looked pleased at the response. Even the production team, led by Peter Mussbach, won warm applause from this tough audience. In the ancient Greek myth, Queen Phaedra falls in love with her stepson Hippolytus. When he rejects her, she exacts revenge by telling King Theseus that Hippolytus has raped her. Versions of the story have varying endings -- none of them good. In Henze's version -- the librettist is Christian Lehnert -- the gods function as extensions of their human proteges. Artemis, the god of the hunt, teams up with Hippolytus, while Aphrodite, in love with Hippolytus herself, exhorts Phaedra to follow her desires. The monster Minotauros, lurking ominously in the chilling opening notes, only appears in person at the end. In the opening scene, Minotauros's labyrinth is implied by rings of light reflected off a small hoop hanging above the audience. The rings swoop around the house, swelling in size from something that could be the eye of the monster to encompass the whole theater, drawing the audience into the labyrinth as low bass notes echo all around. Desire and Disdain The callous Hippolytus (John Mark Ainsley) is not so much repelled by Phaedra (Maria Riccarda Wesseling) as incapable of understanding her desire. He asks why she clings to him ``like a drowning man clings to a plank?'' Her love turns to hatred, desire into thirst for revenge. With both characters dead by the end of Act One, Act Two enters a more esoteric realm. It opens with a piercing shriek in Artemis's grove, where the god is putting Hippolytus back together, as Virbius. Phaedra returns from the Underworld to taunt him. Yet the confused identities, taunts and promise of rebirth don't sustain dramatic tension. It fizzles toward the end. With just 23 musicians, the Ensemble Modern creates a pared- down sound that makes this opera an intimate experience. It performs almost as a group of soloists, each engaging separately with the audience in a score where doom and darkness prevail over moments of lyricism portraying a love that is itself twisted. Instead of sitting in the orchestra pit, the ensemble, led by Michael Boder, is on a platform at the back of the theater. A catwalk links the musicians to the stage. The orchestra pit is covered to make room for extra seating, eliminating the distance between the singers and audience and adding to the intimacy. Mirrors, Light The singers begin at the back of the house, where they perform as in concert with the musicians, reflected onto the stage by a huge mirror. They roam the catwalk, inhabiting both the platform at the back and Danish artist Olafur Eliasson's abstract stage sets, which use little more than refracted light and mirrors to suggest a world of beauty, illusion, confusion and danger. There were confident performances from all the singers. Wesseling, brought in to replace Magdalena Kozena who canceled, was powerful as the scorned queen. Countertenor Axel Koehler was impressive as a distraught Artemis frantically repairing the wounded Hippolytus and Ainsley communicated both the insouciance and the confusion of his character. Catherine Hickley is a writer for Bloomberg News. The opinions expressed are her own. |
|
I due mondi di Fedra Dopo quasi quattro anni di silenzio, Hans Werner Henze torna al teatro con un'opera-concerto ispirata al mito di Fedra. Con un'esemplare economia di mezzi, Henze compone un lavoro di ammirevole equilibrio e di classiche simmetrie, che conquista il pubblico berlinese. Un successo che deve molto al riuscito spettacolo di Mussbach e Eliasson e agli esemplari interpreti.
Hans Werner Henze torna all'eternità del mito classico per la sua quattordicesima opera, culmine di una parabola compositiva cominciata quasi sessant'anni fa. Lavoro di ammirevole equilibrio e di classiche simmetrie realizzate con esemplare economia di mezzi espressivi. Tutto in questo suo nuovo lavoro ha un senso e contribuisce all'implacabile meccanismo teatrale. Tutto è costruito sulla coniugazione di opposti, su di un'aurea dualità che ha la bellezza delle costruzioni classiche di cui questo lavoro vive: fusione di concerto e opera, due atti di uguale durata, due coppie di personaggi umani e divini (più il minotauro, simbolo della fusione delle due nature), alchimie sonore di legni ed ottoni e per raccontare la regalità di Fedra ispirata da Afrodite ed i boschi in cui si muove Ippolito devoto ad Artemide. In ammirevole sintonia con l'universo espressivo di Henze il libretto del poeta Christian Lehnert che passa dal "Mattino", sintesi delle riflessioni millenarie sul tragico amore di Fedra per il figliastro Ippolito, alla "Sera" che vira il mito in chiave grottesca e racconta la sua fine con il trionfo del Minotauro sulla caducità delle umane passioni. Il regista Peter Mussbach opera un'abile sintesi fra opera e concerto e traduce in immagini di grande forza espressiva le dualità di cui è fatto il testo, coadiuvato da un'impianto scenico di luci e di macchine illusionistiche di Olafur Eliasson. La controllatissima e rigorosa direzione di Michael Boder guida con autorevolezza il complesso dei 23 solisti, perfetti, dell'Ensemble Modern. Esemplari i cinque protagonisti vocali, ad un tempo narratori ed interpreti della tragedia. Un lungo applauso ha salutato l'ingresso in sala di Henze, festeggiatissimo anche alla fine con tutti gli altri interpreti di questa Phaedra. Stefano Nardelli |
|
Commovente successo a Berlino per l’opera più recente del compositore Phaedra è il coronamento di una poetica da sempre affascinata dalla classicità greca Nella sessantennale carriera di Hans Werner Henze la classicità è un’utopia che lo spinge a lasciare le macerie della Germania postbellica all’inizio degli anni Cinquanta per trasferirsi in Italia, culla dei miti e della bellezza; il riferimento al mondo classico è costante nella sua produzione e trova il suo coronamento in quest’ultimo lavoro, Phaedra. Commissionata dalla berlinese Staatsoper Unter den Linden e dai Berliner Festspiele con il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, le Wiener Festwochen e l’Alte Oper di Francoforte, la quattordicesima opera di Henze arriva a quattro anni dall’Upupa o il trionfo dell’amor filiale, accolta con grande successo al Festival di Salisburgo nel 2004. Quattro anni segnati dalla perdita di persone care e dalla grave malattia che ha colto Henze a metà del lavoro e l’ha costretto a sospendere per un lungo periodo la composizione del secondo atto. Eppure, a dispetto della sua tormentata gestazione, questa nuova opera si fa ammirare per il grande equilibrio e le classiche simmetrie raggiunti con magistrale economia di mezzi espressivi. E proprio attraverso questi elementi, prima ancora che per il soggetto, Henze sembra dare un senso all’utopia della sua esistenza. Tutto in Phaedra è costruito sulla coniugazione di opposti, su di un’aurea dualità che conferisce a questo lavoro la serena nobiltà delle costruzioni classiche. La duplice natura è esplicitata già nella definizione: "Konzertoper", concerto e opera. Due atti di uguale durata (circa 45 minuti), ma in qualche modo opposti per colore, di compostezza apollinea il primo e di dionisiaca inquietudine il secondo. Due atti scritti per un organico ridotto di soli 23 strumentisti per una trentina di strumenti e 5 cantanti-interpreti. Dualità e simmetrie si ritrovano persino nella strumentazione, "henzianamente" concepita in funzione drammaturgica e articolata sui due grandi blocchi degli ottoni – che evocano la regalità del mondo di Fedra – e dei legni – che restituiscono il colore dei boschi nei quali caccia Ippolito – cui si aggiunge un significativo contributo delle percussioni che tingono di arcaico alcuni passaggi significativi dell’opera. Essenza classica In ammirevole sintonia con l’essenzialità della musica di Henze, il librettista Christian Lehnert restringe il dramma a pochi personaggi: gli umani Fedra e Ippolito più i loro alter ego divini, Afrodite ed Artemide; e il Minotauro, sintesi delle due nature, che compare solo alla fine di tutto. Più che narrare attraverso una drammaturgia strutturata, Lehnert evoca la vicenda per grandi blocchi, reminiscenze del mito di Fedra così come è stato tramandato nel corso dei secoli da Euripide, Seneca, Racine fino alla drammaturga inglese Sarah Kane. Più che alle reminescenze classiche del testo di Lehnert, il regista Peter Mussbach è sembrato interessato a dare un senso concreto al concetto di Konzertoper e realizza un’abile sintesi fra due generi in larga misura antitetici. Rovesciando la convenzione dello spettacolo operistico, colloca l’orchestra alle spalle del pubblico e fa raggiungere agli interpreti la scena lungo un catwalk che attraversa la sala. La scena è spesso coperta interamente da una grande superficie riflettente che restituisce alla visione del pubblico l’orchestra e la severa cornice neoclassica della sala della Staatstoper: è il concerto che si fa teatro, al quale gli interpreti/personaggi tendono e nel quale si smaterializzano. Nulla nella visione di Mussbach (nella foto di Ruth Walts, la scena finale con il Minotauro) evoca l’antichità classica: né i costumi "da concerto" disegnati da Bernd Skodzig né lo spazio di luce ed ombra concepito da Olafur Eliasson, uno degli artisti di punta della scena artistica contemponea alla sua prima esperienza teatrale. Grazie ai giochi di luce e alle macchine illusionistiche di Eliasson, Mussbach traduce in immagini di grande forza espressiva le dualità di cui è fatto il testo: nel primo atto i personaggi sono ombre che agiscono in un universo di luci (raffinatissime), mentre nel secondo domina l’oscurità e la frammentazione dei personaggi è concretamente realizzata attraverso grandi prismi che spaccano e moltiplicano i frammenti dei corpi. A tenere le fila musicali della serata è Michael Boder che con grande autorevolezza guida dal fondo della sala la complessa macchina dello spettacolo. La sua è una lettura controllata e rigorosa che si fa apprezzare soprattutto per l’analitica chiarezza con cui guida i 23 perfetti solisti dell’Ensemble Modern, un complesso che vanta una frequentazione relativamente lunga con la musica di Henze che per loro ha scritto il Requiem (1993) e L’heure bleue (2001). Esemplari i cinque interpreti vocali tutti assolutamente calati nei propri ruoli e, soprattutto, adeguati a realizzare il difficile equilibrio di narratori ed interpreti della tragedia. Maria Riccarda Wesseling è una Fedra dura e spietata nel suo trattenuto dolore. Il suo doppio divino, Afrodite, è resa da Marlis Petersen con siderale distacco e controllo perfetto delle asperità della tessitura. John Mark Ainsley disegna con eleganza un Ippolito di profonda umanità e melancolici abbandoni. Axel Köhler tratteggia con la sua vocalità ibrida un’Afrodite tragica e dolente. Malgrado il breve ruolo, si fa notare infine anche la corposa sensualità del Minotauro "in smoking" del giovane baritono Lauri Vasar. Il pubblico ha salutato in piedi con un lungo, affettuoso applauso l’ingresso in sala di Hans Werner Henze. Alla fine dello spettacolo un lungo applauso ancora più caloroso ha festeggiato anche tutti gli interpreti, decretando il pieno successo di questa nuova Phaedra. Stefano Nardelli |