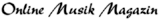11. September 2001 The Eloquent Language of Gestures  FRANKFURT. Giacomo Puccini's "Tosca" is so realistic that the libretto specifies an original location in Rome for each act and dates the action to June 17 and 18, 1800. And Cesare Angelotti really existed: He was the consul of Napoleon's forces of occupation in Rome. So the fictitious story of Scarpia, the chief of the secret police, who is driven by politics and passion to destroy painter Mario Cavaradossi and singer Floria Tosca, does indeed have an authentic historical background. This was evocatively illustrated in an experimental production by Brian Large, whose film version of "Tosca" was broadcast in 1992 from the authentic locations in Rome at the appropriate times of day -- so that the fateful third act, for instance, was aired at dawn. But the film suggested a reality that remains fictional in the opera despite all its verismo. The opera's character as a work of art was overlooked for the sake of sensationalism. But "Tosca" is one of those works in which art plays itself: in the theater of emotions of the first act when the prima donna displays her fateful jealousy; in her festive cantata her devotion to art and her tirades of hatred against Scarpia, who, cynically feigning captivation, thinks this is a wonderful performance; and in the third act when Tosca teaches her lover to act out a convincing death scene. The church too, conspiring with the secular rulers, participates in the charades, using the pomp of the Te Deum and the clangor of bells to mask secular despotism. Theater within theater is one of the themes of this melodrama. Psychological profundity is another, and both these themes serve to offset the superficial naturalism of a horror story. In their production in Frankfurt, which premiered on Saturday, Alfred Kirchner and his stage designer Karl Kneidl seek to examine the verismo of this opera, which for a long time was the target of contemptuous tirades. But above all they wanted to find out how a system of institutionalized violence inescapably traumatizes people and drives them into self-alienation. In the first and last acts, Kirchner and Kneidl strive to transcend realism by playing with space and props and by using an abstract stage design. In the church, the refugee Angelotti (played by Istvan Kovacs) drags a curtain behind him -- a symbol of fear and haste. But at the same time, the curtain serves to unbalance the static nature of the stage with its skewed projections of Baroque architecture, foreshadowing the way the characters, locked into the three-act death spiral, will gradually lose their mental balance. In the last act, after mental and physical torments, Tosca and Cavaradossi are irrevocably beside themselves, and their euphoria lends them wings, cleverly suggested by the train of Tosca's gown. And the painter, becoming a child again, launches a paper swallow into the air shortly before he is shot. The man and the woman react differently to this simulated salvation. Cavaradossi, still fearing blows, withdraws autistically into the cage of his own arms. Biting his nails like a child, he stuffs his fingers into his mouth as though to prevent any word from escaping. Tosca seems physically to dissolve into the cloud of her clothing as she dances as though in flight. There is no need for her to throw herself off the platform of the Castel Sant'Angelo; her collapse on stage, as the silhouette of St. Peter's Cathedral on the screen behind her tilts to one side, is more plausible. And there are other factors, too, that instill a sense of immediate reality to counter theatrical "realism" -- the shepherd (played by boy soprano Kai Kluge) who sings as he walks across the scene, the actors' podium that stage hands push onto the stage, and the matin bells that are visibly rung on stage at the beginning of the act. The production is notable for its minute attention to psychological detail, which makes the flaunting of mere crude naturalism unnecessary. Only once does it go needlessly below the belt, when the sex offender Scarpia exposes himself. His semi-striptease in the church -- blasphemous enough in itself -- would have been quite enough to reveal his sexual designs on Tosca, especially as it was prefaced by his embracing the statue of the madonna. The consequences were too garish for Kirchner's discreet direction, which works with leitmotiv-like references rather than with cudgels. In another scene, a powerful image reminiscent of Jean-Pierre Ponnelle's 1974 production of "Tosca" in Frankfurt, the prima donna had rammed her tormentor against the table top with a knife. Unlike Ponnelle, Kirchner dispenses with the candles and the crucifix, the trappings of a corpse's lying in state. Tosca merely bends over him as though drained with exhaustion, as though she cannot believe what she has done. The tension of this moment of stillness is heightened when Scarpia's right hand sinks down as if he had come back to life to finish his murderous work. But the inertia of the ruling system does the job for him. It is no coincidence that Scarpia's official headquarters is a cramped room stuffed full of furniture, books and Baroque frescoes, very different from the spacious settings of the first and last acts. Scarpia conceals his icy, calculating cruelty behind the trappings of education and culture, which cannot prevent the slaughter. The cramped surroundings reflect the compulsive, passionate character of the perfidious strategist who cultivates a close relationship with his victims to ensnare them in a net of bonhomie and benignness before finishing them off. The collision and overlap of sex drive and homicidal instinct, of art collection and torture chamber is further emphasized by the movement of the doors, whose play of light and shadow suggests constant danger. The stage design was complemented by the impressive performance of the Frankfurt Museumsorchester. In flowing changes of tempo, its chief conductor, Paolo Carignani, made the strings "sing" with an eloquence that belied the popular prejudice that "Tosca" has no moments of quiet to offset all its horrors. In contrast, the climactic moments were finely chiseled, never massive or clumsy. And between the extremes of gentleness and hardness an entire world of inner colors and voices was revealed, full of feverishly pulsing rhythmic figures that contrasted with the facade of sound and fury. And the palpable tectonic tension of intersecting, harmonically ambiguous movements -- the modern element in Puccini's musical language -- lent structure to the soundscape. The impressive performances of the singers in the three leading roles gave the lie to the prejudice that "Tosca" is a horror-laden historical melodrama, staffed with static characters and bent only on producing cheap thrills. Between the bewitching bel canto tones at one extreme and the scream at the other, Maria Pia Ionata's Tosca, Martin Thompson's Cavaradossi and Claudio Otelli's Scarpia left so much room for individual characterization that Kirchner's sometimes hyperrealistic psychological view of the subject matter was vindicated once again as one valid interpretation among many. Their wealth of tints and shadings, especially when it went beyond the limits of pure bel canto, also underscored the moment in Puccini's music when bel canto itself begins to question its own validity. Both as singers and as actors, all three played their parts perfectly on several levels: in the self-portrayal of art on the private and the political stage, in the person of the eccentric diva, in the painful clash of free thinking and the reign of terror as experienced by the fundamentally apolitical painter, and in the case study of the neurotic eroticism of power as presented by the chief of police. Here, gestures and glances spoke an eloquent language. Copyright © Frankfurter Allgemeine Zeitung 2001
|

10. September 2001 Die Spirale von Liebe und Tod Von ELLEN KOHLHAAS So realistisch ist Giacomo Puccinis Oper "Tosca", daß das Libretto für jeden Akt einen Originalschauplatz in Rom und eine Handlungszeit am 17. und 18. Juni 1800 angibt. Und Cesare Angelotti hat wirklich gelebt, als Konsul von Napoleons Besatzungsmacht in Rom. Die erfundene Geschichte vom Geheimpolizeichef Scarpia, der aus politischem und erotischem Trieb den Maler Mario Cavaradossi und die Sängerin Floria Tosca zugrunde richtet, hat also ihren historischen Hintergrund. Als experimentellen Kitzel konnte man dies nachempfinden, als Brian Larges "Tosca"-Film 1992 von den authentischen Schauplätzen Roms zur originalen Zeit im Fernsehen ausgestrahlt wurde - der fatale dritte Akt also im Morgengrauen. Doch im Film wurde eine Wirklichkeit suggeriert, die in der Oper trotz ihres "Verismo" Fiktion ist; ihr Kunstwerkcharakter wurde um der Sensation willen übersehen. Gerade in "Tosca" aber stellt die Kunst sich selbst dar: im Gefühlstheater des ersten Akts, als die Primadonna ihre verhängnisvolle Eifersucht zur Schau stellt; in ihrer Festkantate, ihrem Kunstbekenntnis ("Vissi d'arte") und ihren Haßausbrüchen vor Scarpia, der dies zynisch hingerissen für bestes Theater hält: "Auf der Bühne war Tosca nie tragischer!"; im dritten Akt, als Tosca ihren Geliebten täuschend echtes Sterben lehrt. Auch die Kirche, im Komplott mit der Staatsmacht, spielt Theater: mit Tedeum-Pomp und Glockenklang maskiert sie die weltliche Despotie. Das Theater auf dem Theater ist ein Thema in diesem vermeintlichen "Quälodrama" (Julius Korngold), die psychologische Innenseite ein anderes. Beide relativieren den vordergründigen Naturalismus eines Gruselschockers. In ihrer Frankfurter "Tosca"-Inszenierung haben Alfred Kirchner und sein Bühnenbildner Karl Kneidl denn auch versucht, dem "Verismo" der lange von Schmähtiraden überschütteten Oper auf den Grund zu gehen. Vor allem wollten sie herausfinden, wie ein Gewaltsystem die Menschen unentrinnbar traumatisiert, sich selbst entfremdet. Bei den Eckakten versuchen Kirchner und Kneidl im Spiel von Raum und Requisiten wie im Abstrahieren des Bühnenbilds den Realismus zu überwinden. In der Kirche zieht der Flüchtling Angelotti (István Kovács) eine Vorhang-Wand hinter sich her - Signal der Angst-Hast. Zugleich kippt dadurch die Statik des Raums mit seinen schiefen Projektionen barocker Architektur aus dem Lot, und man ahnt so von Anfang an, wie auch die Menschen in der Todesspirale der drei Akte allmählich aus den Fugen geraten. Im letzten Akt sind Tosca und Cavaradossi nach körperlicher und seelischer Tortur endgültig außer sich. Die Euphorie verleiht beiden, im Spiel der Requisiten, Flügel. Mit Toscas Schleppe scheinen sie abzuheben. Kurz vor seiner Erschießung läßt der Maler, wieder Kind geworden, eine Papierschwalbe fliegen. Auf die Schein-Erlösung reagieren Mann und Frau verschieden. Cavaradossi verschließt sich, immer noch Schläge befürchtend, autistisch im Käfig seiner Arme: die Finger, infantil nägelkauend, verstopfen auch den Mund, als dürfe auch jetzt noch kein Wort heraus; Tosca löst sich in ihrer Kleiderwolke körperlich auf, wie im Flug tanzend. Sie muß sich nicht von der Plattform der Engelsburg stürzen; plausibler ist ihr Zusammenbruch auf der Bühne, während auf der Leinwand hinter ihr die Silhouette des Peterdoms kippt. Auch der leibhaftig den Schauplatz querende, markant singende Hirte (der Sängerknabe Kai Kluge), das von Bühnenarbeitern herbeigerollte Spielpodest und die auf der Bühne sichtbar geschlagenen Matutin-Glocken zu Aktbeginn durchkreuzen den theatralischen "Realismus" mit gegenwärtiger Wirklichkeit. Überhaupt zeichnet sich die Inszenierung durch eine psychologische Detailgenauigkeit aus, die ein Auftrumpfen mit krudem Naturalismus erübrigt. Nur in der Selbstentblößung des Triebtäters Scarpia reicht sie unnötig unter die Gürtellinie; der Halb-Striptease in der Kirche, blasphemisch genug, hätte als sexuelle Absichtserklärung gegenüber Tosca genügt, um so mehr, als sie bereits durch Scarpias Umarmung der Madonnenstatue vorbereitet war. Die Konsequenz war zu knallig für Kirchners diskrete Regie, die mit leitmotivartigen Verweisen statt mit Knüppeln arbeitet. So hängt Scarpia bei seiner Lustszene auf dem Malergerüst ähnlich im Gitter seiner Bibliotheksleiter im Palazzo Farnese - ein starkes Bild wie in Jean-Pierre Ponnelles Frankfurter "Tosca" von 1974: Hier hatte die Primadonna ihren Peiniger mit dem Messer in die Tischplatte gerammt. Anders als Ponnelle verzichtet Kirchner auf Kerzen und Kruzifix, die Requisiten der Aufbahrung des Toten: Tosca beugt sich bloß wie ausgeleert vor Erschöpfung über ihn, als könne sie ihre Tat nicht fassen. Dieser stille Spannungsmoment wird verstärkt durch das Herabsacken von Scarpias rechter Hand, als sei er wieder lebendig geworden, um sein Mordhandwerk selbst zu vollenden. Doch das besorgt auch ohne ihn der Automatismus des Staatssystems. Nicht zufällig ist Scarpias Amtszentrale, anders als in den weiträumigen Eckakten, ein enges, von Möbeln, Folianten und drallen barocken Fresken vollgestopftes Kabinett: Scarpia maskiert seine eiskalt kalkulierte Grausamkeit hinter Bildungsgütern, die das Menschenschlachten nicht verhindern. In dieser Umgebung wirkt Toscas "Vissi d'arte", der Lobgesang des L'art pour l'art, um so prekärer. Außerdem spiegelt die Enge den zwanghaften Triebcharakter des perfiden Taktikers, der mit seinen Opfern auf Tuchfühlung geht, um sie in Bonhomie und Berührung erst einmal einzuspinnen, ehe er sie zur Strecke bringt. Sex- und Todestrieb, Kunst- und Folterkammer kollidieren, überblenden einander auch in den filmschnittartigen, ständige Gefahr suggerierenden Licht- und Schattenspielen der Türen. Mit der Szene korrespondierte die eindringliche Leistung des Frankfurter Museumsorchesters. Chefdirigent Paolo Carignani ließ die Streicher in fließenden Tempowechseln so beredt "singen", daß der beliebte Vorwurf, "Tosca" kenne vor lauter Horror keine Ruhepunkte, widerlegt wurde. Im Gegenzug stachen die Ausbrüche messerscharf, nie massiv und plump. Zwischen Melos und Härte tat sich eine Welt an Innenfarben und Stimmen auf, von fiebrig pulsierenden rhythmischen Figuren im Widerstreit zur Fassade aus Klang und Drang. Erst durch die verdeutlichte tektonische Spannung einander durchkreuzender, harmonisch mehrdeutiger Bewegungen, das Moderne in Puccinis Tonsprache, härtete sich das Klangbild. Auch die imponierenden Sängerleistungen in den drei Hauptrollen entkräfteten das Vorurteil, "Tosca" sei ein gruseltheatralischer Historienschinken mit entwicklungslosem Personal, das bloß den Effekt bediene. Maria Pia Ionatas Tosca, Martin Thompsons Cavaradossi und Claudio Otellis Scarpia ließen zwischen betörendem Belcanto und Schrei so viel Raum für individuelle Charaktertöne, daß sich auch von daher Kirchners partiell über-realistische Psychologisierung des Stoffs als eine von mehreren möglichen Sichtweisen bestätigt. Diese Vielfalt von Tönungen und Schattierungen, gerade jenseits des puren Schöngesangs, pointierte zudem in Puccinis Musik den Moment, in dem sich der Belcanto selbst in Frage stellt. Als Sänger-Darsteller spielten alle drei perfekt ihre Rollen auf mehreren Ebenen: in der Selbstdarstellung von Kunst auf der privaten wie der politischen Bühne in der Gestalt der exzentrischen Diva, im schmerzhaften Zusammenprall von Freigeisterei und Terrorsystem beim eigentlich unpolitischen Maler, in der Fallstudie eines neurotischen Machterotikers beim Polizeichef. Gesten und Blicke redeten da eine deutliche Sprache. Copyright © Frankfurter Allgemeine Zeitung 2001
|
 10. September 2001 10. September 2001
Im Auge der Tyrannei Mit Carignani und Kirchner politisches Musikdrama statt Reißer: Nach 25 Jahren wieder eine "Tosca" in Frankfurt Von Hans-Klaus Jungheinrich Über ein Vierteljahrhundert gab es in Frankfurt keine neue Tosca; die letzte Inszenierung stammte noch von Jean-Pierre Ponnelle aus der Dohnányi-Zeit. Die zum Beginn der Abschiedssaison von Martin Steinhoff gebotene Version mit Paolo Carignani am Dirigentenpult und dem szenischen Team Alfred Kirchner und Karl Kneidl war packend und hochdramatisch . In ihrer aus höchstem orchestralen Klangraffinement hervorgetriebener Furiosität war die Aufnahme mit Maria Callas und Victor de Sabata unüberbietbar und auch ein unumstößlicher Hinweis auf den allerhöchsten künstlerischen Rang dieses Werkes. Unumwegig artikulierte auch Carignani den Ernst, die Leidenschaft, die Brutalität dieser Musik, ohne ihre reichen lyrischen Schönheiten (so die traumwandlerischen Violoncellosoli im dritten Akt) zu vergessen. Es wurde orchestral und chorisch zupackend musiziert, aber keineswegs undifferenziert. Karl Kneidl schuf für die drei Akte drei ganz verschiedene Bühnenbilder. Zu Anfang ein von Gerüsten und Plastikvorhängen verstelltes Kircheninnere; inmitten wüster Restaurierungsaktivitäten der Maler Cavaradossi mit seinen Utensilien. Der Mittelakt, Arbeitszimmer des Polizeichefs Scarpia, spielte in einem engen Bücherkabinett, dessen Wände über und über mit erotischen und jägerlichen Wandbildern bedeckt waren. Diese Scarpia-Höhle mit angrenzenden Folterräumen, sichtlich auch Topographie eines totalitären Ancien régime. Die Szenerie des Finalbildes öffnete sich ins Abstrakte, Imaginäre mit seinen riesigen, leeren Podest- und Wand-Rechtecken; seitlich und im Hintergrund die Glocken, die stimmungsvoll als akustische Zeichen des erwachenden Rom eingesetzt und hier also als Theaterelemente schön sichtbar gemacht sind wie der winzige Hirtenbub, der über die Szene läuft (Kai Kluge, ein souveräner Gesangs-Star). Anders als Rosalie, die Ausstatterin des vorletzten Bayreuther Rings, die auf der Bühne ihre eigene Kunstausstellung zelebrierte und die Regie Kirchners ins Abseits schob, brachten Kneidls Bilder diskrete, aber auch aus attraktive Vorlagen, die von einer durchdachten, ausgefeilten, auch psychologisch gewaltig angeheizten Personenregie genutzt werden konnten. Die historischen Fixpunkte der Handlung sind im Libretto klar markiert. Rom zur Zeit der italienischen Eroberungszüge Napoleons, die der klerikalen Tyrannei im Lande ein Ende zu bereiten versprechen. Ungeduldig begrüßen die Intellektuellen den Vormarsch der bürgerlichen Freiheitsideen; der Maler Cavaradossi wird im Text ausdrücklich als "Voltaireaner" bezeichnet (ein Schimpfwort im Auge des Papststaates). Tosca, Sängerin und Cavaradossis Geliebte, ist eine gefühlsbetonte, auch zu Eifersucht neigende Frau, woraus sich eine Dynamik entwickelt, die allen drei Hauptfiguren den Tod bringt. Die dritte, Scarpia, geht ebenfalls an der Intrige zugrunde, die er einfädelt in dem grandiosen ersten Aktschluss, der sich über einem chorisch sich aufreckenden Te-Deum aufbaut, basierend auf einem Quint-Ostinato , beklemmendes Klangsymbol der Aussichtslosigkeit der sich anbahnenden Katastrophe. Es bedarf bei deren Kolorierung keiner kulissenhaften Historizität . Das Stück funktioniert plausibel auch mit dem zeitlos-modernen Outfit der Personen (Kostüme: Margit Koppendorfer). Zum raschen Rendezvous mit Cavaradossi in der Kirche tritt Tosca mit legerem weißen Hosenanzug auf. Umso anrührender mutet die hier schon aufblühende Liebeslyrik an: Maria Pia Ionata singt die Figur ohne posenhafte Theatralik, mit kernhaft klarer Intonation und einer beweglichen, in allen Lagen gut abgetönten tessitura. Martin Thompson als tenoraler Partner entfaltet bedachtsam Kraft auch in den vehement aufleuchtenden Höhenlagen, entwickelt die Partie aber ohne Eitelkeit aus den sich steigernden dramatischen Situationen heraus. Neu gesehen ist der Scarpia von Claudio Otelli, einer markanten, des jähen Aufbrausens fähigen Baritonstimme. Scarpia ist hier eher ein borgiahaft genussfähiger Macho, bei dem Machtausübung und Sex ineinander übergehen, grifffest in der Wahl seiner Objekte, seien es eine in zärtlicher Grobheit umschlungene Marienstatue, ein Folteropfer oder der eigene Körper, den er am ersten Aktende in phantasmagorischer Vorfreude auf die Vereinigung mit Tosca entblößt - eine drastisch-onanistische Geste, die im Publikum fremdartig antönen mochte, aber im Zusammenhang legitim war. Dank der durchweg hervorragenden vokalen Leistungen (auch bei prägnanten Nebenrollen wie dem Angelotti von István Kovács und dem Mesner von Carlos Krause) war die Sängeroper Tosca keineswegs vernachlässigt. Aber auch die leicht als isolierbare Intarsie misszuverstehende Cavaradossi-Arie im Finalakt hatte in dieser Aufführung ihr präzises dramaturgisches Gewicht, war bereits flankiert von den Umtrieben der kafkaesk zwischen Komik und Gefährlichkeit mitagierenden Exekutantentruppe, die sich an ihrer Arbeit sadistisch weidete. Das anschließende Duett mit Tosca war ganz ins Traumhafte entrückt, und im Moment der Erschießung hantierte Cavaradossi mit einem Papierflieger. Grell dröhnte die Wirklichkeit in den Traum, und die Wucht dieses Todes brachte sogar die auf die Rückwand projizierte Petersdomkuppel zum Umkippen. Tosca, kein brutaler Reißer, sondern ein bitteres Musikdrama um Zwang und Freiheit, politisch aktuell wie je . Im Oktober geht es in Frankfurt mit Madame Butterfly weiter. Die zweite Saisonhälfte, wer hätte diese kühne Wendung noch erwartet, steht im Zeichen zeitgenössischer Opern. Copyright © Frankfurter Rundschau 2001
|

10. September 2001 Eifersucht, Gewalt und Tod Buhsturm bei Premiere von Puccinis „Tosca" in der Frankfurter Oper Von Klaus Trapp Die Frankfurter Oper hat ihr Herz für Puccini entdeckt. Nach „La Bohème" (1997) und „Manon Lescaut" (1999) eröffnete jetzt die Inszenierung der „Tosca" die neue Spielzeit, und bereits am 27. Oktober soll „Madame Butterfly" folgen. Gibt es damit eine veränderte, aktuelle Sicht auf Puccinis Verismo? Alfred Kirchner als Regisseur geht behutsam vor, seine Tosca-Version hält sich recht eng an die Vorgaben des Librettos und folgt in der Personenführung getreu den Schwingungen der Musik, bei der dramatisches Auftrumpfen und lyrisches Verweilen unmittelbar nebeneinander stehen. Neue Wege versucht Kirchner jeweils in der Zuspitzung der drei Akte zu gehen, die er auf die knappe Formel „Eifersucht, Gewalt und Tod" bringt. Im ersten Akt durchschneidet ein mehrfach verzweigtes Malergerüst den Kirchenraum (Bühnenbild: Karl Kneidl), die Personen suchen hin- und herirrend gleichsam nach einem Ausweg aus dem Labyrinth ihrer Gefühle, bis schließlich Scarpia, der lüsterne Polizeichef, sich in erotische Fantasien versteigt und sich die Kleider vom Leib reißt - eine Szene, die einen Buhsturm der Entrüstung entfesselt. Beklemmend gelingt der zweite Akt, wenn im Arbeitszimmer Scarpias, das mit üppigen Fresken und alten Folianten dekoriert ist, Folter und Mord aufeinander folgen. Da wird hinter dem grausigen Geschehen die vielschichtige Psyche der Tosca spürbar, die hin- und hergerissen wird zwischen ihrem Peiniger und dem Geliebten. Mit der bühnenfüllenden Plattform der Engelsburg im dritten Akt weitet sich der Blick, doch die Inszenierung konzentriert sich auf die tragischen Ereignisse: die Erschießung Cavaradossis und den Selbstmord Toscas. Das Ende bleibt in der Schwebe, als scheue der Regisseur die allzu krasse Geste; Tosca stürzt sich nicht in die Tiefe, sondern bricht tot zusammen, die Silhouette der Peterskuppel am wolkenverhangenen Himmel verschwindet schlagartig - ein etwas schiefes Symbol für das sinnlose Sterben. Die stärksten Eindrücke gehen von Paolo Carignanis musikalischer Deutung aus: Der Dirigent schärft die schneidenden Akkorde, die aggressiven Rhythmen, und er lässt andererseits die Kantilenen aufblühen, entlockt etwa den Solostreichern ätherische Klänge, ohne indes der nahe liegenden Sentimentalität nachzugeben. Die Sänger tragen dieses Konzept mit, auch in darstellerischer Hinsicht. Maria Pia Ionata überzeugt als wandlungsfähige Tosca mit ihrem hoch dramatischen Sopran, den sie aber auch zu zartem, innigem Ausdruck hin verschlanken kann. Martin Thompson setzt seinen strahlenden Tenor dosiert ein, um die zunehmende Gebrochenheit der Figur glaubhaft zu machen. Claudio Otelli als Scarpia kontrastiert wirkungs- und sinnvoll Gewaltsamkeit und Verführungskunst, bis in den Klang seines flexiblen Baritons hinein. Eindrucksvoll auch Carlos Krause in der Partie des Mesners sowie das Solistenensemble, das bis in die kleinen Rollen homogen besetzt ist. Schlagkräftig in musikalischer wie szenischer Form wirken die von Andrés Máspero einstudierten Chöre. Das Premierenpublikum feierte einhellig die Sänger, den Dirigenten und das Orchester. Regisseur und Bühnenbildner ernteten nur geteilte Zustimmung. |

10. September 2001 Die nackte Brust wäre nicht nötig An der Frankfurter Oper hatte Puccinis "Tosca" in der Inszenierung von Alfred Kirchner Premiere. Von Michael Dellith Mit der ,Boheme' wollten wir Tränen ernten, mit der ,Tosca' wollen wir das Gerechtigkeitsgefühl der Menschen aufrütteln und ihre Nerven ein wenig strapazieren. Bis jetzt waren wir sanft, jetzt wollen wir grausam sein." Puccini hatte diese Aufforderung an seinen Librettisten Giuseppe Giacoso in die Tat umgesetzt und mit „Tosca" eine Oper geschaffen, die wie nie zuvor allgemein-politische und individuell-psychologische Vorgänge wie Liebe, Hass und Eifersucht in Verbindung mit Diktatur, Korruption und Sadismus in drastischer Weise auf die Bühne bringt. Glücklicherweise ließ sich Kirchner bei seiner Frankfurter Regiearbeit nicht dazu verleiten, die „Tosca" auf einen blutrünstigen Opern-Schocker zu reduzieren. Vielmehr versuchte er, im Einklang mit Karl Kneidls Bühnenbild - im ersten Akt eine doppelbödige Gerüstkonstruktion im simulierten Kirchenraum, im zweiten Akt Scarpias klaustrophobisch-enges Kabinett, Machtzentrale, Kunst- und Folterkammer zugleich, und im Schlussakt eine freie Fläche mit schiefer Ebene und der Silhouette der Petersdom-Kuppel im Hintergrund - einem platten Naturalismus vorzubeugen. Mit Versatzstücken aus der Realität sollen die inneren psychologischen Vorgänge hinter der äußeren Handlung sichtbar gemacht werden. Gleichwohl gelingt das nicht ohne Ausrutscher: Wenn Scarpia am Ende des ersten Aktes zum „Te Deum" in der Kirche den Oberkörper entblößt und sich in die Hose greift, ist das vollkommen überflüssig und macht alle Spannung, die durch die unmissverständlichen Andeutungen erotischer Phantasien in Musik und Text bereits aufgebaut wurden, zunichte. Überhaupt scheint Kirchner seinen Sängern in Momenten höchster emotionaler Erregung geradezu marionettenhafte, verkrampft-zuckende Bewegungen verordnet zu haben, womöglich, um deutlich zu machen, wie sehr die Figuren durch ihre eigene Triebhaftigkeit fremdbestimmt sind. Zur Musik passt diese unnatürliche Motorik nicht. Den überzeugendsten Beitrag zur Frankfurter „Tosca" leisteten am Premierenabend die Sänger und Instrumentalisten. Unter Paolo Carignani musizierte das Opernorchester sehr agil, dramatisch-aufgekratzt und klanglich ungemein farbig, wobei Carignani keine Schönfärberei betrieb, nichts glättete oder übertünchte, sondern das herausholte, was hinter der kantablen Fassade steckt. Tadellos und sehr geschlossen auch die stimmlichen Darbietungen: Maria Pia Ionata verkörperte eine moderne, selbstbewusste Tosca und offenbarte den ambivalenten Charakter dieser Titelfigur mit ihrem facettenreichen Sopran; Martin Thompson als Cavaradossi wartete mit sicherer und strahlkräftiger Höhe auf, und Claudio Otelli glänzte in der Partie des Polizeipräfekten Scarpia mit einem in allen Registern ausgeglichenen Charakterbariton. Am Ende gab es einträchtigen Jubel für die drei Protagonisten und für einen strahlenden Dirigenten Carignani; wohlverdienten Applaus für István Kovács in der Partie des Angelotti und Carlos Krause als Messner, ebenso für den bestens einstudierten Opernund Kinderchor, und Kai Kluge, der den Hirtenjungen glockenrein intonierte. Gespalten reagierte das Publikum hingegen auf Alfred Kirchner: Dem Regisseur schallten kräftige Buh- wie Bravo-Rufe entgegen. Auch das gehört zum Opern-Ritual. |
|
Von Thomas Tillmann Ein neuer Höhepunkt des Frankfurter Puccini-Zyklus hätte sie werden können, die Tosca-Neuproduktion, die vom Premierenpublikum in überwiegender Mehrzahl abgelehnt wurde, freilich nicht, weil der (für seine subtilen La Bohème- und Manon Lescaut-Deutungen am selben Ort gerühmte) Regisseur das ihm anvertraute Stück provozierend gegen den Strich gebürstet hätte, sondern weil man den ganzen Abend über das Gefühl nicht los wurde, Gleiches oder Ähnliches schon allzu oft gesehen zu haben - der im Programmheft zitierte Satz Attila Csampais, nach dessen Überzeugung "nun endlich auch die Aktualität und Modernität von Tosca zu erkennen und zu würdigen" seien, fand leider keine Berücksichtigung. Immerhin, Alfred Kirchner hat eng am Text inszeniert und den Hauptfiguren klare Konturen beigegeben, es gab auch einige wenige dichte Momente - den so große Empörung erregenden Griff des sich während des Te Deum seiner Kleider entledigenden Scarpias in die zu eng werdende Hose rechne ich nicht dazu -, aber insgesamt plätscherte die Handlung doch reichlich belanglos und allzu diskret vor sich hin, und das darf nicht passieren bei dieser ja durchaus Spannung atmenden Vorlage. Nicht weiter originell oder aufregend gerieten auch die wechselnden, von meinem seitlichen Rangplatz bedauerlicherweise nicht gänzlich einsehbaren, eher naturalistischen Bühnenbilder von Karl Kneidl, während die aktuellen Kostüme von Margit Koppendorfer - die Diva etwa erscheint in sportlicher weißer Hose mit passender Hemdbluse und leger zurückgegelten Haaren in modernem Rotton - wie ein Fremdkörper wirkten, zumal etwa durch das Zerreißen der Tricolore durch die Kirchenbesucher im ersten Akt die historische Fixierung des Stoffs beibehalten wurde. Die rechte Spannung wusste diesmal auch der viele Details hervorhebende und den Sängern glänzend zuarbeitende Paolo Carignani am Pult des durchaus delikat und differenziert musizierenden Museumsorchesters nicht zu entfachen, da hätte man sich manche Passage doch direkter, kraftvoller und mitreißender gewünscht. Maria Pia Ionata schonte sich keine Sekunde in der Titelpartie, weder szenisch noch vokal, wobei ihr die wilden Ausbrüche des zweiten Aktes weitaus mehr lagen als die Feinzeichnung etwa im zwar tadellos, aber nicht sehr raffiniert gesungenen "Vissi d'arte". Immerhin entlockte sie ihrem eigenwilligen, charaktervoll-reifen, nicht wirklich dramatischen, von mancher Unebenheit und nicht geringem Flackern befallenen, mitunter auch schrillen Sopran einiges an interpretatorischen Zwischentönen, wobei besonders die enorm durchschlagskräftige, sichere Höhe Erwähnung verdient. Ganz anders verhielt es sich mit Martin Thompson, dessen in der Mittellage durchaus klangschöner, dunkel-kräftiger Tenor sich leider in der hohen Lage, die merkwürdig belegt, eng und farblos klang, ja bei entsprechendem Orchestergegengewicht kaum noch hörbar war, nicht recht entfaltete. Es spricht nichts dagegen, die Partie des Scarpia einmal nicht mit einem älteren, eleganten Herrn zu besetzen, sondern mit einem stattlichen, jungen Sänger mit lässig herabfallenden Locken, der in erotischer Hinsicht eine wirkliche Konkurrenz zu dem von der Primadonna präferierten Maler darstellt; die Autorität eines bigotten, sadistischen Polizeichefs indes verkörperte Claudio Otelli nicht in ausreichendem Maße, sondern eher einen recht eindimensional gestrickten, Gläser und Stühle durch die Gegend werfenden, testosterongesteuerten Choleriker. Auch seine sängerische Leistung gab manchen Grund zum Klagen: Immer dann, wenn die Stimme an natürliche Grenzen kam, forcierte der Wiener seinen nicht besonders voluminösen Bariton bis hin zu tonlos-rauhem Brüllen und pseudodramatischem Sprechgesang, was mir nach kürzester Zeit immens auf die Nerven ging - ein paar wenige mezza-voce- und Pianoversuche konnten von diesem zentralen Negativum nicht ablenken. István Kovács war ein junger, attraktiver Angelotti, Carlos Krause ein herrlich trotteliger Mesner, Peter Marsh ein devoter Spoletta mit hellem, durchdringenden Tenor, und auch bei den übrigen Mitwirkenden gab es keine nennenswerten Ausfälle. Ein Sonderlob verdient Kai Kluge, der den Part des Hirten erstaunlich sicher und tonschön bewältigte.
Wenn eine Premiere wie die fünfzigste Repertoirevorstellung wirkt, haben die Verantwortlichen ihre Hausaufgaben nicht gemacht! Tosca Premiere in der Oper Frankfurt |