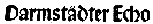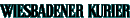|
15. April 2002 Staatstheater Darmstadt: „Madama Butterfly" von Giacomo Puccini mit einer überragenden Mary Ann Kruger in der Titelrolle Von Klaus Trapp Wenn Cio-Cio-San, genannt Butterfly, in den Armen Pinkertons stirbt, des skrupellosen Leutnants, der sie durch sein zynisches Verhalten in den Tod getrieben hat, dann schwenkt das gemeinsame Kind vergnügt ein amerikanisches Fähnchen. So spitzt Jörg Fallheier, Regisseur der Neuinszenierung von Giacomo Puccinis Oper „Madama Butterfly" am Staatstheater Darmstadt, den Zusammenstoß zweier Kulturen zu, wie er sich in dieser „Japanischen Tragödie" spiegelt. Es ist die Geschichte einer Geisha, die den leichtfertigen amerikanischen Offizier heiratet im Glauben, er meine es ernst mit der Ehe. Das erzählt Fallheier geradlinig, genau dem Libretto verpflichtet, einfühlsam auf Puccinis Musik eingehend. Dank der deutschen Übertitel ist der enge Bezug von Wort, Ton und Szene bei dieser Aufführung in italienischer Sprache gut zu verfolgen. Ohne gewaltsam zu aktualisieren, gelingt dem Regisseur eine zielstrebige Handlungsführung, die vom tändelnden Beginn unaufhaltsam auf das tragische Ende hinsteuert. Behutsam führt er die Personen in das tödliche Beziehungsnetz, porträtiert vor allem die Titelfigur mit psychologischem Einfühlungsvermögen. Dank der überzeugenden sängerischen und darstellerischen Leistung von Mary Anne Kruger erhält diese Butterfly anrührende und glaubhafte Züge. Der zerbrechliche Schmetterling gewinnt innere Größe, wenn er sich für den ehrenvollen Tod entscheidet. Kruger setzt ihren strahlenden Sopran flexibel ein, den Ausdrucksgehalt der Musik über bloße Tonschönheit setzend, und sie versteht es, die Wandlung der hingabebereiten Geisha zur selbstbewussten Frau glaubhaft zu machen – eine Leistung, die mit Recht bejubelt wurde. Wie ein Menetekel kündet ein großes, blutrotes Schriftzeichen auf dem Vorhang die verhängnisvollen Vorgänge an. Matthias Müllers Bühnenbild entspricht dem unpathetischen Charakter der Inszenierung. Ein Podium in Bühnenmitte, von einem schrägen Laufsteg durchschnitten, markiert das kleine Haus der Butterfly; mit Papier bespannte Holzrahmen, die als Wände und Türen dienen, schaffen japanisches Flair, kahle Äste vor blauem Himmel wirken wie eine Tuschezeichnung. Mit wenigen Änderungen wird das Bild den drei Akten angepasst, so dass ein geschlossener Gesamteindruck entsteht. Die von Ulrike Schörghofer entworfenen Kostüme bringen buntes Leben in die Inszenierung. Die Japanerinnen sind in malerische Kimonos gekleidet, wobei zarte Pastellfarben vorherrschen. Davon hebt sich das Kostüm Cio-Cio-Sans ab, das durch die Symbolfarbe Rot geprägt ist. Der quirlige Heiratsvermittler Goro, der reiche Freier Yamadori und die männlichen Familienmitglieder kommen in folkloristisch wirkenden Gewändern daher, während die Amerikaner im Stil der Zeitenwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gekleidet sind. Sparsam eingesetzte Requisiten wie Sonnenschirme, Fächer oder Lampions sorgen für fernöstliche Atmosphäre. Dass auch Puccinis Musik den Zusammenprall zweier Kulturen darstellt, vermittelt der erste Kapellmeister Raoul Grüneis. Er schärft mit dem Orchester des Staatstheaters die Gegensätze der im Jahr 1904 entstandenen Partitur, stellt etwa den Phasen, die durch die amerikanische Nationalhymne bestimmt sind, jene Abschnitte prägnant entgegen, in denen Anlehnungen an japanische Melodien dominieren. Diese auf Kontraste zielende Interpretation wirkt zu Anfang ein wenig grob, doch im Verlauf der Aufführung kommen die schillernden Zwischentöne stärker zur Geltung, die impressionistischen Farben, die Puccini in seiner Palette bereithält. Deutlich wird, dass neben weichen, fast sentimentalen Tönen eine Musik der Zukunft anklingt: Ganztonleitern, übermäßige Dreiklänge und harte Dissonanzen, die der Exotik ebenso wie der Dramatik dienen, weisen voraus auf neue Entwicklungen. Neben der überragenden Mary Anne Kruger gibt der Tenor Fernando del Valle der Partie des Marineleutnants Pinkerton klares Profil. Er vermeidet es geschickt, diese Rolle des Sextouristen, der seinem Lustgewinn alle moralischen Grundsätze opfert, ins Peinliche abgleiten zu lassen. In den berühmten Highlights – dem Liebesduett mit Mary Anne Kruger, dem Arioso „Addio, fiorito asil" – beweist er gepflegte Belkanto-Kunst. Die Figur des amerikanischen Konsuls Sharpless macht Anton Keremidtchiev zu einem markanten Gegenpart des leichtsinnigen Leutnants. Mit seinem profunden Bariton verleiht er den wiederholten Warnungen Nachdruck, überzeugend stellt er die verzweifelten, vergeblichen Versuche dar, die drohende Katastrophe noch abzuwenden. Eine feine, einfühlsame Studie gibt die Altistin Katrin Gerstenberger als Suzuki, Cio-Cio-Sans Dienerin. Sie lässt in Gesang und Gestik spüren, wie sie das Schicksal der Butterfly vorausahnt, ohne einen Ausweg zu finden. Dan Karlström als gerissener Heiratsvermittler und Bruce Miller als aufgeblasener Fürst Yamadori setzen behutsame komische Akzente. Der von André Weiss präzise einstudierte Chor, in dem die Frauenstimmen überwiegen, agierte klangvoll und gewandt, den Kreis der Freundinnen und Verwandten darstellend. Nach einer Gesamtdauer von zweidreiviertel Stunden gab es im Großen Haus begeisterten, mit Bravorufen durchsetzten Beifall für das Leitungsteam und das gesamte Ensemble, vor allem Mary Anne Kruger in der Titelrolle. |
|
15.04.2002 Puccini-Oper „Madama Butterfly"/Konventionell in Darmstadt Von Axel Zibulski Tapfer wedelt Butterflys Sohn mit dem Sternenbanner: Auf nach Amerika, zu Papa Pinkerton und Stiefmama Kate. Die eigene Mutter hat sich gerade erdolcht, doch das begreift der Spross einer tiefen japanischen Liebe (sie) und flüchtigen amerikanischen Eskapade (er) nicht, noch nicht. Schaut einfach nur drollig aus, der Kleine–und setzt ins Ende von „Madama Butterfly" (die Darmstädter belassen es beim italienischen Titel) einen putzigen Kontrapunkt, der dieses nur umso tragischer erscheinen lässt. Ein bewegender Einfall von Regisseur Jörg Fallheier, der Puccinis „Japanische Tragödie in drei Akten" am Staatstheater Darmstadt neu inszeniert hat. Ein Einfall von zu wenigen. Oft ist in Inszenierungen von „Madama Butterfly" der Konflikt der Kulturen hervorgehoben worden–das drängt sich fast schon zu deutlich auf, wenn ein amerikanischer Soldat auf fremdem Boden „America forever" singt. In seiner jüngsten Frankfurter Inszenierung ist Christof Nel einen anderen Weg gegangen, hat die Psyche der Protagonisten beleuchtet und dabei auch den Sohn nicht außen vor gelassen. Jörg Fallheier geht den Weg zurück. Von wegen Regietheater: In Darmstadt werden Blüten gestreut, japanische Schirmchen aufgeklappt, Fächer geschwungen. Die Personenführung bleibt, bis auf die gebeugt schlurfenden Diener, konventionell. Butterfly ruscht auf den Knien. Butterfly spielt mit ihrem Sohn. Und der Damenchor tritt auf wie zur Anmeldung des 1. Geisha-Clubs Südhessen e.V. Immerhin wahren die japanischen Kostüme von Ulrike Schörghofer Geschmack. Die in Reichweite liegende Grenze zum Kitsch überschreitet auch Matthias Müllers Bühnenbild nicht: Eine Terrasse, hinten ein veräderter Zweig, vorne ein Laufsteg zur Rampe. Dort singt Mary Anne Kruger ihre Arie „Un bel dì vedremo" hinreißend. Ihr Sopran trägt in allen Lagen und verfügt über eine lyrische Geschmeidigkeit, ein leuchtendes Piano, dass man gespannt sein darf, auf welchen größeren Bühnen die Sängerin in Zukunft zu erleben ist. Zudem gelingt ihr ein ideales Porträt der Butterfly, mit sanftem Pathos in der Liebesszene des ersten Akts, aber auch selbstbewusst herben Tönen gegenüber dem glücklosen Werber Yamadori (rau: Bruce Miller). Dem festen Tenor von Fernando del Valle (Pinkerton) sind nur wenige Momente des Forcierens anzumerken, Anton Keremidtchiev leiht dem Leutnant Sharpless seinen samtig-kultivierten Bariton. Am Pult des Orchesters errichtet Raoul Grüneis den Sängern ein sauberes wie nuanciertes Fundament. Auch wenn der „Summchor" im zweiten Akt heikel intoniert wird: Es ist die musikalische Seite, die diese Darmstädter „Butterfly" zum großen Abend werden lässt. Davon lenkt die Regie nicht ab, doch bedient sie eher das Klischee vom fernöstlichen Rührstück, als an die Sprengkraft des Sujets–immerhin verlässt eine junge Frau für einen Luftikus ihre Familie, ihre Religion –anzuknüpfen. |
|
egotrip.de april 2002 Puccinis "Madame Butterfy" in Darmstadt" Ja, es war ein wunderschöner Opernabend: ein- gängige, "süffige" Musik, brillante Stimmen und eine erschütternde Geschichte. Und doch war es eine recht konventionelle Inszenierung, die kaum über das ursprüngliche Libretto hinausgeht. Wer Musik "pur" genießen wollte, erlebte hier eine Sternstunde, wer eine neue Deutung des Stoffes erwartete, sah sich enttäuscht. Die Handlung ist schnell erzählt: der junge, leicht- sinnige amerikanische Marineleutnant Pinkerton lernt in Japan die Geisha Butterfly kennen, die aus einem einst reichen, jetzt verarmten Hause stammt. Da man sich nach japanischem Recht von seiner Frau durch bloßes Verlassen trennen kann, heiratet er sie sozusagen aus Spaß, weil er sie begehrt, und kehrt anschließend in die Staaten zurück. Butterfly, von ihrer eigenen Familie wegen der Heirat verstoßen, wartet drei Jahre zusammen mit ihrem kleinen Sohn auf ihn. Als er schließlich mit seiner neuen Frau eintrifft, um seinen unver- muteten Sprößling abzuholen, nimmt sie sich das Leben. Das Libretto birgt die Gefahr einer sentimentalen wenn nicht kitschigen Umsetzung auf der Opern- bühne. Die Einordnung dieser Oper in den Augen der "kritischen Intelligenz" nahm diese Gefahr schon immer als Charakteristikum und verbannte das Werk ins Seichte. Pucchini jedoch hat dazu eine tief gehende und an Facetten reiche Musik komponiert, die nie ins Süßliche abgleitet, sondern in den heiteren wie in den tragischen Momenten eine eigene Würde und Konsequenz ausdrückt. In dieser Musik liegt die eigentliche Qualität der Oper. Zu jedem Zeitpunkt liefert sie das genau passende Musikmaterial zur Handlung. Dabei fällt immer wieder auf, wie modern die Musik trotz ihrer offen- sichtlichen Schönheit ist. Die "moderne" Harmonik des frühen 20. Jahrhunderts verkleidet sich in ein- nehmenden Motiven und wird dadurch auch für den konventionellen Hörer genießbar. Darüber hinaus enthält Pucchinis Musik auch viel landestypisches Kolorit mit einer deutlichen Ten- denz zur Ironie. So werden Pinkertons Auftritte immer wieder mit Abwandlungen der amerikani- schen Nationalhymnse intoniert, deutlich, um nicht zu sagen: derb. Damit charakterisiert er das unsen- sible und neureiche Auftreten der Amerikaner, das schon damals den Europäern unangenehm auffiel. Im Gegensatz dazu setzt er bei den Butterfly-Sze- nen Instrumente und Klangfarben ein, die deutlich an japanische Musik erinnern, ja, Kenner werden in dem einen oder anderen Motiv japanischen Volks- weisen erkennen. Das ist natürlich gefährlich, dass es nach programmatischer Musik riecht, die ihre Wir- kung durch Imitation des Frenden zu erzielen sucht. Doch Pucchini setzt diese Elemente mit viel Feingefühl und immer im Kontext sei- ner eigenen Musik ein, so dass sie nie aufge- setzt wirken. Man nimmt diese japanische Einfärbung ohne Groll hin und betrachtet sie als glaubwürdige Charakterisierung der Umge- bung. Und auch hier setzt er Ironie hinzu, wenn er die neidischen Verwandten der - noch - glücklichen Butterfly auch in seiner Musik in hellen Tönen schnattern lässt. Hinter diesen Variationen seiner Musik kann man jeder Zeit ein Augenzwinkern erkennen, mit dem Pucchini und seine Musik eine gewisse Dis- tanz zum Bühnengeschehen wahren, die es vor der Sentimentalität bewahrt. Regisseur Jörg Fallheier ist bei seiner Insze- nierung keine Risiken eingegangen und lässt die Musik für sich sprechen. Im Gegensatz zu anderen Darmstädter Opern der letzten Jahre findet man hier keinerlei moderne Versatz- stücke wie Kostüme und Requisiten. Alles bleibt so, wie es auch 1903 bei der - durchge- fallenen - Preomiere gewesen sein könnte. Gerade die Vorlage des Amerikaners als schlicht gestrickten Imperialisten hätte sich für eine zeitnahe Interpretation geeignet, doch Fallheier geht diesen Weg nicht. Fast könnte man meinen, dass ihm allein die Auswahl dieser Oper zu diesem historischen Zeitpunkt Hinweis genug war, wenn es denn nicht gera- de ein Planungszufall war. Geradezu hand- greiflich wird dem Zuschauer die aktuelle Kritik an dem "american way of life", den es gegen böse Terroristen zu schützen gilt, vor Augen geführt, jedoch nur implizit durch die Hand- lungsweise des gefühllosen Pinkerton. Weiter gehende Parallelen zieht die Inszenierung nicht. Nun lässt sich natürlich eine solche Interpreta- tion einer sich anbietenden Vorlage nicht als nahezu zwangsläufige Konsequenz fordern, aber eine gewisse Aktualisierung des Stoffes hätte man sich schon vorstellen können. Fallheier jedoch vertraut vollständig auf die klassische Wirkung der Oper: Rührung durch eine perfekt inszenierte und vorgetragene Handlung. Das gelingt ihm auch, aber er lässt es bei der Erfüllung der Erwartungshaltung bewenden. Und damit bestätigt er in gewis- sem Sinne die alte Kritik der Intellektuellen, die das Stück schon immer als Kitsch abge- tan hatten. Doch nicht die Oper selbst trägt die Schuld an dieser - im Übrigen selbstge- fälligen Kritik - sondern eine zu enge Führung am Libretto, das letzten Endes das Unglück einer verlassenen Frau darstellt. Dieses indi- viduelle Schicksal ist jedoch in Literatur und Oper zu oft abgehandelt worden, als dass es alleine noch Neuigkeitswert besäße. Wie gesagt, man hätte dieser Handlung an der Bruchlinie zweier Kulturen durchaus neue Aspekte abgewinnen können, doch darauf hat Fallheier verzichtet. Doch zurück zu der Wirkung auf das Publikum und die wirklich beeindruckenden Leistungen auf der Bühne. Da ist in erster Linie Mary Anne Kruger zu nennen, die ihr Repertoire in der Rolle der Butterfly voll ausspielt. Ihre klare und doch sehr warme und weiche Stimme wurde allen Seelenlagen gerecht, und vor allem die in dieser Oper leisen und verinner- lichten Stellen kamen mehr als überzeugend zur Geltung. Diese Frau überrascht immer wieder durch ihre Wandlungsfähigkeit und die Ausdrucksvielfalt ihrer Stimme. Es war ein wahrer Genuss, ihr zuzu- hören und auch zuzuschauen, denn auch schau- spielerisch überzeugte sie in dieser Rolle. Fernando del Valle überzeugte durch eine raum- füllende, in allen Lagen sichere Stimme und seine Präsenz. Seine Wiedergabe des in seiner jungen- haften Gedankenlosigkeit rücksichtslosen Leut- nants Pinkerton traf den Nagel auf den Kopf. Flegelhaft spuckt er den ihm unbekannten Tee aus und verlangt lautstark nach Whiskey, und dem Konsul erzählt er ebenso deutlich, dass das Ganze ja nur ein Spaß sei und er sich jederzeit von Butterfly trennen könne. Das hört sich gar nicht einmal zynisch sondern eher naiv an, so wie ein Kind, dass sein neues Spielzeug bis zum Bruch austesten will. Fernando del Valle gelingt es, diese selbstgefällige Naivetät und die "Hoppla jetzt komm ich"-Mentalität auszudrücken. Ein weitere überzeugende Vorstellung gab wieder einmal Anton Keremidtchiev, hier in der Rolle des mahnenden und um Schadensbegrenzung bemüh- ten Konsuls. Große Charakterstudien sind ihm in dieser Rolle nicht vergönnt, doch in der Premiere zeigte er wieder einmal seine stimmliche Vielfalt und wohl abgewogene Präsenz. Dan Karlström gab einen quirligen und hinter- hältigen Heiratsvermittler Goro, der sich von allen beschimpfen aber nie unterkriegen lässt. Seine Stimme hatte an einigen Stellen leichte Schwächen, aber das machte er mit seinem schauspielerischen Einsatz mehr als wett. In weiteren Rollen agierten Katrin Gersten- berger als Suzuki, Butterflys Kammerdienerin, Barbara Schramm als Pinkertons amerikani- sche Frau und Thomas Fleischmann als Onkel Bonzo. Sie alle füllten ihre Rollen über- zeugend aus, hatten aber zum Teil nur geringe Möglichkeiten, ihre Stärken auszuspielen. Besonders hervorzuheben ist das Orchester, das unter der Leitung von Raoul Grüneis Pucchinis Musik mit außerordentlicher Präzision und Liebe zum Detail präsentierten. Von Anfang an wirkten Orchestergraben und Bühne wie aus einem Guss geformt. Dies ist auch deswegen bemerkenswert, weil Pucchinis Musik durchaus nicht immer gefällig und eingängig ist, sondern sich durch abrupte Wechsel von Tempo und Volumen auszeichnet. Diese Wechsel spiegeln den falschen Schein der vermeintlich heilen Welt Butterflys wider und zerstören immer wieder eventuell aufkommende Euphorie. Raoul Grüneis und sein Orchester meisterten diese Brüche hervorragend und trugen damit erheb- lich zum tiefen Gesamteindruck bei. Bühnenbild und Kostüme brachten japani- sches Kolorit auf die Bühne, wobei eine halbtransparente Schiebewand die Vorder- bühne gegen den Hintergrund abschirmte. Bei den Köstümen gab es laut Aussagen von Kennern einige Flops, zum Beispiel wenn die japanischen Männer trippeln (tun nur die Frauen!) oder einen Zopf tragen (das sind die Chinesen). Das sind jedoch Details, die dem Gesamteindruck keinen Abbruch tun. Dieses japanische Kolorit entsprach, wie bereits gesagt, den Erwartungen des Opernpubli- kums, das bei "Madame Butterfly" - bitte schön - japanische Kostüme und das zugehö- rige Ambiente genießen möchte. Fallheier "gab dem Affen Zucker", und das Publikum dankte es ihm mit begeistertem Applaus und - in der letzten Zeit in Darmstadt eine Aus- nahme - ohne einen einzigen Buh-Ruf! Der Besuch dieser Oper lohnt sich allein schon wegen der Musik und den hervorragen- den Leistungen des Ensembles. |