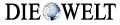|
DER TAGESSPIEGEL Die Kaskaden der Fantasie Nein, keine „Publikumsbeschimpfung". Aber es gab auch Menschen, die diesen atemberaubend kurzweiligen, tausend Purzelbäume schlagenden Opernabend überhaupt nicht kurzweilig oder atemberaubend fanden. Die keine Miene verzogen, als das liebreizend blonde Christenmädchen Almirena Ende des ersten Aktes ausgerechnet von einem riesigen, dottergelben Stoffküken ins Zauberreich der bösen Armida entführt wird. Die sich im zweiten Akt auf ihren Barockschlips getreten fühlten, als jene böse Armida, um den Kreuzritter Rinaldo zu betören, sich in eben jene liebreizende Almirena verwandelt – und der ganze erotische Zauberspuk darin besteht (genial einfach! einfach genial!), dass die Sängerin A in den vor einer Palmenstrand-Fototapete parkenden Mercedes einsteigt, und die Sängerin B gleich wieder auf der anderen Seite aussteigt. Und bestimmt stießen sich diejenigen, die sich fast viereinhalb Stunden lang so gar nicht amüsieren konnten oder wollten, auch an dem echten Maulesel, dem Nigel Lowery und Amir Hosseinpour im dritten Akt eine kleine Pappmaché-Rakete umschnallen, und daran, dass aus dem Turm des nunmehr bühnenbeherrschenden Kirchleins plötzlich die Heilige Familie grüßt, Maria, Josef und das Kind. Kitsch? Trash? Blanker Zynismus? Am Ende der Oper und des Krieges steht der Sieg der ach so tapferen Christenheit über die Heiden, der Guten über das Böse, des rechten Glaubens über jede schwarze Magie. Und am Ende dieses Berliner Premierenabends wartete ein selten inbrünstiges Konzert der Buhs und Bravi, der Bravi und Buhs auf das Regieteam. Was aber ist es genau, das die Gemüter so spaltet und erregt? Warum lachen die einen Tränen und finden sich erfrischt wie nie von Händels Lust an der Farce, von Lowerys Lust am Spiel und von René Jacobs Lust am musikalischen „Lärm"? Und warum klagen die anderen offenbar just das Gegenteil von all dem ein – den Ernst der Lage im Stück (das Libretto lehnt sich an Tassos „La Gerusalemme liberata" an) wie in Händels Londoner Ästhetik aus dem Jahr 1711, die strengen Gesetzmäßigkeiten des barocken Stils und die klingende Wahrheit hinter allen Affektgebirgen? Händels „Rinaldo" ist eine Koproduktion der Berliner Staatsoper mit der Opéra Montpellier und den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. An keinem der beiden Partner-Orte, die die Produktion bereits im vergangenen Sommer zeigten, war von Skandal, Empörung oder größeren Entrüstungen die Rede. In Berlin soll also wieder einmal alles ganz anders sein? Die erst vor Jahresfrist mit Haydns „Il mondo della luna" mühsamst wiederbelebte Barockschiene der Lindenoper als sicher geglaubte Bank, der man das Grelle und allzu Experimentelle vielleicht doch lieber verweigerte? Erstaunte, fragende Gesichter auch bei der weither angereisten Prominenz im Saal, von Münchens Staatsintendant Peter Jonas, einem bekennenden Händel-Fan, bis zu der amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag, die gerade ihren 70. Geburtstag in Berlin feierte. Erster Versuch einer Erklärung: Man unterstellt Nigel Lowery, dass er seine Sache nicht ernst nimmt. Dass er sich einen Jux macht aus dem Kampf des Ritters Rinaldo um das tugendhafte Weltbild und die große tugendhafte Liebe. Dass er auf Kosten auch und gerade der „Feinde" und morgenländisch-muslimischen „Fremden" im Stück, der Zauberin Armida nämlich und ihres Geliebten Argante, bloß Gag an Gag an Gag strickt. Und sich darin über die Maßen selbst gefällt. Und den Sturzbach seiner Einfälle lustig sprudeln lässt und sich um gar nichts mehr schert. Mag sein, auf den ersten Blick jedenfalls. Denn Lowery definiert Händels Gotteskrieg vom Stückvorhang an (eine riesenhafte männliche Barbie mit MP im Anschlag) als poppig-comichaft und kindisch-kindlich, und lässt auch immer wieder in einer Art Kasperletheater spielen, in dem ein paar Puppen so lange aufeinander einhauen, bis Köpfchen und Gliedmaßen fliegen. Der zweite, genauere und geduldigere Blick aber zeigt: Im Nu sind es die Puppenspieler selber, die sich in den Haaren liegen. Und am Ende haben alle, die Guten wie die Bösen, einmal persönlich Hand an die Waffe gelegt. Händels Musik jedenfalls, die den „Heiden" die weitaus komplexeren, ergreifenderen Arien beschert als den Christen und so alles Schachbretthafte des Plots frühzeitig Lügen straft, sie öffnet uns auf dieser szenischen Folie buchstäblich ihr Herz. Und plötzlich vernimmt man – den fabelhaft mutigen Instrumentalisten des Freiburger Barockorchesters sei Dank! – im Vogelgezwitscher des Liebeswebens immer auch das Rasseln der Kriegstrommel und mitten im ärgsten Kriegslärm den Pulsschlag der Sehnsucht. Mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit wahrt René Jacobs, Feuerkopf und Analytiker, hier die Balance: immer beredt und im Gestus klar, aber die Dinge niemals überzeichnend, nie nur parodistisch. Und so gerät denn selbst eine eher tränenreiche Nummer wie Almirenas „Lascia ch’io pianga" – bei allem Ernst, aller Größe! – zum augenzwinkernden Kabinettstückchen. Vor güldenem Vorhang sitzt Almirena alias Miah Persson an der Rampe und lässt ihren blaugrünen Meerjungfrauenschwanz so verführerisch in den Orchestergraben baumeln, dass der treudumme Argante nicht anders kann und sie auf der Stelle lieben muss … Zweiter Versuch einer Erklärung: Es ist das vermeintlich oder tatsächlich Politische im Stück wie in der Inszenierung, was dieser Tage übel aufstößt. Amerika rüstet sich für einen Krieg gegen den Irak, in Israel sterben die Menschen – und Lowery und sein Co-Regisseur und Choreograf Amir Husseinpour münzen die Wunderwaffe des christlichen Magiers (Dominique Visse) in einen leibhaftigen Selbstmordattentäter um. Von diesem bleiben – Krach, Bumm, Bäng! – nur ein paar blutige Stiefelstümpfe übrig, und schon wird alles, siehe oben, endlich gut. Eine Lesart, die sich über das Grauen der echten Bilder unbotmäßig erhebt? Wer solches denkt, missachtet die Musik – und das Ensemble, das sich wie aus einem Guss um die jungherb timbrierte, koloraturensichere Silvia Tro Santafé in der Titelpartie schart (Lawrence Zacco als Goffredo, Christophe Dumaux als Eustazio, Noemi Nadelmann als Armida). Andererseits aber unterschätzt er auch Lowerys sybillinische Weisheit, den clownesk-grotesken Tiefsinn der Inszenierung. Wenn sich Armida im Finale des zweiten Aktes zu „Vo’ far guerra" in einem hinreißenden Danse macabre an ihren eigenen Zaubertränken berauscht und zu einem Cembalo-Solo mit zwei ins Krankhafte auswuchernden Händen um sich schlägt, dann heißt das auch: Krieg fängt immer im Lächerlichen und Harmlosen an. Zeigen wir nicht auf die anderen. Wehren wir unserer eigenen Anfälligkeit. |
|
Jerusalems Tore Von Klaus Geitel
Als Fritz Kortner, der Regisseur, einmal dem aufgekratzten Curt Bois, über den er sich scheckig gelacht hatte, hinfort alle Witzeleien auf der Bühne verbot, war Bois perplex. "Aber Sie haben doch immerfort herzlich gelacht", gab er zu bedenken. "Ja, aber weit unter meinem Niveau", replizierte der strenge Kortner. O holde Schizophrenie! Dein Name ist Oper. Unter den Linden lachte sich das Publikum lauthals und jubelnd durch die fast viereinhalb Stunden des "Rinaldo" von Georg Friedrich Händel, feierte zwischendurch alle Mitwirkenden immer wieder nach Verdienst und Kräften, brach aber zum Schluss, als die beiden Anstifter des Vergnügens, Nigel Lowery und Amir Hosseinpour, vor dem Vorhang erschienen, überraschenderweise in eine wahre Orgie der Buhrufe aus, als habe man sich urplötzlich entschlossen, sich für das eigene Vergnügen zu schämen. Aber immerhin ist es schließlich seit eh und je besser, eine Aufführung zu durchlachen als zu durchgähnen, was Händels Opern mit der Zeit aus dem Repertoire trieb. Sie wurden stilvoll als auskomponierte Schlafpillen serviert. Natürlich haben die beiden angeblichen Missetäter die Oper in ein Tollhaus der Überraschungen verwandelt. Sie kommen durchaus nicht leisetreterisch zur Sache. Sie frotzeln inszenatorisch herum. Sie verhohnepiepeln nach Kräften die heldische Liebessaga vor den Toren Jerusalems und alle mit ihr verbandelten Phantasmagorien. Sie legen den Sumpf des herrlich auskomponierten, köstlichen Liebesschlamassels auf slapstickartige Weise trocken. Aber sie verstehen sich auch darauf, auf überwältigende Weise zu zaubern, wie es vor ihnen wahrscheinlich einzig Armida verstand. Die holde Almirena wird in ein wahrhaft unausweichliches Gefängnis gesteckt. Armida hext ihr einen Fischschwanz an den entzückenden Leib - und dies auch noch auf dem Trockenen, fernab vom Meer. Dann sieht sich die im Fischleib Gefangene rücksichtslos in den Kofferraum eines alten Mercedes gestoßen. Wie Daimler zu Chrysler so verwandelt sich Armida immer wieder zu ihrer Widersacherin in punkto Charme. Der herumflitzenden Überraschungen ist kein Ende. Freilich - wenn die Herren Inszenatoren anfangen, mit Raketenangriffen auf moslemische Heiligtümer zu drohen, ist der Spaß zuende und eine Schwelle überschritten, hinter der es kein Lachen mehr gibt. Es geht schließlich um die Befreiung Jerusalems, wie sie Torquato Tasso in seinem immer erneut ausgeschlachteten Epos vom "Gerusalemme liberata" beschrieben hat, und um die ihm eingebundene Liebesgeschichte zwischen Ritter Rinaldo und Armida, der Zauberin. René Jacobs steht dem phänomenalen Freiburger Barockorchester vor (die Staatskapelle ist überdies unter Barenboim auf triumphaler Spanien-Tournee) und lässt die Instrumente geradezu jauchzen und kosen. Außerdem verfügt das Ensemble über einen Cembalisten, der seine Verwandten in einem Ameisenhaufen haben muss, so lebhaft, endlos und unterhaltsam kribbeln ihm die Notenketten unter den Fingern hervor. Eine Luxusbesetzung steht und singt und spielt mit Lust und Bravour auf der Bühne. Die entzückende Silvia Tro Santafé ist der süße, pummelig-rundgesichtige Titelheld mit dem Wunderalt in der Kehle. Sie macht jede Arie zum Fest. Noemi Nadelmann, nabelfrei, ist die berückende, hochvirtuos dramatische Zauberin: eine Figur aus dem Tollhaus erotischer Phantasie - einfach zum Fingerlecken und zum Applaudieren. Miah Persson ist die wonnig sanfte, allseits Geliebte, der Händel eine seiner populärsten und denkwürdigsten Arien in den Mund gelegt hat. James Rutherford darf glanzvoll und lustig zeigen, dass bei Händel selbst Bässe zu ihrem Recht kommen und nicht einzig Countertenöre wie Lawrence Zazzo oder der sanftmündige Christophe Dumaux. Mit einem Wort: Die Aufführung klingt wie das Paradies, das Armida herbeizaubern will. Es gelingt ihr, dank René Jacobs und aller Mitwirkenden. Staatsoper Unter den Linden, Mitte. Tel.: 203 54 555. Nächste Aufführungen: heute, 22., 24., 26., 29.1. |
|
Dieses Jahr in Jerusalem von Elmar Krekeler Fangen wir diesen Text mal mit ein paar populären Vorurteilen über Oper an und versuchen sie am lebenden Objekt zu widerlegen. Die Vorurteile: Oper ist langweilig. Oper ist irrelevant, weil sie nichts, aber auch gar nichts mit uns zu tun hat. Opernhäuser sind bloß noch dafür da, dass das Bildungsbürgertum in ihnen unendlich teure Totenfeiern zu Lebzeiten auf sich selbst abhalten kann. Drei hochsubventionierte von ihnen in einer finanzklammen Stadt? Blödsinn! Und nun die Widerlegung am lebenden Objekt. Das ist kurioserweise großzügig gerechnet stolze 300 Jahre alt und basiert auf einem noch sehr viel älteren Text von Torquato Tasso, der wiederum einen noch älteren Konflikt abhandelt, den nämlich zwischen den Kreuzrittern und den Moslems und den Juden um Jersusalem. Das lebende Objekt hört auf den Namen „Rinaldo", war Händels erste für London geschriebene italienische Oper und ist derzeit – dirigiert von René Jacobs, inszeniert von Nigel Lowery und Amir Hosseinpour – in Berlins Staatsoper zu besichtigen. „Rinaldo" dürfte, als Mischung aus superernster Opera seria und nicht sehr ernster englischer Masque, schon 1711 kein allzu staatstragendes Ereignis gewesen sein. Lowery und Hosseinpour nehmen das sehr ernst und veranstalten einen sehr lustigen und sehr ernstzunehmenden Abend auf der Basis des schillernden Wechselbalgs. Dass die Geschichte vom Helden Rinaldo, der für seinen christlichen Feldherrn Goffredo um den Preis der Hand von Goffredos Tochter Almirena in den Krieg zieht zur Befreiung Jerusalems von der Herrschaft des moslemischen Königs Argante und dessen zaubernder Freundin Armina, zur Zeit genug Stoff für zeitgenössisches Musiktheater bietet, muss eigentlich nicht unbedingt betont werden. Es muss nur herauspräpariert werden. Lowery und Hosseinpour tun’s mit Verve, lassen in wunderbarer Siebziger-Ästhetik einen optischen (und aktuellen) Knallfrosch nach dem andern explodieren. Nichts wundert einen mehr nach einiger Zeit. Die Absurdität des ständig von Ruhm und Liebe und deren gegenseitiger Abhängigkeit faselnden Librettos wird entlarvt. Lustige gelbe Vögel hüpfen und fliegen herum, es wird mit Beate-Uhse-Puppen hantiert, Ken und Barbie können besichtigt werden. Der Schrott des Abendlands trifft auf den Irrsinn des Orients. Und wenn zur großen Entscheidungsschlacht gerufen wird vor den Mauern von Jerusalem (dargestellt von einer übergroßen Spielzeug-Multikultikirche) rücken keine waffenstarrenden Heere harter Männer vor, es rennen zwei Grundschulkinder-Truppen gegeneinander an. Verblüffend einfach, verblüffend treffend funktioniert dieser Zeit- und Zerrspiegel. Das wirklich Komische ist aber, dass die beiden Regisseure alles, beinahe jede Tollheit, jede Groteske, tatsächlich aus dem (Noten)-Text herausdestilliert haben, dass alles sinnhaft, ernst bleibt. Und dass in diesem optischen Irrsinn die Musik nicht etwa gleich mit vergrimmassiert wird. Sich sogar eher intensiver Bahn bricht. Was ohne das von René Jacobs wieder einmal zur artistischen, gestischen Hochform präparierte Freiburger Barockorchester unweigerlich geschehen wäre. So aber läuft im Graben ein orchestraler Parallelfilm von staunenswerter Brillanz ab. Und auf der Bühne bricht Miah Perssons herrlich rund klingende, sanft seufzende Almirena jedem das Herz, singt sich Silvia Tro Santafes Rinaldo, schmächtig von Gestalt, riesig von Stimme, fast ums Leben. Noemi Nadelmann wuchtet Almira derart vehement über die Rampe, dass es einen nur so in die Sessel presst, und Lawrence Zazzo gibt als Goffredo das Destillat aller schmierigen Machtpolitiker dieser Welt, singt nur sehr viel besser. So sitzt man da und staunt und lacht und ist ständig in Bewegung, fuchtelt „Guck mal dahinten" und „Hör mal" murmelnd mit den Armen durch die Luft und sitzt und staunt und tut das geschlagene viereinhalb Stunden lang. Irgendwann ist es dann vorbei. Und man möchte, dass es von vorne anfängt. Oder dass zumindest einer kommt und einen wegträgt. Weil man gehen, gehen jetzt wirklich nicht mehr kann. Und dann gab‘s einen Aufstand. Enthusiasmierte und entrüstete Menschen fielen lautstark übereinander her. Die enthusiasmierten obsiegten am Ende. Und mitten im schönsten Aufstand fing das Orchester wieder an zu spielen. Leider hörte es schnell wieder auf. Schluss mit Jubeln. Festzuhalten gilt: Oper ist nicht langweilig. Oper ist relevant. Oper hat etwas mit uns zu tun. Drei Opernhäuser muss man haben (aber nur, wenn sie Dinge produzieren wie diesen „Rinaldo"). Was zu beweisen war. P. S.: Man muss sich ziemlich sputen, um das alles bewiesen zu bekommen, weil „Rinaldo" nur noch viermal gezeigt wird und dann auf Nimmerwiedersehen im Orkus der Operngeschichte verschwindet. Das wirft diese schöne Argumentation dann leider doch ein bisschen über den Haufen. Termine: 22., 24., 26., 29. Januar; Karten: (030) 20 35 45 55. |
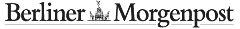
 Berliner "Rinaldo"-Premiere mit Noemi Nadelmann (Armida) und James Rutherford (Argante)
Berliner "Rinaldo"-Premiere mit Noemi Nadelmann (Armida) und James Rutherford (Argante)