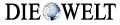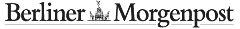|
Das Topfblumenspiel Rossinis „Semiramide" an der Deutschen Oper Berlin Von JÜRGEN OTTEN Liebe, das gab Stendhal einmal zu Protokoll, Liebe beginnt mit Verwunderung. Ein prosaischer, aber meist zutreffender Satz. Liebende staunen, wenn sie sich zum ersten Mal in die Augen schauen. Staunen darüber, warum das Schicksal so gnädig war, ausgerechnet sie auszuwählen. Spüren, wie es in der Magengegend vibriert, wie sich ihr Puls in die Höhe schraubt. Und wie sich die Seele verliert in den Vorstellungen des vagen Glücks. Hier, auf der so gut wie leeren, anthrazitfarben ausgeschlagenen Bühne der Deutschen Oper Berlin geschieht Selbiges: Semiramide und Arsace begehren. Hauchen einander die reizendsten Verzückungen ins Ohr, schmachten, dass die Wände beben. Und wie die Liebe so spielt: Niemand ist da außer ihnen; auf dem beigefarbenen Designer-Sofa wäre gewiss Platz für beide. Doch es gibt ein winziges, gleichwohl essenzielles Problem. Singt Babylons Königin Semiramide von der Liebe, meint sie Arsace, den tapferen Heerführer. Singt aber Arsace den gleichen Text, dann meint er Prinzessin Azema. Liebe beginnt manchmal mit einem Missverständnis. Und mit fein säuberlich in Blumenkästen verbrachten Topfpflanzen. Zu Hunderten aufgereiht, senken sie sich dekorativ vom Schnürboden hinab. Dies also ist das zweite der Sieben Weltwunder der Antike, die legendären Hängenden Gärten der Semiramis – ein kleinbürgerliches Idyll. Ein gewiss waghalsiges Bild (Bühne: Bernd Damovsky). Doch passt es zur Inszenierung von Kirsten Harms. Die nämlich spricht zu uns: Betrachtet nicht Babylon, die himmlische Stadt, vergesst die Antike, den Mythos. Schlendert doch einfach mal ins Museum, vorderasiatische Abteilung. Und wagt einen Blick in die Geschichte. Blicken wir also: Gioacchino Rossinis Melodramma tragico „Semiramide", das nach der Uraufführung am 3. Februar1823 im Teatro La Fenice rasch von den Bühnen verschwand, nimmt sich, fußend auf ein Libretto von Gaetano Rossi nach Voltaires „La Tragédie de Sémiramis", des antiken Stoffes an. Geschildert wird das Drama um Semiramis, die gemeinsam mit ihrem Kompagnon Assur ihren Ehegatten, König Nino, beseitigt hat und von den Göttern deswegen zur Sühne verurteilt wurde. Die Oper setzt fünfzehn Jahre nach dem Mord ein. Der Tag der Rache ist angebrochen, die Dinge, die Menschen stoßen aufeinander. Es droht Ungemach. Die Ouvertüre kündet davon. Nicht nur das berühmte Treueschwur-Thema in den Hörnern und die federnde Violinenkantilene erklingen; auch der göttliche Wille verschafft sich brodelnd Raum. Alberto Zedda arbeitet dieses Nebeneinander der Stimmungen am Pult des fabelhaft disponierten Orchesters der Deutschen Oper mit Sachverstand und erheblicher Trennschärfe heraus. Dies ist sein Abend, sein Erfolg. Kaum einmal in den folgenden viereinhalb Stunden (der Aufführung zugrunde liegt die Neue Kritische „Semiramide"-Ausgabe) verliert Zeddas Dirigat an Spannung, an Plastizität, an rhythmischer Eleganz, an Verve. Und siehe da: Die Streicher singen, wie man sie selten gehört hat; das Blech tönt warmherzig, die Holzbläser zwitschern. Das alles über weite Strecken im energiegeladenen mezzopiano. Für die Sänger ist solche Dezenz ein Glück. Denn einer der Hauptgründe, warum das Werk weiland in der Versenkung verschwand, war die schier unermessliche stimmliche Anforderung. Gut, die Schwierigkeiten bleiben, bei Gregory Kundes Idreno spürt man sie bisweilen. Die anderen Protagonisten aber agieren bravourös, auch wenn dies leider nicht bedeutet, dass sie so spielen. Darina Takovas Semiramide glänzt mit glühend-vollem Sopran, verkörpert entschieden den von Rossini favorisierten Typus des soprano drammatico d’agilita. Und da ihr Jennifer Larmore als Arsace in nichts nachsteht, figuriert das Duett des zweiten Aktes „Giorno d’orrore" als sängerischer Höhepunkt des Abends. Ebenfalls glänzend besetzt sind die Widersacher aus der Männerwelt. Simone Alaimos Assur, von der Regie als präpotenter Verbrecher mit Guerilla-Truppe im Rücken und Leder auf der Haut gezeichnet, ist ein würdiger Vorfahre von Macbeth und Nabucco; ihm entgegen stellt sich, mit profundem Bass, Reinhard Hagen als der Hohepriester Oroe. Ein schlauer Fuchs, dieser Oroe. Beherrscht die Szenerie nach Belieben, als Drahtzieher im modernen Gewande: ein Museumsdirektor par excellence. Seinem Willen folgt die Vorstellung in den kühlen Hallen; er ist nicht nur Allwissender, er ist der Spielleiter. Die Museums-Figuren tanzen unter seiner Obhut. Das hat durchaus Sinn – innerhalb des Inszenierungskonzepts. Doch schon Pet Halmens Berliner „Aida" vor Jahren litt an der Krux, dass die museale Idee die Oper aus den Angeln hebt. So ungekrempelt, will sich das Drama zumal psychologisch kaum erschließen. Die Konflikte sind ihres Wesens beraubt, manche Szene wirkt sogar unfreiwillig komisch. Eben das ist „Semiramide" nicht. Mag sein, dass Kirsten Harms die Oper vom Staub der Geschichte befreien wollte, dass die Kommentierung der Welt von damals einen Einblick in die Welt von heute gewährleisten sollte. Dafür aber hat sie sich vermutlich nicht nur das falsche Stück ausgesucht. Sie hat das Wunder der Liebe geopfert. |
|
Blendende Belcantoschlacht in Saddams Bunker von Manuel Brug Wagners Walhall erhebt sich an (fast) jedem Stadttheater, Barockes wird brillant aufbereitet, auch mit Moderne von Berg bis Zimmermann hat unser finanziell drangsaliertes Opernwesen null Problemo. Nur vor Belcanto haben alle Bammel - ist nicht gerade die Gruberova im Saal. Bellini geht, aber der ernste Rossini, der seit mehr als 20 Jahren dank der superben Arbeit der ihm gewidmeten Fondazione von Pesaro aus die Welt erobert - in Deutschland ist er so selten anzutreffen wie ein weißer Elefant. Insbesondere seine "Semiramide", jener 1823 im venezianischen Fenice-Theater uraufgeführte Mount Everest der Rouladen, Fiorituren, Vorschläge, Terz- und Sextenparallelen, wo ein erfahrener Komponist vor dem Aufbruch in ein ungewisses französisches Abenteuer in seiner letzten italienischen Oper sein Können als vierstündige Formel-Eins-Strecke der Koloraturkunst resümiert, dieses Werk ist hierzulande höchstens konzertant zu erleben. Zurechtgestutzt auf die Schauwerte reisender Goldkehlen, als Kürstück reinster Vokalkunst: schön, aber selbstzweckhaft. Man kann solches freilich auch inszenieren. So ist der Mut der Deutschen Oper Berlin, dieses nicht nur für die Operngeschichte so wichtige Stück Gesangsdrama - ungekürzt - szenisch aufzuführen, unbedingt zu preisen. Natürlich ist uns heute die Ästhetik von Gaetano Rossis eine Voltaire-Tragödie ausbeutendem Rührstück denkbar fern. Eine Mutter (Semiramis), die den verschollenen Sohn (Arsace) nicht mehr erkennt; eine von drei Nebenbuhlern geliebte, aber keine Arie singende Prinzessin; schließlich die gattenmordende Herrscherin, die nahe dem Inzest ist, aber dank Arsaces fehlgeleitetem Schwert zum Finale fällt, das ist schwer genießbar. Wird aber sublimiert durch die souverän errichtete Architektur einer Partitur von nur 13 Einzelnummern, die jeden dramaturgischen Winkelzug in vorgegebene Elemente verfüllt und diese zu großbogig abwechslungsreichen, unverkennbaren und sinnvollen Einheiten wölbt. Man muss sich auf dieses besondere Rossini-Maß nur einlassen. Und es muss gekonnt aufgeführt werden. Das ist in Berlin der rare Fall. Besonders mit der Rossini-Autorität Alberto Zedda am Pult. Der formt bereits in der 11-minütigen Ouvertüre das sonst oft so spröde Orchester nach seinem Belcantobild, lässt es flexibel weich federn, balanciert mit einem schmiegsam intonierenden Hörnerquartett die sparsame Orchestrierung aus. Zedda hat den Atem und die poetische Dispositionskraft für die folgenden, langen, aber gelungenen Stunden. Sein Musizieren wird nie lärmig oder vordergründig vulgär. Er lässt sich Zeit, horcht in die reduzierten Geheimnisse dieses spätklassischen Minimalismus. Er hetzt nie, findet zu tänzelnder Rhythmik und lange gehaltenen Melodielinien. Auch die Vokalbesetzung kann spielen - und singen. Die slawisch herb tönende Semiramide Darina Takovas, die die Höhe nicht ganz exakt verblendet, sieht als erst im Tschador trauerndes, dann im Pelz sich räkelndes Königinnenluder vom Zweistromland witzigerweise aus wie Tatjana Gesell, die (mutmaßliche) Nürnberger Gattenmörderin. Jennifer Larmore gluckert als mit dem Gepäcktrolley seine Kriegswaffen transportierender Arsace ein wenig in fingierter Tiefe herum, schleudert aber feurig ihre Spitzentöne heraus. Und verfügt offenbar über endlosen Atem für halsbrecherische Verzierungen. Simone Alaimos Assur ist ein schmieriger Schurke in Leder, ein Pizza-Mafioso mit so beweglicher Wampe wie Bassurgewalt. Als indischer Prinz Idreno zieht Gregory Kunde nicht nur inhaltlich den Kürzesten, er hat auch zwei unsingbare Arien zu bewältigen; was er - bis auf ein paar weggeglitschte Noten - mit Anstand schafft. Reinhard Hagens Priester mit der Fellschürze und Raquela Sheereans nur Stichworte liefernde, dafür sich auf dem Flokati-Diwan räkelnde Azema sind überdurchschnittlich gut. Schwierig ist bei einem solchen Belcanto-Brocken die Regie. Kirsten Harms, raritätenerfahrene Kieler Opernintendantin, macht in Bernd Damovskys multifunktional kahlem Neonquader nicht viel. Sie stellt - zu oft symmetrisch - mit Personal wie aus einem Fifties-Film über die benachbarte Schahfamilie Pahlewi eine Art Belcantoschlacht in Saddams Bunker nach. Gerne werden ironisch die Auswüchse der Gesangsoper gestreichelt, und das nicht nur, wenn sich Semiramides weltwunderhafte Hängende Gärten als schnöde Geranienblumenkästen herabsenken. Für wohlige Minuten reuelos genossene Gesangskunst schien Pesaro plötzlich an der Spree zu liegen: die am ehesten gelungene Premiere der letzten zwei Spielzeiten. Doch die kurze Ära Udo Zimmermann ist ja bereits eine abgeschlossene Fußnote der blutigen Berliner Operngeschichte. Termine: 27., 31. 5., 6., 9., 12. 6.; Karten: (0700) 67 37 23 75 46 Artikel erschienen am 26. Mai 2003 |
|
DER TAGESSPIEGEL Im Schatten der Geranien Von Jörg Königsdorf Wir sagen es lieber gleich: Diese Oper dauert viereinhalb Stunden. Das ist zwar auf die Lebenszeit berechnet nicht viel, aber im Musiktheater, in der Sauerstoffarmut unterfunktionierender Klimaanlagen, bekommt der Zeitfaktor nun einmal besonderes Gewicht. Viereinhalb Stunden nimmt sich Gioacchino Rossini Zeit, um sein babylonisches Muttermorddrama zu erzählen und um eine Opernhandlung auszubreiten, die im Programmheft auf 16 Zeilen zusammengefasst werden kann. Ein Koloss der Opernliteratur ist diese „Semiramide", und normalerweise ein exklusiver Fall für die Rossini-Festivals von Pesaro bis Wildbad. Die großen Opernhäuser dagegen lassen von diesem Stück die Finger und spielen lieber den „Barbier von Sevilla" oder die „Cenerentola", wenn's denn mal Rossini sein soll. Nicht so die Deutsche Oper, an der die „Semiramide" den Schlusspunkt der vorzeitig beendeten Intendanz von Udo Zimmermann setzt. Das macht Sinn, denn diese letzte Spielzeitpremiere steht mustergültig für Zimmermanns Anliegen, die Routine des Repertoirebetriebs durch unkonventionelle Stücke und neue Regiehandschriften zu durchbrechen. Mit Kirsten Harms war das Stück einer Regisseurin anvertraut worden, die seit einigen Jahren als potenzielle Aufsteigerin in die erste Liga der Opernregie gehandelt wird – ihre Kieler Inszenierungen von Strauss- und Schreker-Raritäten, aber auch ihr asketischer „Ring" ernteten Feuilletonanerkennung in der ganzen Republik. Die an Wagner-Weiten erprobte Sicherheit im Umgang mit Zeit und Raum kommt auch ihrer „Semiramide" zustatten – in dem schlichten, angemessen kolossalen Einheitsraum von Bernd Damovsky fokussiert sie die ausladenden Duette und Soloszenen ebenso selbstverständlich wie die statischen Chortableaux. Harms erzählt klar, ohne Umschweife und verniedlichende Details: Um eine Tempelhalle in ein Boudoir umzufunktionieren, reicht ein bloßer Lichtwechsel – die Requisiten des Abends lassen sich an zwei Händen aufzählen. Die Geschichte vom Fall der mythischen Babylonierkönigin wird in die Gegenwart verlegt, doch ohne peinliche Aktualisierungen, wie sie im Umfeld des Irak-Kriegs zu befürchten waren. Man trägt Anzug und Abendkleid, die vertrauten Kostüme des Regietheaters, der Zauber um den Geist des ermordeten Königs, der seinen Sohn zur Rache an der eigenen Mutter zwingt, wird von der Priesterkaste diskret organisiert. Harms wahrt Distanz zum Stück, belässt der Musik jedoch ihren Wirkungsraum: Wenn etwa die Hängenden Gärten der Semiramis als Endlosreihen geranienbestückter Blumenkästen vom Schnürboden schweben, ist das durchaus als augenzwinkernder Kommentar zu verstehen, drängt sich jedoch nicht als platter Ulk auf. Dafür, dass diese Oper endgültig als ernstes Meisterwerk rehabilitiert wird, sorgt Alberto Zedda. Wohl kein anderer Dirigent auf Erden ist mit der Musiksprache Rossinis so vertraut, und niemand sonst versteht es so wie der 75-jährige Zedda, den Ernst hinter der virtuosen Belcanto-Fassade hervorzuholen. Schon die Ouvertüre offenbart sich in ihrer motivischen Kontrastdramaturgie als italienisches Pendant zu den „Freischütz"- und „Leonoren"-Ouvertüren – Rossini, macht Zedda unmissverständlich klar, komponierte vielleicht schneller als seine deutschen Kollegen, aber genauso reflektiert. Eine Erkenntnis, die freilich auch deshalb so deutlich zu Tage tritt, weil Rossinis ausgeprägter Sinn für Proportionen hier endlich einmal nicht durch Kürzungen entstellt wird. Überraschenderweise lässt sich das auch im Riesenraum der Deutschen Oper vermitteln. Das Stück gewinnt an Tiefe des Klangs und babylonischer Wucht, verliert aber nicht an Prägnanz im Detail – für Zeddas Überredungskunst spricht nicht zuletzt, dass das Orchester gerade bei dieser traditionell von deutschen Musikern eher gering geschätzten Musik seine überzeugendste Saisonleistung vorlegt. Ein guter, oft sogar großartiger Abend, der von einer bis in die Nebenrollen stimmigen Besetzung getragen wird: Mit der Russin Darina Takova als Semiramide und Mezzo-Star Jennifer Larmore hat die Deutsche Oper ein Protagonistenpaar der Spitzenklasse – der gereifte Sex-Appeal Takovas und der himmelstürmende Hosenrollen-Impetus Larmores greifen passgenau ineinander, Simone Alaimo gibt als Schurke Assur rollengerecht raubauziges Koloraturgeknurr dazu, Gregory Kunde absolviert die beiden horrend schweren Tenorarien des Inderprinzen Idreno mit tadellosem Stilgefühl und sicherer Höhe. Und viereinhalb Stunden sind am Ende auch nicht länger als „Siegfried" und „Parsifal". Vermutlich sogar unterhaltsamer. Wieder am 27. und 31. Mai sowie am 6., 9. und 12. Juni |
|
Ein Himmelsgeschenk "Semiramide" unter Alberto Zedda Von Klaus Geitel Rossini monumental. Rossini in seiner mächtigen, bewahrenden und gleichzeitig wegweisenden musikalischen Gestalt wieder entdeckt und in den Triumph geführt. Die viereinhalbstündige Aufführung der "Semiramide" in der Deutschen Oper unter Alberto Zedda (75) wächst sich zu einem Triumph für Rossini aus. Darüber hinaus zu einem des Hauses. Mit dem Italiener Luigi Nono habe er die Intendanz der Deutschen Oper übernommen, sagte Udo Zimmermann in seiner kleinen Dankrede auf der Premierenfeier, jetzt verabschiede er sich von ihr mit dem Italiener Rossini. Ein Himmelsgeschenk der musikalischen Einfälle. Der vorübergaloppierenden Melodien. Einer ausgepichten in die Zukunft weisenden musikalischen Dramaturgie. Vor allem aber der berauschende Abgesang auf die grandiose Zeit des musikalischen Klassizismus, den Rossini in seiner "Semiramide" von 1823 der herauftönenden Romantik noch einmal in all ihrem hochherrschaftlichen Facettenreichtum vor alle Sinne führte. Dass diese genialische Rezeptur aber buchstäblich Note für Note deutlich werde, daran hat Alberto Zedda unter Einsatz seines Lebens gearbeitet: ein Musikarchäologe, der unter den Trümmern der ramponierten Werkfassungen das Original Rossinis ausgrub und in Druck gab. Mehr noch: Zedda dirigiert die Aufführung, gestützt auf das fulminant mitgehende Orchester, mit unermüdlichem Elan. Zedda bemüht sich, so scheint es, um jedes Instrument höchstpersönlich. Er sorgt für Einsatz und Pointierung, für Klangschönheit, für dramatische Zuspitzung, für das grandiose Miteinander aller gestaltenden Kräfte, ohne sich darüber je ins Zentrum des Werkes zu stellen. In ihm steht in Riesengröße, wie das Standbild des Baal auf der von Bernd Damovsky suggestiv entleerten Bühne, dieser Rossini, den man irrigerweise dank seiner genialen komischen Opern für ein musikdramatisches Leichtgewicht hielt. Beethoven, der rückhaltlose Bewunderer des "Barbier von Sevilla", riet Rossini eindringlich davon ab, je eine opera seria zu schreiben (was Rossini überdies längst getan hatte). So kann selbst ein Beethoven irren. Die Deutsche Oper hat in Kirsten Harms eine Regisseurin verpflichtet, die sich nicht einmischt, nichts theatralisiert. Ruhig gleiten die berühmten hängenden Gärten von der Bühnendecke herunter. Weit öffnen sich in der Ferne haushohe Tore und lassen das mondäne Assyrien in den Königspalast ein. Die Chöre, von Ulrich Paetzholdt einstudiert, singen vortrefflich und bilden den Wechselrahmen für das geforderte stupende Singvermögen der Protagonisten. Darina Takova singt mit brillanter Attacke die Titelpartie: die der königlichen Verbrecherin, die mithalf, ihren Mann zu ermorden, und auf der Schwelle steht, den eigenen Sohn zu heiraten. Sie besitzt tatsächlich einen königlich aufleuchtenden Sopran. An ihrer Seite Jennifer Larmore als ihr Koloraturen sprudelnder Sohn. Gregory Kunde quält sich zeitweilig ein wenig durch die haushohe Tenor-Tessitura, macht aber als Sänger wie als Darsteller durchaus gute Figur. Die tiefen Stimmen haben es leichter. Simone Alaimo formt aus Assur einen Vorläufer des Macbeth mit dem unbändigen Willen zur Macht und trumpft stimmlich nachdrücklich auf. Reinhard Hagen ist ein bassmächtiges Labsal. Auffällig in junger tenoraler Singschönheit: Yosep Kang. "Semiramide" strömt am Ende der Saison wie eine Wunderdusche des Singens auf die Deutsche Oper nieder. Es setzte tumultuarischen Jubel. Deutsche Oper Berlin, Bismarckstr. 35, URL: http://morgenpost.berlin1.de/archiv2003/030526/feuilleton/story606397.html |
|
Ein verkanntes Meisterwerk Von Jörg Königsdorf WAZ Berlin. Vier Stunden Musik liefert Rossinis tragische Oper "Semiramide" - und das für eine Handlung, die sich auf ein paar Zeilen zusammenfassen lässt. Opernhäuser machten um das Stück bislang einen Bogen, spielten lieber Rossinis "Barbier von Sevilla" oder "Cenerentola". Die Deutsche Oper Berlin hat jetzt den Versuch gemacht, die Tragödie um die mythische Babylonierkönigin ins Repertoire zurückzuholen: Das Plädoyer für das vergessene Meisterwerk wird zu einem der überzeugendsten Abende der Opernsaison. Es ist zugleich letzte Premiere des Intendanten Udo Zimmermann. Der war vor zwei Jahren angetreten, um dem Opernbetrieb durch neue Regiehandschriften und einen ambitionierten Spielplan aufzuhelfen und war nach einer missglückten ersten Spielzeit vom Senat geschasst worden. "Semiramide" steht noch einmal für das Musiktheater, das Zimmermann mit Stücken wie Nonos "Intolleranza" und Cherubinis "Medée" nach Berlin gebracht hat. Die Premiere rehabilitiert nicht nur Rossini als dramatischen Komponisten, sondern verhalf auch einer jungen Regisseurin zum Aufstieg in die erste Opernliga. Kiels Opernchefin Kirsten Harms zeigt, dass sie der Herausforderung des großen Stücks am großen Haus gewachsen ist: Die an die mykenische Atriden-Sage angelehnte Geschichte um die königliche Gattenmörderin wird klar, ohne folkoristischen Schnickschnack erzählt: An Babylon erinnert eine monumentale Baalsstatue, ansonsten ist im Zweistromland die moderne Herrenkonfektion eingekehrt. In Bernd Damovskys monumentalem Einheitsraum hat die Priesterkaste das Volk im Griff und inszeniert sogar einen Spuk um den toten König, der seinen Sohn Ninia (mit virtuosem Furor: Mezzostar Jennifer Larmore) auffordert, Rache an der eigenen Mutter zu nehmen. Harms gelingt das Kunststück, Distanz zur Handlung zu wahren, ohne die Musik zu verraten: Wenn etwa Darina Takova mit Vamp-Appeal in Figur und Stimme von Semiramides Nachtträumen singt, schweben die hängenden Gärten als Endlosfolge geranienbewehrter Setzkästen herab - ein augenzwinkernder wie stimmungsvoller Einfall. Dafür, dass Rossini als ernster Komponist rehabilitiert wird, sorgt auch Altmeister Alberto Zedda, der hörbar macht, dass der Weg von "Semiramide" direkt zu den adrenalingesättigten Dramen Verdis führt. Zedda entdeckt Tiefe und Gefühle, wo andere Dirigenten meist nur schwungvollen Belcanto sehen. Ensemble und Orchester folgen ihm dabei bis zum Ende mit Präzision und Schönklang und sichern der Deutschen Oper einen wichtigen Erfolg. Denn wie es mit den Berliner Opernhäusern weitergeht, weiß immer noch niemand. |
|
Überholmanöver Von Georg-Friedrich Kühn Noch viele herrliche barbiere möge er der Welt schenken: immer nur "opere buffe". Ansonsten werde er sein Schicksal herausfordern, schrieb der schon taube Ludwig van Beethoven dem auf der Überholspur dahin rasenden jüngeren Kollegen Gioacchino Rossini ins Stammbuch. Doch der Italiener hielt sich nicht an die Empfehlung des bewunderten Meisters. Semiramide, das ein Jahr nach der Wiener Begegnung entstandene Werk um die assyrische Königin Semiramis, die mit Hilfe ihres Geheimdienstchefs ihren Mann umbringt, dann in den nach der Geburt verschollenen und später als Heerführer Karriere machenden gemeinsamen Sohn sich verliebt und ihn auf den Thron des Landes heben will, ehe durch eine Erscheinung des ermordeten Ex und ein Briefdokument die ödipalen Verstrickungen offenbar und bereinigt werden - Semiramide ist ein "Melodramma tragico", wenn auch mit für die Ausdrucksfähigkeit von Rossinis Musiksprache erkennbaren Grenzen. Es ist Rossinis letzte für Italien komponierte Oper, 1823 uraufgeführt in Venedig. Eine alle damaligen Dimensionen sprengende Vier-Stunden-Opernwucht der halsbrecherischsten Belcanto-Arien, Ensembles und vor allem Duette. Mit ihren Wahnsinnsszenen markiert sie den Weg über Bellini, Donizetti hin zur großen französischen Oper Meyerbeers. Erstmals hat man das Werk ungekürzt mit allen Wiederholungen hierzulande nun auf die Bühne gebracht, dank des Rossini-Spezialisten Alberto Zedda. Trotz hohen Alters quicklebendig am Pult, bringt er das Orchester der Berliner Deutschen Oper zu einem duftig-delikaten Klang des virtuosen Raffinements. Sängerinnen für die Hauptpartien der Königin Semiramis und ihres verschollen geglaubten Sohns Ninya alias Arsace, die Dramatik und Koloraturen-Festigkeit als Sopran beziehungsweise Mezzo verbinden, muss man hingegen mit der Lupe suchen. Zumal Jennifer Larmore in der Hosenrolle des Arsace und mit Abstrichen Darina Takova in der Titelpartie der Semiramis, die als usurpatorische Königin erst durch die Umstände gezwungen wird, in den von ihr zugeschüttet geglaubten Abgrund zu blicken, leisten Überragendes. Kirsten Harms als Regisseurin bebildert das Werk in sparsamen Andeutungen. Den Empfangssaal eines Betonpalasts gemäßigt orientalischer Moderne hat ihr Ausstatter Bernd Damovsky dafür gebaut. Es ist kaum möglich, zwischen den glitzernden, vor allem die Sänger beanspruchenden Koloraturen eine ausgefeiltere Regiearbeit zu versuchen. So wird denn geschritten, gestanden, auf Sofas und Betten sich gefläzt. Die einstürzenden "Gärten der Semiramis" als herabgestürzte Blumenkästen und die giovannesk Hamlet huldigenden Geistererscheinungen sind schon die dramatischsten Ereignisse. Das Publikum verabreichte dem Regieteam vor allem Buhs, umarmte mit Jubel lediglich die Sänger und den Dirigenten. Musikalisch war das zum Abschluss der abrupt von Senats wegen abgebrochenen Intendanz Udo Zimmermanns noch ein kleiner, fast unerwarteter Höhepunkt. Deutsche Oper Berlin: Semiramide 12. Juni.
[ |