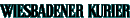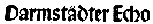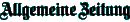|
Maifestspiele in Wiesbaden Christoph Willibald Glucks Oper "Armide" ist einerseits Zaubertheater mit Ballett und Maschineneffekten, exponiert andererseits einen klar konturierten seelischen Konflikt: Die Königstochter Armide bezieht aus ihrer Ungebundenheit Kraft und Stolz. Die Liebe zum feindlichen Überritter Renaud stellt diese Lebenshaltung radikal in Frage. Die junge Frau gibt dem Gefühl nach und verliert. Das Zauberschloß, in dem sie sich gemeinsam mit Renaud der Liebe hingab, läßt sie endlich von Dämonen zerstören, um hernach zu entschweben. Die zur Eröffnung der Internationalen Maifestspiele und somit an prominenter Stelle plazierte Neuinszenierung von Avshalom Pollak und Inbal Pinto im Staatstheater Wiesbaden vermittelt jedoch nicht einmal eine Ahnung von der Unbedingtheit Armides (Sophie Marin-Degor). Diese steht in der Eingangsszene mit der Ausstrahlung einer verklemmten Bürgerstochter auf der Wendeltreppe eines Turmes, der wiederum in einer Phantasia-Welt mit Comic-Ästhetik herumrollt. Von der Aura einer Kämpferin, einer hoheitsvollen Königstochter keine Spur. Der zur Verehelichung ratende Onkel Hidraot (Olaf Franz) schlurft zwischendurch herein und sieht aus, als habe er seit den Kreuzzügen im Wald gestanden und Moos angesetzt. Der von der Befreiung der feindlichen Ritter durch Renaud (Andreas Scheidegger) kündende Bote Aronte (Young-Myoung Kwon) wird aus unerfindlichen Gründen in einem schwarzen Kubus hereingerollt. Derweil dirigiert Sebastien Rouland das Orchester des Staatstheaters im relativ weit hochgefahrenen Graben demonstrativ gut sichtbar, gleichwohl mit bescheidenem Resultat. Die Synchronisation und die dynamische Balance im Kontakt zur Bühne lassen viele Wünsche offen. Vor allem aber mangelt es in entscheidenden Momenten an Suggestivität, an einem musikalischen Korrelat zur Unbedingtheit der von Armide eingenommenen Position. Der zentrale Konflikt bleibt auf allen Ebenen ausgespart. Das zugleich für Choreographie und Ausstattung zuständige Regieteam läßt lieber seiner Phantasie die Zügel schießen, überrascht gelegentlich auch mit netten Einfällen. Das Zelt, in dem das zeitweilige Liebespaar sich seinen Gefühlen hingibt, hat als bühnenhoher Reifrock auch Symbolwert. Sehr amüsant wirken die überfetten Lustgeister im fünften Akt, verkörpert von grazil und anmutig sich bewegenden, dabei grotesk aufgepolsterten Ballerinas des Corps de Ballet. Wie denn überhaupt das Auge dank der phantasie- und ästhetisch anspruchsvoll gestalteten Ballettszenen auf seine Kosten kommt. Gabriela Künzler als Inkarnation des Hasses zeigt im dritten Akt jene Dominanz und Bühnenpräsenz, welche der Titelheldin abgeht. Ansonsten muß man bis zum fünften Akt auf authentische Momente warten. Da paßt Scheideggers monolithisch-indifferente Haltung zur Situation des wieder zu den Waffen greifenden Renaud, die Rolle der leidenden Frau liegt Marin-Degor auch vokal, und im Graben werden, naht die finale Aufgipfelung, einige gestalterische Kräfte entbunden. Immerhin läßt dieser Schluß eine gewisse Zuversicht keimen. Gelänge es, die Titelrolle besser zu profilieren und würde die musikalische Seite ernster genommen, könnte sich dies mit dem verspielten Zugang des Duos Pollak und Pinto zu einem wesentlich ansprechenderen Gesamteindruck verdichten. Bis zur nächsten Aufführung am 17. Mai verbleibt ja noch ein wenig Zeit. BENEDIKT STEGEMANN |
|
Armide im Wunderland VON STEFAN SCHICKHAUS Im Jahr 1777 muss eine Oper wie Christoph Willibald Glucks Armide als etwas ganz Neuartiges empfunden worden sein. Keine steif-standardisierte Barockoper mehr, sondern ein Emotionstheater, mit Menschen statt mit Koloraturmaschinen. Der große Sprung für die Opernmenschheit, den Gluck da mit Armide und seinen weiteren Reformopern tat, verblasst aus der Entfernung betrachtet zu einem kleinen Schritt - wenn, ja wenn das gänzlich neue Wesen nicht wieder neue Nahrung bekommt. Wie berauscht Zur Eröffnung der Maifestspiele in Wiesbaden betätigte sich jetzt Intendant Manfred Beilharz als mutiger Opernreformer und überantwortete die Reformoper einer neuen Generation von Theatermachern: Inbal Pinto und Avshalom Pollak, beide Anfang 30, durften mit Armide ihre Vorstellung von Oper umsetzen. Pinto und Pollak, seit zehn Jahren im modernen Tanz unterwegs, bekamen nun erstmals die Verantwortung für Regie, Choreografie und Ausstattung einer Oper, und sie sorgten für einen sinnenfreudigen Maifestspiel-Auftakt. Die Oper erfanden sie natürlich nicht gänzlich neu, aber das konnte nicht einmal Komponist Gluck einst für sich in Anspruch nehmen. Falls die Beobachtung zutrifft, dass in letzter Zeit auffallend viele Choreografen sich mit Barockopern beschäftigen, ist dennoch der Zugriff darauf keineswegs normiert. So verknappte etwa Rosamund Gilmore in Darmstadt eine Händel-Oper auf das Wesentliche, jeden Zierrat weglassend - was nun in Wiesbaden ein Gegenstück findet in der Armide des israelischen Teams. Hier wird das Opernereignis als zirzensische Orgie verstanden, als Spektakel im ganz positiven Sinn. Die Bildeindrücke sind fabelhaft, man fühlt sich in ein Gemälde von Hieronymus Bosch versetzt oder in den Traum eines mit halluzinogenen Pilzen Berauschten. Und die Sänger bewegen sich auf der Bühne, als wären sie Teilnehmer des Monty-Pythonschen Silly-walks-Wettbewerbs. Abgesehen vom Protagonistenpaar Armide und Renaud geht keiner einen Schritt, der nicht ausgestaltet ist. Comic-Einflüsse scheinen unverkennbar, und dennoch entsteht ein Bewegungsbild weit weg vom Trash. Es ist wunderschön anzusehen. Avshalom Pollak, ein passionierter Bastler am Computer, steuerte Videoanimationen bei für den Bühnenhintergrund: Schattenspiele in so puristischer Anmutung, dass man nie an eine Datenleistung von mehreren Gigabyte denken würde. Erst auf den zweiten Blick fallen eine Menge Details auf: Die Nüstern der kämpfenden Drachen blähen sich, aus Zipfelhauskaminen steigen kleine Rauchwölkchen, mal dreht sich eine Kirchturmuhr im Sauseschritt. Es gibt immer was zu sehen; der Eindruck von Aktionismus drängt sich dennoch nicht auf. Wie verhext Inbal Pinto, Gründerin der Inbal Pinto Dance Company, choreografierte die zahlreichen Ballette, die bei einer französischen Oper des 18. Jahrhunderts nie fehlen durften. Dem eher traditionell orientierten Staatstheater-Ballett brachte sie dazu manch groteske Bewegung bei. Und auch Anklänge an die Wiesbadener Platée-Inszenierung von John Dew aus dem Jahr 2002 tauchten auf, etwa im Tanz der dicken nackten Frauen - bei Dew waren es Baby-Kostüme von ähnlich üppigen Proportionen. Eine Wunderlandbühne, ein fantastisches Märchen - doch als der behexte Ritter Renaud der verliebten Zauberin Armide erliegt, herrscht Konvention. Gerade in der Stunde des Zaubers bleibt es bei einer Standard-Umarmung, eine dünne Blumenkette muss die Magie symbolisieren. Da fehlte der Regie die Kraft, die sie beim Ensemble doch so im Überfluss hatte. Musikalisch war der Premierenabend ein imposanter: Der junge Franzose Sébastien Rouland hatte das Wiesbadener Opernorchester stilistisch wie klanglich hervorragend auf Gluck eingestimmt, mit der Bühne verlor er nur einmal kurz den guten Kontakt, zu Beginn des dritten Akts, als Armide gerade über dem Boden schwebte. Für die Titelrolle hatte man in Wiesbaden die französische Barocksängerin Sophie Marin-Degor eingeladen und bangte um ihre Gesundheit bis wenige Tage vor der Premiere. Doch dann zeigte sie sich in bester Verfassung, sang einen anmutigen, warmen Sopran, der alle Facetten einer verliebten Furie darzustellen vermochte. Ihr Gegenüber war Andreas Scheidegger als Renaud: Eine jener hohen französischen Tenorpartien, die unangenehm zu singen sind, von ihm allerdings vorzüglich gemeistert. Den Publikumspreis allerdings bekam Gabriela Künzler als Allegorie des Hasses, eine dankbare Rolle, von ihr bestens ausgefüllt. Der Nachwuchspreis sozusagen ging an Elisabeth Fischbach (als Lustgeist) und Young-Myoung Kwon (Aronte), beide noch Studierende an der Frankfurter Musikhochschule und beide großartige Erscheinungen. Aronte, der arme, musste seinen kurzen Auftritt in einer Kiste absolvieren, der Kopf durfte zum Singen durch einen Klappdeckel nach Draußen. Selten sang jemand in einer Kiste derart gut. [ document info ]Copyright © Frankfurter Rundschau online 2004 Dokument erstellt am 02.05.2004 um 16:56:06 Uhr Erscheinungsdatum 03.05.2004 |
|
Armide (Sophie Marin-Degor) und ihr böser Onkel Hidraot (Olaf Franz) vor dem Reigen böser Geister. Kaufhold Im Reigen böser Geister Glucks Oper "Armide" als choreografische Inszenierung im Staatstheater Von Volker Milch Eine gefährliche Damenriege ist das, jene Nymphen, Circen, Sirenen, Dryaden, Zauberinnen und Liebesgöttinnen, die rechtschaffene Ritter von der Erfüllung ihrer militärischen Pflichten abhalten und ans Lotterbett fesseln. Die Operngeschichte kann manche Arie davon singen. Zum Glück siegt meistens die Tugend, und die Helden gehen sittlich gefestigt aus solchen Geschichten hervor. Dies ist auch in Christoph Willibald Glucks französischer Oper um die schöne Zauberin "Armide" der Fall. Wie schwer das Standhalten dem Rittersmann werden kann, zeigt die Eröffnungs-Premiere der Wiesbadener Maifestspiele in subtiler Komik: Der dänische Kreuzritter (Axel Mendrok) und sein Kollege Ubalde, nicht minder prächtig gesungen von Thomas De Vries, müssen sich immer wieder moralisch aufrappeln, um nicht den Versuchungen weiblicher Trugbilder zu erliegen. Der szenische Zauber ist stark, der hier wirkt, und bis auf vereinzelte Stimmen lautstarker Gegenwehr scheint ihm das Publikum im Staatstheaters zu erliegen: Der Applaus ist stürmisch und hält an, bis sich schließlich auch das junge, israelische Regie-Duo Avshalom Pollak und Inbal Pinto dem Publikum zeigt. Die beiden Leiter der "Inbal Pinto Dance Company" hatten im Mai 2003 in Wiesbaden mit ihrem Tanz-Stück "Oyster" eine szenische Zauberkiste geöffnet und sich damit für Glucks 1777 noch einmal den barocken Theaterapparat anrufende "Armide" qualifiziert. In der repräsentativen Hülle des auf Tasso zurückgehenden, bereits von Lully und Händel vertonten Stoffes herrscht indes die der Natürlichkeit verpflichtete Ausdruckskunst des Opernreformers. Wer mit diesem Ritter Gluck vor allem klassizistischen Faltenwurf und einen elegischen Reigen seliger Geister verbindet, der wird in Wiesbaden seine Vorstellungen korrigieren müssen: Von den ersten Takten bis zu Armides großartiger Schluss-Szene, mit der Sophie Marin-Degor ihre stimmlich und darstellerisch so fesselnde Leistung krönt, gibt es nur wenige Momente musikdramatischen Spannungsabfalls. Zunächst wähnt man sich in einer expressionistischen Filmkulisse: Armide steigt von einem Turm herab, während sich im Hintergrund die Silhouette eines Märchen-Dorfs abzeichnet, das jeder ordentlichen Perspektive spottet. Als Schattenspiele fliegen kleine und große Drachen durch die Luft, Geister lösen sich in Rauch auf, Blumen tanzen Ballett. In der Personenführung fühlt man sich an Achim Freyers Theater erinnert, dann wieder denkt man an Chagalls östliche Märchenbilderwelten. Aber die Handschrift des für Regie, Choreografie und Ausstattung verantwortlichen Duos, von dessen Kreativität nicht zuletzt die kuriosen Kostüme zeugen, ist doch eine ganz eigene. Man kann sicher darüber streiten, ob das Seelendrama der zwischen Hass und Liebe schwankenden Zauberin, an deren Ringen ums Gefühl sich die analytischen Hebel ansetzen ließen, von der Bilderwelt und dem choreografischen Witz Pollaks und Pintos nicht ein wenig in die Ecke gedrängt wird. Aber das Duo hat sich eben nicht dem psychologischen Realismus, sondern einer magischen Zauberwelt verschrieben, in der sich die Ästhetik ihres "Oyster"-Stückes durchaus wiedererkennen lässt. Im Opern-Debüt des Duos setzt sich die Spannung der vokalen Linie in der Choreografie fort, und wenn es auch oft nur die Arme oder Hände allein sind, die sich gleichsam zum Tanz verselbständigen. Es ist eine Inszenierung aus dem Geist der Choreografie, in der sich klassische Elemente mit absurden, oft grotesken, slapstickhaften Bewegungsmustern verbinden. Das Wiesbadener Ballett macht hier gute Figur auf ungewohntem Terrain. Auch der Chor, einstudiert von Thomas Lang, hat großartige Momente in verblüffenden, buchstäblich schrägen szenischen Arrangements, und das Staatsorchester befleißigt sich unter Sébastien Roulands Leitung eines schlanken, transparenten Klangbildes. Vor allem aber ist erstaunlich, in welcher Form sich die Sänger auf diese Körpersprache einlassen, allen voran Sophie Marin-Degor und Gabriela Künzler, die als Personifikation des Hasses einen furiosen Eindruck hinterlässt. Das Ensemble singt überhaupt auf hohem Niveau und muss sich, im Gegensatz etwa zur Minkowski-Aufnahme von 1999, den Schwierigkeiten der Partitur in der modernen Stimmung stellen, wie das Theater explizit vermerkt. Andreas Scheidegger ist mit kernigem Tenor jener stark geprüfte Renaud, der auf den Pfad der Tugend zurück muss und Armide schnöde im Stich lässt. Im Gefolge der Zauberin trippeln Thora Einarsdottir (Phénice) und Simone Brähler (Sidonie) über die Bühne, die düsteren Szenen vokal aufhellend. Und gemeinsam mit der Zauberin beschwört deren böser Onkel Hidraot (Olaf Franz) eindringlich die Dämonen, die im Hintergrund als Reigen böser Geister ihr Unwesen treiben: Starke Bilder in einem überzeugenden Plädoyer für Gluck. |
|
Die Wiesbadener Maifestspiele wurden mit einer Neuinszenierung des Staatstheaters von Glucks "Armide" eröffnet. Von Rudolf Jöckle Diese Aufführung zeigt, wie energisch und schlüssig das Staatstheater die längst traditionellen Maifestspiele in die eigene Arbeit einbinden will. Es setzt nicht nur konsequent die angestrebte Gluck-Pflege fort, sondern zitiert auch die eigene Geschichte: Vor genau 102 Jahren wurde "Armide" bei den damals so genannten Wiesbadener "Kaiserfestspielen" gegeben, wenn auch in einer offenbar ziemlich freien "Neubearbeitung". Die Oper selbst war 1777 in Paris uraufgeführt worden und zählt zu den kühnen "Reformopern" des Komponisten: Gluck verwendete, von einer kleinen Ergänzung abgesehen, das Libretto von Philippe Quinault, das Lully für Ludwig XIV. zu der maßstäblichen, ja "geheiligten" französischen Oper vertont hatte. Gluck gewann. Dabei stellt die Musik allein Armide, die des Zauberns mächtig ist und damit auch die Liebe des Kreuzritters Renauld (Rinaldo in Tassos Urquelle "La Gerusalemme liberata") gewinnt, um sie dennoch an den Ruhmsüchtigen wieder zu verlieren, ins Zentrum. Das allein schon gestaltet Gluck mit hoher psycholgischer Kunst, während er alle anderen, auch Renauld, in der gewohnten, wenngleich ansprechenden Typisierung belässt. Präzise dieser formalen Spur folgt das Wiebadener Regieteam Avshalom Pollaka und Inbal Pinto, das auch für Choreografie und Ausstattung verantwortlich ist. Aus der Bildwelt einer Zauberoper mit allerlei optischen, wenn auch nie überwuchernden Schattenbildern, dem entsprechenden Mummenschanz der Kostüme und der komischen Groteske der (chorischen) Bewegungen wächst fast schon ikonenhaft die Menschlichkeit der Armide, in Gefühlsextremen zwischen überbordender Liebe und zerstörerischem Hass schwankend, eine zerrissene und gerade deshalb so anrührende Seele, großartig gestaltet und nuancenreich gesungen von Sophie Marin-Degor. Ihre Beschwörungsszene des "Hasses" – Marianne Künzler im Feuerbrand-Kostüm und mit hinreißender vokaler Attacke – geriet gerade unter diesem Aspekt zum Höhepunkt der Aufführung. Dass die anderen Solisten sich dennoch behaupten – voran Andreas Scheidegger als durchaus noch lyrischer Renaud, Olaf Franz als relativ hell klingender amtsmüder Onkel Hidraot, beispielhaft auch die Commedia-Figuren Phénice und Sidonie von Thora Einarsdottis und Simone Brähler –, spricht für Sorgfalt und Einsicht der Regie. Der Chor und das vor allem im zweiten Teil reichlich bemühte, dabei temporeich-exakte Ballett bieten zudem dem Auge immer neue Reize. Mit moderner, also höherer Stimmung spielte das Orchester. Sébastien Rouland am Pult hielt es straff, ja trocken im Klang, was der notwendigen Differenzierung zugute kam. Manches könnte man sich farbiger ausgeleuchtet vorstellen, einige weniger erfüllte Längen stellten sich ein. Aber der Schwung, die präzise Artikulation, blieben bestimmend. Insgesamt also ein würdiger, vom Publikum entsprechend gefeierter Auftakt der Festspiele. |
|
Wunderland der Fantasie Festival: Glucks Oper „Armide" eröffnet die Wiesbadener Maifestspiele Die schöne sarazenische Zauberin Armide gegen den heldenhaften Kreuzritter Renaud, Islam gegen Christentum: Der in Tassos Epos „Gerusalemme liberata" überlieferte Stoff könnte heute durchaus aktuelle Bezüge gewinnen. In Christoph Willibald Glucks Oper „Armide" aus dem Jahr 1777, mit der am Samstag die Internationalen Maifestspiele im Staatstheater Wiesbaden eröffnet wurden, steht allerdings das Seelendrama der zwischen Liebe und Hass hin- und hergerissenen Prinzessin im Vordergrund. Und das israelische Künstlerehepaar Avshalom Pollak und Inbal Pinto, für Inszenierung, Choreographie und Ausstattung verantwortlich, tat das Seine, um dem Stück alle martialischen Anwandlungen auszutreiben. Die beiden suchen bewusst das Wunderland der Fantasie auf, sie betonen die märchenhaften Seiten des Stücks, wenn sie mit der Projektion origineller, bizarrer Schattenrisse auf die Handlungsorte anspielen: Man sieht einen orientalischen Palast, eine bukolische Naturidylle, eine von Drachen bewachte Zauberwelt. Die pittoresken Kostüme verleihen der Inszenierung eine groteske Note, wenn etwa die Damen in tonnenartigen Röcken auftreten, die Schäfer sich mittels Fellen in Schafe verwandeln oder die Lustgeister als nackte, dickleibige Gestalten Menuett tanzen, als seien sie der Bilderwelt eines Botero entsprungen. Manchmal geht die Fantasie mit den auf dem Feld der Oper debütierenden Regisseuren durch. Dann steht das hektische Treiben auf der Bühne der affektbetonten Musik Glucks im Wege. Am eindringlichsten wirken die Szenen, in denen die Sänger den Mittelpunkt bilden: beim Auftritt des personifizierten Hasses, bei den Begegnungen der beiden Liebenden. Am Pult waltet mit dem jungen französischen Dirigenten Sébastien Rouland ein Barock-Spezialist, der es versteht, das Hessische Staatsorchester Wiesbaden federnd, brillant und konturenreich musizieren zu lassen, auch ohne historisches Instrumentarium. Eng ist der Kontakt zur Bühne, wo die Sopranistin Sophie Marin-Degor als Armide triumphiert: Ihre Ausdrucksskala reicht von der dramatischen Schärfe des Hasses bis zur lyrischen Weichheit der Liebe. Blasser wirkt der Tenor Andreas Scheidegger als Renaud trotz schöner schlanker Töne. Mitreißend in Stimme und Gestik verkörpert die Mezzosopranistin Gabriela Künzler die Figur des Hasses, La Haine genannt. Die eindrucksvolle Sicht auf eine weniger bekannte Gluck-Oper zwischen Barock und Klassik wurde vom Premierenpublikum lebhaft gefeiert, es gab viele Bravos und einzelne Buhrufe. ( tp) |
|
Eros in der Endlosschleife Von Johannes Bolwin Wenn man fähig ist, den Reizen der Liebe zu entgehen - was hat man noch zu befürchten? Das fragt sich gleich zu Beginn der Kreuzritter Rinaldo. Und auch seine Widersacherin, die Zauberin Armida, räumt zum Start der Wiesbadener Maifestspiele ernüchternd kühl mit all den emotionalen Wirrungen auf, denen der Mensch gerade im Wonnemonat Mai liebend gern verfällt: Das höchste Glück auf Erden ist es, "allein Herrin meines Herzens zu sein." Voila. Wut oder Sehnsucht, Glück oder Wille, Pflicht oder Gefühl, Ratio oder Eros, Rache oder Hingabe: Glucks späte, auf einem Jerusalem-Epos Torquato Tassos basierende Reformoper "Armide" (1777) ist ein aktionsarmer, psychologisch weitschweifiger Diskurs über die Grundelemente des Menschseins. Dabei ist der äußere Anlass banal: Es sind die Rachegelüste der syrischen Fürstin Armida, die sich gegen Rinaldo richten, weil der eine Schar gefangen genommener Kreuzritter befreit hat. Ach, l´amour. Sie schlängelt sich zwar wie ein schaumiges Sahnehäubchen durchs orientalische Wunderland, wird aber allseits gefürchtet: "Nichts ist so furchtbar wie die Liebe", flucht die stolze Armida. Prompt erliegt sie der Versuchung und muss sogar effektvoll, wenngleich vergeblich, die Höllengeister beschwören, um den Klauen Amors zu entkommen. Nur einmal, beim Hass-Ritual des 3. Aktes (in Wiesbaden ein dramatisch und choreografisch brillanter Höhepunkt), blitzt kurz die frappante Erkenntnis auf, dass Hass und Liebe letztlich nur zwei Teile des Ganzen sind. Das ist dann doch wieder trostreich und beruhigend menschlich, nach so viel auf hohem Geistesniveau sich vollziehender Moral-Exegese. Die Einrichtung von Avshalom Pollak und Inbal Pinto (Regie, Ausstattung) bietet prächtige, phantasievolle Kostüme, Pulverknall und Feuersblitz inklusive. Wie Fantasy-Gebilde muten manche spätbarocken Fabelwesen an. Video-Einblendungen umschnörkeln die Szenerie wie animierte, märchenhaft-naive Scherenschnitte. Putzig wird etwa die Naturidylle des Zauberschlosses mit flatternden Schmetterlingen, perlenden Tautropfen und Rauchwölkchen garniert. Die zu den Seiten hin offene Bühne suggeriert eine esoterische, zum Sujet passende Weite. Die Schärfe, die der verspielten Regie ein wenig fehlt, hat dafür die Musik: In Höchstform spielt das von Sébastien Rouland kompetent und mit jugendlichem Elan geleitete Theater-Orchester. Da werden vom Start weg, mit dem stark rhythmisierten "Tempo di Marcia"-Pomp der Ouvertüre, alle Farb-Register virtuos gezogen; derart denkbar dicht am Geschehen orientiertes, elastisch-transparentes, dynamisch fein abgestuftes Musizieren hört man gern! Sophie Marin-Degor singt die Titelpartie ohne Fehl und Tadel: Breit ist ihr zwischen exaltiertem Aufbrausen und zarter Intimität changierendes Ausdrucksspektrum, klar und schön die Tongebung. Herausragend im Wortsinne ist Gabriela Künzler in der allegorischen Gestalt des Hasses: Wirkungsvoll fährt sie in roter Teufelsmähne und verwegener Lederkluft aus Höllentiefen empor, flankiert von mächtigen Geisterchören. Auch wenn man sich inmitten der dreistündigen sittenstrengen Noblesse klammheimlich vielleicht ein freches Knallbonbon oder eine grobe Provokation wünscht: Es ist, wie schon Händels "Agrippina" 2003, eine niveauvolle, repräsentative Barock-Produktion. Traditionsbewusst soll damit nicht zuletzt an die Kaiserlichen Maifestspiele 1902 erinnert werden, die ebenfalls mit Glucks "Armide" begannen. |