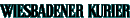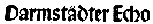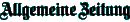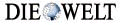|
Aschenputtel kommt ins Fernsehen Zwei Wochen nach der Doppelpremiere von Luigi Dallapiccolas unbekannten dunklen Einaktern "Nachtflug" und "Der Gefangene" spendiert man an der Oper Frankfurt nun ein Bonbon, von dem man wohl hofft, daß es das Publikum in Scharen anlocken wird. Gioacchino Rossinis dramma giocoso "La Cenerentola", eines seiner subtilsten Bühnenwerke, war zwar bei der Uraufführung 1817 wegen unbefriedigender Sängerleistungen durchgefallen, begann jedoch schon kurz darauf, die Bühnen der Welt nachhaltig zu erobern. Sogar Georg Friedrich Hegel, der Philosoph der Selbstbewegung des Geistes, schätzte die überbordende Vitalität Rossinis, der "nur allzuhäufig dem Text untreu" werde und mit seinen Melodien "über alle Berge" gehe, "so daß man dann nur die Wahl hat, ob man bei dem Gegenstande bleiben und über die nicht mehr damit zusammenstimmende Musik unzufrieden sein oder den Inhalt aufgeben und sich ungehindert an den freien Eingebungen des Komponisten ergötzen und die Seele, die sie enthalten, seelenvoll genießen will". Hegel erkannte den besonderen Reiz der Opern Rossinis im erfüllten Augenblick eines Singens, das den Geist der Improvisation fortleben lasse. So habe man "nicht nur ein Kunstwerk, sondern das wirkliche künstlerische Produzieren selber gegenwärtig vor sich". Um Rossinis sprühender, sich an der eigenen Existenz beständig neu berauschender und auf der Suche nach dem ultimativen "Kick" bisweilen ins Anarchische driftender Musik einen angemessenen szenischen Rahmen zu bieten, braucht es allerdings Fingerspitzengefühl. Keith Warners Methode, ein paar poppige Einfälle auf die Bühne zu bringen und diese dann möglichst bunt und kitschig anzuleuchten, reicht da nicht aus. Zwar erscheint sein Einfall, die ganze Geschichte als Traum des Aschenputtels zu deuten, nicht abwegig. Doch setzt ihn die Inszenierung weder suggestiv um, noch hält sie ihn schlüssig durch. Jason Southgates Bühnenbild siedelt die Träume der geknechteten Stieftochter in einem angegammelten Fernsehkasten der fünfziger Jahre an, der zunächst schräg vom nächtlichen Himmel herabhängt, um in den Szenen am Hofe des Fürsten dann die gesamte goldbefrachtete Bühne zu rahmen. Die Personen werden mal durch kleine, vorzugsweise im Fernseher agierende Puppen verdoppelt, mal tragen sie weiße Handschuhe, die an weißen Fäden hängen. Macht sich unter der dekorativen Oberfläche der Inszenierung schon bald kalauernde Langeweile breit, so verweigert sie der Protagonistin schließlich auch noch die Erfüllung. Statt aus der Asche heraus auf den prunkenden Thron des Fürsten erhoben zu werden, wird dieser Cenerentola zugemutet, ihren Weg, klug und bescheiden, genau in der Mitte von beidem zu finden. Hochanständiges Mittelmaß regiert auch die sängerischen Leistungen. Nidia Palacios absolviert die Titelpartie mit vorbildlich flinker Kehle und koketter Geschäftigkeit. Das vor lauter Sehnsüchten und Begehrlichkeiten überfließende Mädchen, dessen Wünsche so groß sind, daß sie plötzlich zu leibhaftiger Realität gerinnen, nimmt man ihr indes nicht ab. Ordentlich, engagiert, bodenständig singen und spielen auch Gioacchino Lauro LiVigni den Don Ramiro, Eric Roberts den Don Magnifico, Nathaniel Webster den Dandini, Simon Bailey den Alidoro sowie Barbara Zechmeister und Atala Schöck das gehässige Stiefschwesternpaar Clorinda und Tisbe. Einzig das Museumsorchester rettete am Premierenabend etwas vom Geist Rossinis. Unter Roland Böer schwang es sich zu einem feinnervigen, spritzigen und pointenreichen Spiel auf, pflegte Tempo und Witz der Partitur und entließ die Zuschauer, der realen Wetterlage zum Trotz, in beschwingter Sommerlaune. JULIA SPINOLA Text: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.06.2004, Nr. 142 / Seite 40 |
|
Es war einmal ein Prinz VON TIM GORBAUCH Es ist nicht einmal so, dass das Leben so schlimm wäre, dass man geschlagen würde oder in Asche schlafen müsste. Aber es ist trotzdem zu wenig. Zu eintönig, zu blass. Irgendwo muss es doch sein, das Große, für das zu leben sich lohnt, die Liebe, das Glück, der Märchenprinz, der alle Sehnsüchte erfüllt. Vielleicht hilft es ja, die Augen ganz fest zuzumachen, die Bettdecke über den Kopf zu ziehen und der Welt abhanden zu kommen. Vielleicht hilft es, wenn man sich ein Drehbuch erfindet für den Film des eigenen Lebens. So denn. Vorhang auf. Heute spielen wir das Märchen vom Aschenputtel, dem frommen, guten, gütigen, anmutigen Mädchen, das den Prinzen findet. Buch: Jacoppo Firetti. Musik: Gioacchino Rossini. Regie: Keith Warner. Alles ist also nur ein Traum. Warner gibt die Cenerentola als Theater im Theater, als Erfindung eines jungen Mädchens, das Angelina heißt und endlich mal die Fäden in der Hand halten möchte. Schon während der Ouvertüre, die der wie immer unter Zeitdruck arbeitende Rossini einfach aus einer früheren Oper - La gazzetta - übernahm, hebt sie einen kleinen, mit dem Auge der Illusion geschmückten Vorhang und gibt den Blick frei auf ein Puppentheater, dessen Personal dem ihres Lebens entspricht. Alle sind sie da, Angelina, die Schwestern, der Vater, der Prinz - als Marionetten, als geführte, gelenkte, fremdgesteuerte Figuren. Später, als alle Requisiten positioniert, alle Kostüme angelegt sind und das Theater von Menschen gespielt wird, senkt sich eine Hand auf die Bühne, die wie die Hand eines Puppenspielers über die Bewegungen der Akteure wacht (Bühnenbild: Jason Southgate). Puppentheater und Menschentheater sind synonym. Und wer weiß, vielleicht ist auch die wirkliche Welt nicht anders. Ein Theater, und wir die Komödianten. Warner jedenfalls deutet an, dass Fiktion und Wirklichkeit, Illusion und Realität ineinander fließen. Vom Blitz getroffen zerbricht in der zweiten Hälfte des ersten Akts das Puppentheater auf offener Bühne, das Bett, in dem Angelina zu Beginn träumend lag, verschwindet. Und doch bleibt alles unwirklich, überdreht und grotesk, weil ja auch die Opera buffa zum Theater neigt und nicht zur Wirklichkeit. Warner wird dem gerecht, indem er für die Übersteigerungen immer wieder Bilder findet und die Inszenierung aus dem Geist der Musik entwickelt, die er mit ballettuöser Präzision Bewegung werden lässt. Der Zeitfluss der Musik Die Schwestern Clorinda und Tisbe (hinreißend: Barbara Zechmeister und Atala Schöck) lieben bonbonfarbene, üppige Kostüme, der als Fürst verkleidete Diener Dandini (buffonesk und beweglich: Nathaniel Webster) tritt als prächtiger, fuchtelnder, von Bienen und Blumen begleiteter Pfau auf, Don Magnifico (virtuos: Eric Roberts), der Vater, ist die Farce, als die Rossini ihn kennzeichnete. Aber das ist nur das Material, das Warner makellos ordnet und arrangiert, um eine außerordentlich genaue, unterhaltsame Rossini-Inszenierung zu liefern. Eine Inszenierung, der die seltene Gratwanderung glückt, mit der Musik synchron zu laufen, die sich nicht von ihrer Geschwindigkeit zu einem Wettlauf verführen lässt, sondern immer a tempo arbeitet. Wie jede gute Regiearbeit ist Warners Cenerentola weder schnell noch langsam, sondern dem Fluss der Musik adäquat. Das beinhaltet, die Färbungen der Partitur zu erkennen, von Angelinas immer wiederkehrender, schlichter, pastellener Moll-Canzone Una volta c'era un re angefangen bis hin zu Ensembleszenen, in denen die Musik den Zeitfluss auflöst und in Erwartung erstarrt so wie Don Ramiro und die geladene Gesellschaft, als von außen der Auftritt der verschleierten Angelina angekündigt wird. Angelina und Don Ramiro, die Liebenden, vom Gefühl Beseelten, sind mit den Mitteln der Opera buffa ohnehin nicht zu fassen. Rossini gab ihnen ein weit größeres Ausdrucksspektrum, und gerade Nidia Palacios lotet das ganz außerordentlich aus, wechselt Timbre und Farbe und kann die ausgelassenen Koloraturensalven ganz plötzlich zart verhangen auffangen und ins Menschliche umdeuten. Auch Gioacchino Lauro LiVigni als Don Ramiro weiß sich in Szene zu setzen, obschon ihm die kraftvollen, stolzen Momente besser liegen als die lyrischen. Und aus dem Orchestergraben tönt Roland Böers Rossini-Sicht, die mit der Warners gut zu korrespondieren scheint: Lebendig führt er das Opernorchester, quirlig und schwungvoll, aber immer genau, immer a tempo, nie überhitzt. Als schließlich alles Wünschen geholfen hat und der Traum Wirklichkeit wird, als der Prinz auf seinem monströsen Thronsessel sitzt und Angelina nur noch daneben Platz zu nehmen braucht, da will sie nicht mehr. Sie schiebt den Prinz ins Bühnendunkel zurück, und mit ihm verschwinden ihr Vater, ihre Schwestern. Wie befreit tanzt sie zum Schlussrondo allein in der Bühnenmitte, als habe sie zu sich gefunden. Als könne das Theater um Märchenprinzen jetzt endlich aufhören. Und das Leben anfangen. [ document info ]Copyright © Frankfurter Rundschau online 2004 Dokument erstellt am 21.06.2004 um 16:44:05 Uhr Erscheinungsdatum 22.06.2004 |
|
Schöne Märchenwelt am seidenen Faden Ist einfach zu schön, um wahr zu sein, die Geschichte vom guten Aschenputtel und seinen bösen Stiefschwestern. vielleicht doch nur ein Traum der ganz Kleinen vom ganz großen Glück? Zumindest in den ersten Minuten seiner Frankfurter Neuinszenierung von Gioacchino Rossinis "La Cenerentola" möchte man es fast glauben: Da liegt Aschenputtel, bei Rossini Angelina geheißen, auf ihrem Bett und vor ihr tut sich der ganze Fürstenhof als Puppenspielkasten auf. Doch was wirklich wahr und was Fiktion ist, das lässt Regisseur Keith Warner in Frankfurt zunehmend offen. So schaut die sparsam gestaffelte, vorwiegend dunkel gehaltene Bühne (von Jason Southgate) zuweilen selbst aus wie ein großes Puppenspiel unter riesigen Händen, in dem sich die Personen wie Marionetten an Seilen bewegen. Andererseits bricht Warner das Bild manchmal zum reinen Kulissenlager auf, indem eben diese auf ihre Rückseite gedreht werden. Oder der Bühnenrahmen bleibt schief. Hübsch anzuschauen ist das immer, und Warner setzt glücklicherweise das Erzeugen und Aufbrechen von Illusionen ganz überwiegend an die Stelle dürftiger Buffo-Opern-Gags, vor denen man hier vorwiegend verschont wird. Überraschungsmomente nicht ausgeschlossen: Als ein gewaltiger Blitz knallend ins Puppenspiel fährt, fährt einem zugleich der Schrecken in die Glieder. Vor zwei Wochen hat Regisseur Warner eine Doppel-Inszenierung zweier Einakter von Luigi Dallapiccola auf die Bühne der Oper Frankfurt gebracht. Dass ihm jetzt mit Rossini im ganz anderen, im komischen Fach eine nicht weniger suggestive, atmosphärisch dichte Regiearbeit gelingt, ist nicht zuletzt der sichtlich durchdachten, quirligen, aber nie slapstickhaften Personenführung zu danken. Da schöpft zum Beispiel Eric Roberts das buffoneske Potenzial der Partie des verarmten Barons Don Magnifico voll aus, verfügt zudem über höchste baritonale Wendigkeit. Eine nicht weniger gute Figur macht Nidia Palacios in der Titelpartie, die sie weniger naiv als selbstbewusst anlegt. Ihre nicht allzu große, aber in den Verzierungen wie in den tieferen Lagen ungemein sicher und präsent geführte Stimme nimmt dabei nicht weniger für sich ein. Als herrlich gackernde und keifende Stiefschwestern überzeugen Barbara Zechmeister (Clorinda) und Atala Schöck (Tisbe). Sympathieträger auch in Frankfurt natürlich der junge Fürst Don Ramiro, selbst wenn er, wie Tenor Gioacchino Lauro LiVigni, nur auf einem zur Kutsche umgebauten Fahrrad vorfährt. Anders als ihm fehlt es seinem Diener Dandini in Gestalt von Nathaniel Webster an der letzten vokalen Bühnenpräsenz, auch wenn dieser - auch so eine Spielerei - zwecks Erprobung wahrer Liebe den Damen gegenüber den Fürsten gaukeln darf. Und schließlich der junge Bassbariton Simon Bailey, der als Strippenzieher Alidoro mit üppigem Zylinder (Kostüme: Nicky Shaw) ein wenig wie ein Zirkusdirektor ausschaut. Am Ende freilich hat er ausgedient: Mit einem letzten Handstreich zum Schlussakkord schickt Angelina ihn einfach weg. Die so leichte Hand, die Regisseur Warner gute drei Stunden lang walten lässt, vermisst man seitens des Dirigenten Roland Böer leider ein wenig. Gewiss spielt das Museumsorchester sauber, klingt, was aus dem Graben kommt, schlank und sängerfreundlich. Aber einen etwas würzigeren, mitreißenderen, vielleicht auch strafferen Rossini würde man sich bereits in der Ouvertüre wünschen. Gewohnt tadellos hingegen der von Alessandro Zuppardo einstudierte und hier auf die Herren beschränkte Chor. Das Frankfurter Premierenpublikum jedenfalls nahm Warners Spielereien und Illusionsbildungen spürbar amüsiert und begeistert auf. AXEL ZIBULSKI |
|
Zauberhaftes Traumspiel Von Rudolf Jöckle Frankfurt zuletzt Premiere hatte. Damals inszenierte Günther Rennert, jetzt führt Keith Warner Regie, in einer Art Gegenspiel zu seinen ernsten Dallapiccola-Arbeiten. Es ist fast 40 Jahre her, dass diese italienisch-französische Version des "Aschenputtel"-Märchens in Gleichwohl spiegelt auch Rossini auf seine Art die Frage nach der Würde und Einsamkeit des Menschen: eben in der Gestalt der geschundenen Angelina, die in dieser "Comédie larmoyant" zur Braut des Fürsten aufsteigt – "belohnte Tugend", wie der Untertitel des Werks bürgerlich preisend feststellt. Keith Warner jedoch geht entschlossen auf das Märchenhafte, den Zauber (es gibt ja im Libretto Jacopo Ferrettis kein "Blut im Schuh" und keine Erbsen zählenden Tauben) zurück: Er inszeniert "La Cenerentola" als Angelinas Traum, und Jason Southgate als Bühnenbildner und Nicky Shaw (Kostüme) sind ihm dabei fantasievolle Partner. Der weise Alidoro, "Erzieher" des Fürsten, dirigiert ihn in einer bunten Mischung aus quirlig-aktionsreicher Buffa-Komödie (schon zur Ouvertüre fallen Schuhe vom Himmel, die Cenerentola automatisch ordnet und in die unsichtbar die Sänger-Spieler schlüpfen) und dunkler Märchenposie. Die Akteure werden sichtbar zu seinen Marionetten, deren Abbilder im kleinen Puppentheater mit schiefem Fernsehrahmen herumtanzen, ehe sie sich traumhaft emanzipieren. Die Zuschauer erleben das alles gleichsam aus Alidoros Blickwinkel, Kulissen bewegen sich nicht geheimnisvoll, sondern man sieht, wer sie bewegt und wie ihre sehr nüchternen Rückseiten aussehen. Das führt zu vielen witzigen Momenten, etwa wenn der Fürst in einer winzigen Kutsche, von einem Karussellpferdchen gezogen, zu Cenerentola fährt und man später das Gefährt als Fahrrad erkennt. Solche Bilder schenken die rechte Leichtigkeit, den Buffa-Pfeffer, und da sprengen auch die durchaus klamaukhaften, freilich virtuos ausgespielten Gags des meist trunkenen Vaters Don Magnifico – Eric Roberts mit markanter Stimme – nicht den Rahmen. Wundervoll dann das Bild des Rondo finale, das sich gegen die üblichen Umarmungen stemmt. Alle weichen zurück, Angelina-Cenerentola verdrängt sie als Gespenster, die man nicht mehr fürchtet, sie steht schließlich jubelnd, allein und frei auf der nächtlich glitzernden Bühne. Nidia Palacios zeigt sie durchaus nicht unterwürfig, doch anrührend in Liebe und Sehnsucht, ihr Mezzo besitzt Wärme, ja betörende Zärtlichkeit ebenso wie bewundernswerte Beweglichkeit in den reichen Koloraturen und Vokalisen. Ein prächtiges Ensemble steht ihr bei: Gioacchino Lauro LiVigni als Prinz Don Ramiro mit recht großer, in mittleren Lagen ausgeglichener, in der Höhe etwas forcierter Stimme; mit Barbara Zechmeister und Atala Schöck als auch vokal umwerfend präsenten, hinterhältigen Schwestern Aschenputtels, mit Nathaniel Webster als durchaus ironischem Diener Dandini, Simon Bailey schließlich als umtriebigem "Zauberer" Alidoro (auch rezitativisch am Klavier) mit angenehm lockerem Bariton. Als "grrrrupo" beweisen sie zudem allesamt hohen Ensemblegeist. 1. Kapellmeister Roland Boer führte das Orchester zu einem warmen, gemütsstarken Orchesterklang (Empfindsamkeit besitzt ja die Musik nicht wenig), die Crescendo-Energien samt deren unterschwelliger Mechanik erreichten dafür hohe Umdrehungszahlen: nicht messerscharf Pointiertes, stets aber Gefühltes und Vitalität. Die rhythmische Sorgfalt vernachlässigte bisweilen auch der sonst zauberisch singende Chor. Großer Jubel. |
|
Oper Frankfurt: Rossinis "Cenerentola" in Keith Warners Inszenierung Von Axel Zibulski Ist einfach zu schön, um wahr zu sein, die Geschichte vom guten Aschenputtel und seinen bösen Stiefschwestern. Vielleicht doch nur ein Traum der ganz Kleinen vom ganz großen Glück? Zumindest in den ersten Minuten seiner Frankfurter Neuinszenierung von Gioacchino Rossinis "La Cenerentola" möchte man es fast glauben: Da liegt Aschenputtel, bei Rossini Angelina geheißen, auf ihrem Bett und vor ihr tut sich der ganze Fürstenhof als Puppenspielkasten auf. Doch was wirklich wahr und was Fiktion ist, das lässt Regisseur Warner in Frankfurt zunehmend offen. So schaut die sparsam gestaffelte, vorwiegend dunkel gehaltene Bühne (von Jason Southgate) zuweilen selbst aus wie ein großes Puppenspiel unter riesigen Händen, in dem sich die Personen wie Marionetten an Seilen bewegen. Andererseits bricht Warner das Bild manchmal zum reinen Kulissenlager auf, indem eben diese auf ihre Rückseite gedreht werden. Oder der Bühnenrahmen bleibt schief. Hübsch anzuschauen ist das immer, und Warner setzt glücklicherweise das Erzeugen und Aufbrechen von Illusionen ganz überwiegend an die Stelle dürftiger Buffo-Opern-Gags, vor denen man hier vorwiegend verschont wird. Überraschungsmomente nicht ausgeschlossen: Als ein gewaltiger Blitz knallend ins Puppenspiel fährt, fährt einem zugleich der Schrecken in die Glieder. Vor zwei Wochen hat Regisseur Warner eine Doppel-Inszenierung zweier Einakter von Luigi Dallapiccola auf die Bühne der Oper Frankfurt gebracht. Dass ihm jetzt mit Rossini im ganz anderen, im komischen Fach eine nicht weniger suggestive, atmosphärisch dichte Regiearbeit gelingt, ist nicht zuletzt der sichtlich durchdachten, quirligen, aber nie slapstickhaften Personenführung zu danken. Da schöpft zum Beispiel Eric Roberts das buffoneske Potenzial des verarmten Barons Don Magnifico voll aus, verfügt zudem über höchste baritonale Wendigkeit. Eine nicht weniger gute Figur macht Nidia Palacios in der Titelpartie, die sie weniger naiv als selbstbewusst anlegt. Ihre nicht allzu große, aber in den Verzierungen wie in den tieferen Lagen ungemein sicher und präsent geführte Stimme nimmt dabei nicht weniger für sich ein. Als herrlich gackernde und keifende Stiefschwestern überzeugen Barbara Zechmeister (Clorinda) und Atala Schöck (Tisbe). Sympathieträger auch in Frankfurt natürlich der junge Fürst Don Ramiro, selbst wenn er, wie Tenor Gioacchino Lauro LiVigni, nur auf einem zur Kutsche umgebauten Fahrrad vorfährt. Anders als ihm fehlt es seinem Diener Dandini in Gestalt von Nathaniel Webster an der letzten vokalen Bühnenpräsenz, auch wenn dieser - auch so eine Spielerei - zwecks Erprobung wahrer Liebe den Damen gegenüber den Fürsten gaukeln darf. Und schließlich der junge Bassbariton Simon Bailey, der als Strippenzieher Alidoro mit üppigem Zylinder (Kostüme: Nicky Shaw) ein wenig wie ein Zirkusdirektor ausschaut. Am Ende freilich hat er ausgedient: Mit einem letzten Handstreich zum Schlussakkord schickt Angelina ihn einfach weg. Die so leichte Hand, die Regisseur Warner gute drei Stunden lang walten lässt, vermisst man seitens des Dirigenten Roland Böer leider ein wenig. Gewiss spielt das Museumsorchester sauber, klingt, was aus dem Graben kommt, schlank und sängerfreundlich. Aber einen etwas würzigeren, mitreißenderen, vielleicht auch strafferen Rossini würde man sich bereits in der Ouvertüre wünschen. Gewohnt tadellos hingegen der von Alessandro Zuppardo einstudierte und hier auf die Herren beschränkte Chor der Oper Frankfurt. Das Publikum jedenfalls nahm Warners Spielereien und Illusionsbildungen spürbar amüsiert und begeistert auf. |
|
Oper: Keith Warner inszeniert Rossinis „La Cenerentola" in Frankfurt zwischen Märchen-Träumerei, Marionetten-Theater und Commedia Aschenputtels neue Welt Von Albrecht Schmidt FRANKFURT. Mit einer blendenden, rundum unterhaltsamen Inszenierung rückt die Oper Frankfurt Gioacchino Rossinis „La Cenerentola" ins Rampenlicht und führt damit dieses Werk, das lange von dem bekannteren „Barbiere" verdunkelt wurde, aus dem Schattendasein. Der britische Regisseur Keith Warner servierte bei der Frankfurter Premiere in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln am Sonntag eine würzige Melange aus Charakterkomödie, Marionettentheater, Märchen-Träumerei, Commedia dell’arte und handfester Realistik – eine Regiearbeit, die gleichwohl nicht zuviel macht, sich der Musik unterordnet, ohne dabei Langeweile aufkommen zu lassen. Angelina, das von den keifenden Schwestern und dem geldgierigen Vater gedemütigte Aschenbrödel, emanzipiert sich am Ende in einem grandiosen Befreiungsakt. Der im Bühnenhintergrund baumelnde Guckkasten wird von einem mächtigen Blitz zerstört. Dem magischen Auge, das als leitmotivisches Emblem die Bühne (Jason Southgate) beherrscht, entzieht sie sich spielerisch und trägt es schließlich in vielfachem Muster auf ihrem Abendkleid (Kostüme: Nicky Shaw). Prinzenhochzeit, Krone und Macht sind für sie als selbstbewusste Frau, die sich in einer neuen Welt zurecht finden wird, keine Lösung mehr. Keith Warner unterstreicht solchen Wandel mit einer exzellenten Lichtregie (Simon Mills) und einem leichtfüßigen Umgang mit der Szenerie: Bühnenversatzstücke präsentieren sich nicht nur im niedlichen Zuckerbäckerstil, sondern auch – ständig rotierend – von ihrer ernüchternden Kehrseite. Und die drollige Kutsche des Grafen, die in der brillant inszenierten Gewittermusik über die Bühne hoppelt und spontanen Szenenapplaus auslöst, offenbart wenig später ihre desillusionierende Fahrradkonstruktion. Die erfrischenden Turbulenzen der Bühne finden ihr Pendant in der motorischen Energie, der klanglichen Schärfe und den rasanten Tempi, die Roland Böer (zuständig auch für die Rezitativbegleitung am Hammerflügel) mit dem Frankfurter Museumsorchester erreicht. Die Herausforderungen der Titelrolle in ihrer Spannweite von elegisch-sehnsüchtigem Tonfall bis zu funkelnden Koloratur-Attacken bestand Nidia Palacios mit Bravour. Ein äußerst vergnüglicher Opernabend. |
|
Rossinis "La Cenerentula" an der Oper Frankfurt Von Markus Häfner Zuerst fürchtet man, es sei wieder eine jener Inszenierungen, die die Opernhandlung am Ende als Wunschtraum der Titelfigur zerplatzen lassen. Da ist das verdächtige Bett, in dem Angelina ("La Cenerentola") während der Ouvertüre erwacht und von dem aus sie sich selbst und ihre Umwelt verkleinert, in einer Puppenbühne, beobachtet. Doch Keith Warners neuste "Cenerentola" an der Oper Frankfurt verläuft in weitaus vielschichtigeren Dimensionen; zeigt kein böses Erwachen, sondern ein schrittweises Erstarken der Titelfigur. Warners Regie wirft Rossinis Aschenputtel-Vertonung in ein spannendes Vexierspiel mit verschwimmenden Grenzen zwischen Räumen und Rahmen, Strippenziehern und Marionetten, Wunsch und Wirklichkeit. Die blaue Iris eines riesigen Auges auf dem Bühnenvorhang zieht den Betrachter wie durch einen Tunnel hinein zum Licht und zum abwechslungsreichen Bühnenbild Jason Southgates. Rossini selbst sah seine Buffo-Opern schon als "Komödien über die Komödie" an - Warner greift diesen Gedanken auf, spielt im Theater mit dem Theater Theater: Kalkuliert dabei, dass artifiziell, multipliziert mit artifiziell, nichts andres als die nackte Realität ergibt. Und so ahnt man den ganzen Abend lang das zeitlos Gültige der Handlungsmotive und Charakterzüge hinter aller Maskerade. Musikalisch trumpft diese "Cenerentola" mit einem Orchesterklang auf, dem Roland Böer einen filigranen Rossini-Ton mit sektperlenklaren Dreiklangsbrechungen, wuchtiger Gewittermusik, liebevoll ausgespielten Kadenzschlussformeln und hochkonzentrierten Accelerandi eingeimpft hat. Leider laufen letztere noch nicht immer rhythmisch präzise mit den Gesangsstimmen überein. Außer bei Simon Bailey als Alidoro und Nathaniel Webster (Dandini), die eine rundum brillante Vorstellung abliefern, gerät manche Stretta mit hohem Tempo und hoher Textdichte zur Wackelpartie. Doch je später der Abend desto sicherer die Solisten. Nidia Palacios singt die sehr schwere Titelpartie mit in den Extremlagen enger, insgesamt aber souveräner Mezzosopranstimme, und Gioacchino LiVigni gibt einen am Ende strahlend klaren Don Ramiro. Kein perfekter Opernabend, aber ein sehr sehenswerter. |
|
FRANKFURTER NÄCHTE "La Cenerentola" Lieber Leser, hier sind die Antworten auf die drängendsten Fragen, verfasst 15 Minuten nach der Premiere: Muss man das gesehen haben? Ja. Kann man drei Stunden gerührter, erheiterter, belebter verbringen als in dieser Inszenierung? Nein. Zum Schluss noch: Ist es möglich, dass es irgendwo auf der Welt eine Cenerentola gibt, die sich an Geistesreichtum, phantastischer Opulenz und an Tiefgründigkeit nur annähernd vergleichen ließe? Niemals. Keith Warner, einer der ganz großen Opernregisseure, hat alle Figuren, das Aschenputtel (Nidia Palacios) wie ihre Schlampen-Schwestern und auch den Herzog (Gioacchino LiVigni), Rollen spielen lassen – manchmal haben sie Marionettendrähte an den Gelenken, oder sie treffen sich als Schauspieler backstage, und manchmal sieht man sie als Puppen auf einer Puppenbühne hampeln. Alle wollen was von irgendwem. Alle machen deshalb allen etwas vor – den anderen wie sich selber. Außer Cenerentola und auch (ein bisschen) der Herzog. Das wunderbarste Bild in dieser Inszenierung: Der junge Herzog sitzt in seiner Ahnengalerie. Die Ahnen auf den Bildern sind schemenhafte Schatten. Sie singen. Sie singen, dass sie Cenerentola suchen und finden wollen, und man sieht: Dieser junge Herzog ist der allererste, dem eine Heirat aus Liebe und aus Wertschätzung glückt. Roland Böer, der Dirigent, und das Museumsorchester waren großartig drauf. Nächste Aufführung: Donnerstag. Es soll tatsächlich noch Karten geben. Thomas Delekat |