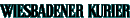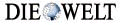|
Zerstäubtes Parfum des 19. Jahrhunderts VON TIM GORBAUCH Gesellschaft hier wie dort. Im Saal herrschen gedeckte Grau- und Blautöne vor, auf der Bühne dagegen, im eher spießig-einfallslos als prunkvoll dekorierten Festsaal der Capulets, wagen die Damen bunte Belle-Epoque-Ausgelassenheit (Kostüme: Kaspar Glarner). Gemeinsam erwartet man ein Spiel, das sich Romeo und Julia nennt. Karen Kamensek, die Dirigentin des Abends, erhält Applaus von beiden Seiten der transparenten Leinwand, die den Bühnenrand markiert. Auf ihr werden im Prolog Bilder des Ersten Weltkriegs projiziert, kämpfende, sterbende Soldaten, kontrapunktiert von der tanzenden Ausgelassenheit einer Gesellschaft, die die Zäsur der Jahre 1914 bis 1918 blindlings ignoriert. Das ist die Welt, in der Charles Gounods Roméo et Juliette spielt. Eine glatte, hohle Welt von gestern, oberflächlich, dekorationssüchtig, dekadent, wie der Regisseur Uwe Eric Laufenberg notiert. Ein sich im Takt der Musik drehender Anachronismus, der nur eins will: Unterhaltung. Sollen sie kriegen. Das Stück, das geboten wird, ist gut, sehr gut sogar, die größte Liebesgeschichte der Weltliteratur, wie es heißt. Bloß: so wie Laufenberg sie erzählt, ist davon nicht mehr viel übrig. Laufenberg macht aus seiner Distanz zu der 1867 uraufgeführten Grand Opéra Gounods keinen Hehl. Und in der Tat, Gounod hat das Welttheater Shakespeares auf eine Liebestragödie reduziert, ganz ähnlich wie er auch mit Goethes Faust umging. Er zerstäubt das Parfum des 19. Jahrhunderts, malt zart-innige, selig-entrückte Tableaux' und setzt auf bittersüße Melodien, in denen der Kitsch nicht nur als Vermutung steckt. Er verurteilt all die, die nicht die Liebenden sind, zur Komparserie und gibt ihnen kein eigenes Gesicht. Mercutio ist nicht der Rede wert, sein Tod ein Nebensatz, genauso wie der Tybalts. Nicht mehr als ein Spiel Doch weil Laufenberg einerseits die theatrale Kraft fehlt, gegen die Defizite anzuarbeiten und Lücken zu füllen, andererseits der Mut, das Drama entschlackt und also klischeefrei auf die Bühne zu bringen, entscheidet er sich dafür, dass alles nur ein Spiel ist. Inszenierung. Theater. Manchmal auch bloß Posse. Dieser Kniff erlaubt es ihm, mit Alltagsgesten nur so um sich zu schmeißen und Lampignons und güldene Vorhänge über die Bühne zu tragen, es ist ja eh nur ein Zitat. Es tut bloß so, als ob. Aber so leicht kann man sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Schon gar nicht, nachdem Christof Loy vor ein paar Wochen mit Mozarts Entführung aus dem Serail, auch das nun wirklich kein unproblematisches Werk, die emphatische Idee dramatischer Glaubwürdigkeit für die Oper wiederentdeckt hat. Laufenberg, ab der Spielzeit 2004/05 Intendant des Hans-Otto-Theaters in Potsdam, will dagegen gar nichts. Weder Wahrheit noch theatrale Spiellust. Seine Inszenierung wird getrieben von der Ratlosigkeit, mit der er auf Gounods Shakespeare-Aneignung blickt. In der Liebesnacht des 4. Akts, die sich unter einer Bettdecke Schutz sucht, gibt er schließlich den Gedanken des Spiels im Spiel preis und kokettiert ungeniert mit dem Illusionismus der Großen Oper, nur um dann im 5. Akt die Liebenden ihren Duetttext wieder vom Blatt ablesen zu lassen. Zuvor schon sind die Mittel, mit denen Laufenberg sich von der Handlung distanziert, brüchig und setzen vor allem auf Effekte. Im eintönigen Festsaal der Capulets, dessen Rückseite das Zimmer der Juliette wie ein Bilderrahmen verziert (Bühne: Gisbert Jäkel), tragen Diener Schriftsymbole in Bulettenform, die das Buffet repräsentieren, während alles andere unmittelbar und ohne Ironie die große Gesellschaft vorgaukelt. Der spielerisch-reduktionistische Flirt mit der Schriftkunst bleibt äußerlich und letztlich genauso folgenlos wie die müden Versuche, die Oper zu skandalisieren. Die schöne nackte Frau im 1. Akt, die plötzlich verblüht und in ihrer ganzen Hässlichkeit an der Rampe steht und ins Parkett glotzt. Die angedeuteten Orgien des Bruder Laurents, der Roméo und Juliette trauen wird, kaum dass er seine Hose zugeknöpft hat - Fluchtversuche eines Regisseurs, der auf der Bühne den roten Faden nicht findet und ihn dafür im Programmbuch postuliert. Die Musik hat solche Probleme nicht. Karen Kamensek will nämlich gerade keine Distanz, sondern bruchlose Nähe zu Gounods Partitur, die sie genial findet und zu Unrecht verkannt. Und so lässt sie romantische Schönheit zu, die gleichwohl mehr drame lyrique als grand opéra ist, die sich verhalten gerinnt und nicht zu großen Posen gerinnt und die sich in einem zart ausgehörten, luziden, vielfarbigen, mithin allerdings auch etwas schleppenden Gesamtklang artikuliert. Die Titelpartien sind in guten Händen, mit weit ausgreifender Wärme Juanita Lascarro als Juliette, Größe und tenorale Festigkeit ausstellend dagegen Joseph Calleja als Romeó. Ihre Biografie der Liebe hat Eduard Hanslick in Gounods Oper vertont gesehen. Heute hätte er sie nur hören können. Oper Frankfurt: 10., 12., 17., 19., 21., 27. Dezember 2003 und 3. Januar 2004. [ document info ]Copyright © Frankfurter Rundschau online 2003 Dokument erstellt am 08.12.2003 um 17:24:22 Uhr Erscheinungsdatum 09.12.2003 |
|
Der berühmteste Liebestod der Welt findet nicht statt Von Michael Dellith Kräftige Buhs für die Regie, aber auch Bravo-Rufe für die musikalische Darbietung schallten am Ende den Künstlern entgegen. Was war geschehen? Statt im tragischen Finale gemeinsam zu sterben, hatten Romeo und Julia ihre Textbücher hinter sich geworfen und waren einfach von der Bühne geeilt. Ein Happy End? Regisseur Uwe Eric Laufenberg und sein Bühnenbildgestalter Gisbert Jäkel haben gemeinsam mit dem Kostümbildner Kaspar Glarner Gounods Oper über die berühmteste Liebe der Welt nicht etwa in die Shakespeare-Zeit zurückversetzt, sondern in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts vorverlegt – und sie als Spiel im Spiel inszeniert. Noch bevor die Vorstellung beginnt, tummelt sich auf offener Bühne die vergnügungssüchtige Gesellschaft in einem mondänen Tanz-Restaurant – gleichsam als Spiegelbild zum Treiben im Parkett und auf den Rängen. Die Gäste losen aus, wer welche Rolle in dem Spiel "Romeo und Julia" erhält. Erst dann beginnt die Oper. Für den Regisseur teilt sich das Drama in zwei Teile: in die ersten drei vom Festcharakter bestimmten Akte, die er revueartig vorüberziehen lässt, und in die beiden letzten Akte, die ganz auf das Liebespaar konzentriert sind. Dabei mangelt es Laufenbergs abstrakter Inszenierung nicht an überbordender Fantasie. In der Fülle der symbolhaften Andeutungen ist auch so mancher alberne und geschmacklose "Gag" wie der Auftritt der weiblichen Nackedeis, die Lebkuchenherzen für die beiden Liebenden oder die slapstickartigen Fechtszenen. Vortrefflich hingegen sind die Video-Projektionen von Schreckensbildern aus dem Ersten Weltkrieg auf einen Gaze-Vorhang zum Chor-Prolog, in dem die Fehde zwischen den beiden Veroneser Familien besungen wird. Problematisch an dem Regiekonstrukt ist jedoch, dass es eine Identifikation mit den Bühnenfiguren erschwert, wo doch gerade die Musik eine solche immer wieder heraufbeschwört. Die Amerikanerin Karen Kamensek vermied am Pult des Opernorchesters jeglichen "Ave-Maria"-Kitsch, indem sie Gounods fließende Melodik straff gestaltete und fast impressionistische Klangvaleurs aus dem Orchestergraben zauberte. Auf der Bühne glänzte der von Alessandro Zuppardo einstudierte Chor mit hoher Piano-Kultur, und Michael McCown (Tybalt), Simon Bailey (Paris), Johannes Martin Kränzle (Graf Capulet), Nathaniel Webster (Mercutio) und Elzbieta Ardam (Gertrude) gaben eine prächtige Ensembleleistung. Juanita Lascarro, als Juliette nach Manon und Lulu in ihrer dritten großen Partie, gewann trotz leichter Indisposition immer mehr an darstellerischer Intensität und stimmlicher Leuchtkraft. Die Entdeckung des Abends aber war der maltesische Tenor Joseph Calleja, dessen sanft bebendes Timbre sich wunderbar an Gounods Kantilenen schmiegte. |
|
Lauter Nachtigallen statt Lerchen KLAUS ACKERMANN Die Oper des Jahres hat jetzt auch eine Operette im Programm, die eigentlich als lyrisches Drama vorgesehen war. Doch permanente Partylaune, das Gewirr an Spielstationen und die farbenfreudigen Kostüme einer Gesellschaft, die ihren Tanz auf dem Vulkan mit Hingabe zelebriert, drängten den Tragödien-Kern von Charles Gounods "Roméo et Juliette" in der Inszenierung des Uwe Eric Laufenberg bewusst an den Rand. Selbst der konstant lyrische Fluss einer romantischen, von Karen Kamensek am Dirigierpult des Frankfurter Museumsorchesters spannungsvoll verdichteten Musik war über weite Strecken pure klangliche Wohltat. Allein die Titelhelden Joseph Calleja und Juanita Lascarro behaupteten Opernpositionen. Mit Stimmkraft und unbeeindruckt von den vielen szenischen Fesseln eines Spiels im Spiel. Der musikalischen Seite dieser 1867 uraufgeführten Gounod-Oper galt dann auch der Frankfurter Premierenbeifall, während der Kölner Regisseur und sein Team den heftigen Buhrufen trotzig widerstanden. Die rauschende Ballnacht ist schon zugange, bevor das Licht erlöscht. Von Ausstatter Gisbert Jäkel an Festtafel, Chambre séparée, Balkon, Bartresen und sonstigen Plattformen veranstaltet. Und Kaspar Glarner scheint für seine vielfarbigen Festtagsgewänder den Theaterfundus regelrecht geplündert zu haben. Nummergirls weisen auf Stationen des Fests hin, über das zur Ouvertüre ein Film von der Front des Ersten Weltkriegs wie ein Damokles-Schwert schwebt: Kriegselend konterkariert die kaum beeindruckte Feiergesellschaft. Juliette ist lediglich eine Besucherin, die mit anderen Gästen Shakespeares berühmte Tragödie nachspielt. Und urplötzlich die große reine Liebe entdeckt, was selbst den eher milde balzenden Roméo zu verblüffen scheint. Beider Empfindungen werden noch durch eine Art Traumebene überhöht. Da regiert nicht nur Eros in Person einer willigen nackten jungen Frau, sondern die Geschichte wird Autor Kishon eingedenk sogar weitergedacht: Eine ältere Nackte pirscht sich an Roméo heran, viel Mut zur Hässlichkeit beweisend. Wie Uwe Eric Laufenberg, bis 1990 Ensemblemitglied des Schauspiel Frankfurt, überhaupt bittere Kommentare schätzt. Ein weißer Mond überstrahlt die Szene, von den Akteuren hin- und herbewegt. Die verfeindeten Familien Capulet und Montague sind streunende Müßiggänger, die sich Masken überstreifen, wenn sie nicht erkannt werden wollen. Juliette raubt Roméo ein riesiges Honigkuchenherz, Bruder Laurent (Danielle Tonini), der die Liebenden traut, um die Familienfehde zu beenden, scheint von Lustknaben umgeben. Die Eheschließung gedeiht zur fröhlichen Massenhochzeit. Herrlich komische, freilich tödliche Prügeleien, erweisen sich als raffinierte Ballett-Stunts. Erst wenn die Lerche statt der Nachtigall singt, ist das Paar auf weißen Laken endlich allein, doch wirkt die Intimität betont beiläufig. Wie der Shakespeare gemäße Scheintod bei larmoyant geisterhaftem Spuk. Da darf sogar Juliettes Vater in lichter Höhe eine imaginäre Orgel spielen - Johannes Martin Kränzle gibt dem Graf Capulet ein geradliniges baritonales Profil, das seinem Alkoholiker-Status entschieden widerspricht. Hervorragend auch Juanita Lascarro, als Juliette ein ungemein flexibler, glaubwürdiger Sopran. Ebenso stark: Der Tenor des Joseph Calleja (Roméo), dem keine Höhe zu hoch scheint, um sie nicht kernig zu meistern. Der zwar am Ende noch ins Textbuch schielen muss und statt den Liebestod zu erleiden, sich mit Juliette eiligst aus der Szene stiehlt - weil das die Regie eben so will. Stimmlich sehr präsent: Elzbieta Ardams Mezzo (als Amme) und der bewegliche Sopran von Maria Fontosh als Page. Allesamt gut gestützt von Karen Kamenseks grazilem Dirigat, das starke Melos ideal positionierend und romantischen Klang feinfühlig aufhellend. Der von Alessandro Zuppardo einstudierte Chor ist szenisch stark beschäftigt - und kann so ein paar klangliche Härten nicht verhindern. Ein kitschiges rotes Riesenherz, durchbohrt von Schwertern bringt Gounods Shakespeare auf einen kompakten visuellen Nenner: Weniger ist hier allemal mehr. Am besten konzertant… |
|
Bettina Müller Gefühlsentzug fürs Rührstück Charles Gounods "Roméo et Juliette" an der Oper Frankfurt Von Volker Milch Ja ja, das "Ave Maria": Ein Ohrwurm, der durch anderthalb Jahrhunderte gekrochen ist, sich gerne in vorweihnachtlichen Fußgängerzonen breit macht und dort auf die Tränendrüsen drückt. An jenes süßliche Opus auf der Basis von Bachs C-Dur-Präludium aus dem Wohltemperierten Klavier muss man stets denken, wenn von Charles Gounod die Rede ist. Armer Tonsetzer. Aber irgendwie hat er, der als junger Mann Priester werden wollte, den Fluch des Präludiums doch verdient. Eine gute Portion Sakralkitsch findet sich auch in seinem Opernschaffen, etwa in Gretchens Himmelfahrt aus "Faust" oder eben in "Roméo et Juliette", der Shakespeare-Oper, die jetzt in Frankfurt Premiere hatte. Der Regisseur Uwe Eric Laufenberg, einst Schauspieler im Frankfurter Ensemble, und sein Bühnenbildner Gisbert Jäkel unterstreichen die religiös grundierte Affinität von Herz, Schmerz und Kitsch schon im Bühnenbild: Das symbolträchtige Zentralorgan steht in der Mitte der Bühne, dient als Dolchhalterung für die bekannte Familienfehde der Capulets und Montagues und könnte auch Zielscheibe für Messerwerfer sein. Man ist jedenfalls eher im Varieté als in der Tragödie. Später, wenn Romeo und Julia getraut werden, erglüht sogar ein flammendes Herz - die schwüle Ästhetik passt nicht schlecht zum melodischen Zuckerwerk, das in der Partitur dominiert und "Roméo et Juliette", wenn die Besetzung stimmt, zu einem Leckerchen zumindest für Vokalgourmets macht. Mit Juanita Lascarro und dem samtweich timbrierten Joseph Calleja macht Frankfurts Oper ihrem stolzen Titel als "Opernhaus des Jahres" zumindest stimmlich wieder alle Ehre, auch wenn die passend jungmädchenhafte Sopranistin zunächst ein paar Schärfen in der Höhe zeigt. In den großen, vorzüglich gesungenen Duetten taut das Publikum sichtlich auf und spart denn auch im Schlussbeifall nicht am Applaus für die Solisten und die Freiburger Generalmusikdirektorin Karen Kamensek, während die Regie ein bitterböses Buhgewitter über sich ergehen lassen muss. Womöglich wird Laufenberg, dem designierten Intendanten des Hans-Otto-Theaters zu Potsdam, verübelt, dass er die berühmteste Liebesgeschichte der Welt, in der Gounod und seine Librettisten Jules Paul Barbier und Michel Florentin Carré vergleichsweise schonend mit Shakespeares Original umgehen, gleichsam in Anführungszeichen setzt: Die Romanze scheint nur eine Partylaune zu sein, geboren auf einem rauschenden Fest, das von Kaspar Glarners Kostümen her im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts angesiedelt ist. Pariser Salons sind in jedem Fall näher als Veronas Paläste - und die Einblendung von flimmernden Kriegsdokumentationen stützt die Vermutung, dass es sich um einen Tanz auf dem Vulkan einer Zwischen- oder Bürgerkriegszeit handelt. Später gibt es Gewalt nur noch in ansprechend ästhetisierter Form: Höchst kunstvoll choreografierte Fechtszenen oder ein hübsches kleines Gemetzel in Zeitlupe. Die Festszenen, mit denen die "Fassadengesellschaft der Belle Epoque" vorgeführt werden soll, werden so nicht nachhaltig getrübt. Allerdings gehen auch einige dramatische Restwerte verloren, und trotz der Qualitäten seiner Protagonisten wird "Roméo et Juliette" phasenweise zu einer ziemlich länglichen Angelegenheit. Die Verunsicherung zwischen Komödie und Tragödie ist Programm einer konzeptionell nicht durchweg überzeugenden Inszenierung, in der das Spiel ins Leben abstürzen kann. Auch das Liebespaar scheint zwischen Distanz zur Rolle und Identifikation zu schwanken, bis es am Schluss mit Schwung die Partitur wegwirft und dem Liebestod einfach davonrennt. Solchem Gefühlsentzug steuert Karen Kamensek mit ausgeprägtem Sinn für das Parfüm dieser Musik entgegen: Das Museumsorchester entwickelt einen üppigen, von der Harfe vergoldeten Plüschklang, zeigt aber auch, wie im fugierten Mittelteil des Vorspiels, beherzten instrumentalen Biss. Musikalisch ein gelungenes Plädoyer für einen Gounod auch jenseits des "Ave Maria". |
|
Lovestory im Charleston-Look von Uwe Wittstock Frankfurt/M. - Im Programm eines "Opernhauses des Jahres" macht sich Charles Gounods "Roméo et Juliette" natürlich besser als sein hier zu Lande weitaus bekannterer "Faust". Die Frankfurter Oper hatte zudem viel versprechende Sänger auf die Bühne und mit Karen Kamensek eine energische Dirigentin ans Pult gestellt. Dazu noch mit Uwe Eric Laufenberg einen Regisseur engagiert, der eher für kühne Konzepte steht als für kulinarisches Musiktheater. Man durfte gespannt sein. Die Liebe zwischen Romeo und Julia war stets mehr als nur erste Teenager-Leidenschaft. Sie war zugleich ein Aufbegehren der Jugend gegen die Alten, die sie in eine zerstörerische und zerstörte Welt hineingeboren haben. Laufenberg macht aus diesem Jugend-Protest schon während der Ouvertüre ein abgekartetes Spiel: Er verlegt das Stück in die 1920er Jahre und lässt die zwei Helden auf einem Ball auslosen. Ihre Liebe ist kein Akt eines schönen Widerstandes gegen die schlechten Sitten der Eltern mehr, sondern Teil eines allumfassenden Unterhaltungsprogramms. Romeo und Julia hängen sich ihre Rollen um wie Lebkuchenherzen: ein wenig kitschig, ein wenig banal. In einer postmodernen Zeit, in der die jeweils nächste Jugend-Rebellionen längst schon zum ritualisierten Bestand des politischen Alltagsgeschäfts zählt, ist das nicht ohne Reiz. Laufenberg gewinnt dem romantischen Liebesdrama einige eindrucksvoll schräge Bilder ab. Ein beträchtlicher Teil des Publikums mochte die Formen zeitkritischer Aktualisierung in Kostüm der Charleston-Ära allerdings nicht und buhte. Begeisterung hingegen ernteten Sänger und Dirigentin. Joseph Calleja präsentierte einen stimmkräftigen, aber schauspielerisch hölzernen Romeo. Juanita Lascarro dagegen steigerte sich jenseits aller postmodernen Rollenspiele ganz ins Schicksal ihrer Julia hinein. Auch Maria Fontosh als Stéfano, Michael McCown als Tybald und Daniele Tonini als Laurent lieferten ansprechende Leistungen ab. |
|
Ärgerliche Mogelpackung Von Thomas Tillmann Uwe Eric Laufenberg, dessen belanglosen Gianni Schicchi in Oldenburg ich noch in unangenehmer Erinnerung habe, hat herausgefunden, dass Gounods Oper in den ersten drei Akten durch das Genre "Ballmusik" dominiert wird: "Mit all den Chören, Walzern und Konversationsensembles haben wir es hier mit einem permanenten Fest, einer zur Permanenz verurteilten Fröhlichkeit zu tun", wir bleiben "bei Gounod im abgeschlossenen Raum des Balles", und überhaupt ist diese Oper "ein höchst subjektives Destillat von Shakespeares Tragödie", ein "Kind der zweiten Jahrhunderthälfte, ihres Oberflächlichkeitskultes, ihrer Dekorationssucht und Dekadenz" und dazu auch noch eine "Grand opéra mit sämtlichen pompösen Ingredienzien" - pfui Teufel, und mit so etwas muss der zukünftige Intendant des Hans-Otto-Theaters in Potsdam sein Geld verdienen! Dagegen urteilt die im Programmheft zitierte Silke Leopold ganz zurecht, dass Gounod für seine Oper einen innigen, fast religiösen Ton fand und "der tragischen Liebesgeschichte gegenüber so bühnenwirksamen Ereignissen wie dem Maskenball im Hause der Capulets ... musikalisch eindeutig den Vorrang gab. Selbst der berühmte, ansonsten mit Kritik am Werk nicht geizende Eduard Hanslick hatte sich dafür erwärmen können, dass die vier einzelnen Duette, die einen großen Raum der Oper einnehmen, "gleichsam die Biografie der Liebe zwischen Romeo und Julia von deren erstem Erblühen bis zur tragischen Vernichtung" skizzieren, und Richard Langham Smith spricht im Begleittext zu der EMI-Aufnahme aus dem Jahre 1995 gar von einem "der besten und beständigsten Beiträge zu dem uralten Thema Liebe und Familienrivalität, der den Weg auf die Opernbühne fand"! Guter Rat war da teuer, ebenso wie vermutlich das opulente Bühnenbild und die aufwändigen Kostüme, die der Regisseur bei Gisbert Jäkel und Kaspar Glarner in Auftrag gegeben hatte und die einen vorzüglichen Rahmen für jede üppige Operetteninszenierung darstellen dürften. Statt Verona und 14. Jahrhundert, Garten, Klosterzelle oder gar unterirdische Gruft musste es die sich in Exstase tanzende "Fassadengesellschaft der Belle Epoque, die erst mit den Schüssen von Sarajewo ihr Ende finden wird", sein. Das Werk in diese Zeit zu verlegen, ist trotz mühsamer, wortreicher apologetischer Bemerkungen im Programmheft freilich reine Willkür. Rechtzeitig zu den ersten Takten der Musik wird in der Mitte der Bühne eine Leinwand sichtbar, auf der Kriegsszenen, ein rauschendes Offiziersfest auf einem Luxusliner und Leichenberge in Schützengräben sich abwechseln (Filmsequenzen wie diese von Jakob List zusammengestellten sind im Herbst diesen Jahres offenbar bei der Inszenierung französischer Opern besonders en vogue, mit diesem Mittel arbeitete man auch bei Les Troyens in Mannheim und Paris). Und weil man sich auf einem richtigen Ball ja nicht nur beim Tanzen, Schlemmen, Trinken und Flirten langweilen will, muss ein Gesellschaftsspiel her, und was liegt da näher, als Shakespeares Romeo und Julia zur Aufführung zu bringen? Flugs ziehen die Partygäste aus einer Lostrommel ihre Rollen für das geplante Spiel, Marie ist die Julia, Tony Romeo (die Namen der Figuren scheinen aus Bernsteins West Side Story übernommen zu sein, die Laufenberg offenbar mehr interessiert hätte), und schon kann's losgehen. Weil der Komponist aber offenbar doch kein vollständiger Idiot war und der "bleibende Wert ..., die Erfindung, die uns heute noch etwas erzählt", die Figur der femme fragile ist, übernimmt Laufenberg Gounods "verlagernde Wertsetzung für das Mädchen" und rückt sie ins Zentrum seiner Inszenierung: "Aus einer Ballbesucherin wird eine Darstellerin und dann - auf dem Höhepunkt eines immer intensiven werdenden Identifikationsprozesses - die wirkliche Julia, die man vergeblich von ihrer Obsession abzubringen versucht. Aus dem Spiel wird wieder tödlicher Ernst." Die letzten beiden Akte, vom Regisseur als "Nach dem Fest" überschrieben, fasst der offenkundig auch literarisch hoch begabte Bühnenbildner zusammen: "Die Dekorationen sind abgebaut. Aber ein Fehler hat sich eingeschlichen. Ihr ist es ernst geworden, der Marie, die das große Los gezogen hatte, das Los der Julia. Die liebt ihren Romeo wahrhaftig. Sie will mit ihm bleiben, für immer, lebendig und tot. Die Marie empfindet wie Julia! Sie ist Julia! Sie ist wohl verrückt geworden ..." Diese Demenz wird ihr helfen, die von Gounod eingefügte Hochzeit mit Pâris durchzustehen, der sie zusammen mit seiner Truppe gleich noch vergewaltigen darf. Tony-Roméo singt sein "C'est là" zu Beginn des fünften Aktes vom Notenpult aus - ein gänzlich neuer Verfremdungseffekt, den man wirklich noch nie gesehen hat! -, das "Paar" sitzt auf Stühlen während des finalen Duetts (natürlich passt der gesungene Text manches Mal nicht zu dem, was man auf der Bühne zu sehen bekommt!), und obwohl Tony doch durchschaut hat, dass die Geschichte mit Marie-Juliette nichts weiter war als eine Farce, nimmt er dennoch Roméos Gift, während das Mädchen sich nicht entschließen kann, sich zu erstechen: Die Protagonisten werfen am Schluss nur den Klavierauszug weg und entfernen sich. Während die Regie in den intimeren Momenten jeglichem Stillstand misstraut und überflüssige Nebenhandlungen meint einfügen zu müssen, produziert sie selbst die längste Zeit bei aller Betriebsamkeit lähmende Langeweile - das laute Gähnen eines genervten Zuschauers sprach mir aus der Seele! -, zumal einem die Figuren letztlich fremd bleiben, man eine kluge Personenführung vermisst und einem unangenehm auffällt, dass sich doch sehr viel an der Rampe oder auf dem Pavillon-Podest vorne rechts abspielt. Ärgerlich fand mancher Zuschauer wohl auch, dass Frère Laurent von einigen halbseidenen Damen, mit denen er sich zuvor vergnügt hat, für die Trauung angezogen wird, dass die tuntigen Ministranten in Flip-Flops erscheinen (die waren in diesem Sommer modern!) und dass die natürlich anwesenden Ballgäste wie das Brautpaar bei dieser Juxheirat Ringe tauschen. Ebenso überflüssig ist die Klamaukfechterei, die in eine Gruppenkeilerei ausartet und dann auf einmal doch ernst sein soll (für die Kampfchoreografie hatte man extra den von der Essener Folkwang-Schule bekannten Klaus Figge verpflichtet, einen Weggefährten des Regisseurs, was einen auch den Kopf schütteln lässt). Am Ende des dritten Aktes muss dann auch noch gesprochener Dialog eingefügt werden (etwa "La fête est finie"), um das eben nicht durchgängig stimmige Konzept zu stützen - noch Fragen? Ungläubiges Staunen befiel mich bereits nach den ersten Tönen von Juanita Lascarro, deren Lulu meinem Kollegen Ehresmann vokal schon nicht überzeugt hatte (sie war in Frankfurt auch als Emma in Schuberts Fierrabras und als Massenets Manon zu erleben) und angesichts deren Leistung als Juliette ich mich bereits während der Ariette fragte, wie sie es überhaupt an ein mittleres Haus geschafft hat und mit welcher Berechtigung sie im kommenden Jahr am Royal Opera House in London debütieren darf. Natürlich ist die Kolumbianerin eine zierlich-mädchenhafte, attraktive, exotische Frau mit einiger Ausstrahlung, aber wir drehen ja keinen Film, sondern machen Oper, und obwohl der Regisseur es so eingerichtet hatte, dass sie fast alle anstrengenden Passagen am Bühnenrand oder auf dem erhöhten Podest singen durfte, musste sie ihr dünnes Stimmchen, dessen unangenehmste Lage die bald zittrige, bald spitze, meistens weiße und nicht immer zuverlässige Höhe ist, arg forcieren, was streckenweise ein ausladendes Vibrato zur Folge hatte - ein paar verinnerlichte Töne in der Mittellage reichen da als Entschädigung nicht, zumal die Künstlerin auch den virtuosen Anforderungen der Partie nur mit einiger Mühe gerecht wurde und wahrlich keine raffinierte Gestalterin ist. Eine erstklassige Besetzung der zweiten Titelpartie war dagegen der erst 25jährige Joseph Calleja, der sich in der vergangenen Spielzeit als Rodolfo in Frankfurt vorgestellt hatte, inzwischen auch in Wien in La Sonnambula auftrat und dorthin für I Puritani zurückkehren wird (zur Zeit bereitet er auch sein Met-Debüt vor und wird ein Arienrecital für die Firma Decca aufnehmen, die ihn zur Probe schon einmal die Einwürfe Alfredos in Renée Flemings Einspielung von Violettas "E strano" hat singen lassen; seine hochgelobte Mitwirkung bei der Dynamic-CD und -DVD von Maria Stuarda verschweigen die offiziellen Biografien dagegen zu Unrecht!). Der Paul-Asciak-Schüler bringt den angemessen leichten Ton und großes Stilgefühl mit, er hat ein leichtes Vibrieren in der geschmeidigen, hell, edel und weich timbrierten Stimme, das an das Moussieren eines guten Champagners erinnert, er hat den nötigen Glanz und die Strahlkraft in der völlig mühelos erreichten Höhe, sein vorbildliches Legato und eine perfekte Atemkontrolle erlauben ihm eine elegante Phrasierung, eine vollendete messa di voce und berückende morendi - bereits sein "Ah! lève-toi, soleil!" wurde zum Showstopper und löste "Bis"-Rufe aus. Dennoch wurde besonders im letzten Akt deutlich, dass der Roméo für den Malteser eine Grenzpartie ist und dass der Tenor, der trotz seiner in einem Interview beklagten Probleme, sich in eine Figur einzufühlen, die ständig zwischen Tony und Roméo hin und her wechseln müsse, auch darstellerisches Format entwickelte, keinesfalls schwerere Rollen in Angriff nehmen sollte. Johannes Martin Kränzle überzeugte als offenbar alkoholkranker Capulet nicht nur dank seiner Bühnenpräsenz und mit gutem Französisch, sondern auch mit elegant geführtem Bariton und der nötigen légèreté, während Daniele Toninis hinsichtlich des Materials grundsätzlich imponierender, aber reichlich steifer, grobkörniger Bass einige heiser-metallische Nebengeräusche aufweist (er gab den Frère Laurent). Elzbieta Ardam war mit reifem, aber intakten Ton eine deutlich aufgewertete Gertrude, Nathaniel Webster mit leichtem Bariton nicht nur in der Ballade von der Königin Mab ein Gewinn als Mercutio. Maria Fontosh brachte die nötige Geläufigkeit und eine interessante metallische Farbe für die Hosenrolle des Stéfano mit, während mir Michael McCown mit seinem quäkigen Tenor als Tybalt nicht unerheblich auf die Nerven ging, Gérard Lavalle ein abgesungener Grégorio war und Simon Bailey und Franz Mayer als Pâris respektive Duc keinen erwähnenswerten Eindruck bei mir hinterließen, anders als die vom neuen Chordirektor Alessandro Zuppardo gut einstudierten Chöre. Nach etwas wuchtigem Beginn setzte Karen Kamensek, die in Frankfurt bereits The Turn of the Screw und La Traviata dirigiert hatte und seit Spielzeitbeginn als Generalmusikdirektorin in Freiburg tätig ist, im weiteren Verlauf eher auf Sorgfalt und Dezenz (namentlich in den Entr'actes) und tat alles, um dem Vorwurf der Süßlichkeit entgegenzuwirken, was dazu führte, dass einem das Werk nicht wirklich unter die Haut ging - ein bisschen raffinierter und vor allem mitreißender hätte das Spiel des ansonsten gut disponierten Museumsorchesters schon sein dürfen! FAZIT Die Theaterleitung hätte Uwe Eric Laufenberg davon abbringen müssen, den Zuschauern zuerst erklären zu wollen, wie schlecht Gounods Oper ist, um dann auf dieser Erkenntnis aufbauend eine eigene Geschichte zu erfinden, die weder spannend noch schlüssig erzählt wird. Wenn man mit einem Stück nichts anfangen kann, dann unterschreibt man den Vertrag nicht oder löst ihn auf, wenn man vor der Unterzeichnung keine Zeit hatte, sich mit dem Werk angemessen auseinander zu setzen. Das Frankfurter Premierenpublikum entlarvte die ärgerliche Mogelpackung durch ein selten so einhellig gehörtes Buhkonzert am Ende, feierte aber die Sänger, besonders natürlich Joseph Calleja, der sich auf dem Sprung zur ganz großen Karriere befinden dürfte. |