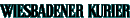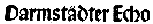|
Heinrich in der Langzeitpflege Faust leidet. Er kann die Fernbedienung für das Fernsehgerät nicht mehr halten: Parkinson. Seine grauen, strähnigen Haare unter der Wollmütze hat er auch schon lange nicht mehr gewaschen. Wie auch, wenn er sich nur mit Mühe aus seinem schäbigen Armsessel herausschälen kann. Immerhin hat er das den anderen, dumpf vor sich hin starrenden Insassen des Altenheims voraus. In ihm regt sich noch etwas. Und sei es als Widerstand gegen den Pfleger, der ihm nach einem Sturz auf die wackligen Beine helfen möchte. Der Aufenthaltsraum für die Insassen dieses Hauses ist von einer erbarmungswürdigen Trostlosigkeit, die der Wirklichkeit wohl in keinem noch so kleinen Detail widerspricht. Nur das Christuskreuz in der linken hinteren Ecke ist größer als in jeder anständigen Sozialstation. Wie ein monumentales Damoklesschwert hängt es symbolträchtig über der Szenerie. Aber wenn Faust seinen Mund öffnet, geschieht etwas, was in diesem Ambiente und von diesem gebrochenen Mann niemand für möglich gehalten hätte. Er kann noch singen. "Umsonst befrage ich der lichten Sterne Chor" geht ihm so lyrisch-pathetisch von den Lippen, wie es Charles Gounod, der Komponist der Grand Opera für die kleinen Leute, in seiner reich dekorierten Partitur für Liebeskranke, aber sonst durchaus physisch Gesunde als melodische Schaumkronen seinen scheinpolyphonen instrumentalen Mischklängen aufgesetzt hat. Kritische Zeitgenossen haben Giacomo Puccini vorgeworfen, mit seiner "Boheme" eine unappetitliche Spitalgeschichte auf die doch bis dahin mehr für romantische Illusionen zuständige Opernbühne gebracht zu haben. Die eiskalte Dachstube mit der schwindsüchtig hüstelnden Mimi ist freilich gar nichts gegen jenen Ort, an dem der Regisseur Christof Loy und sein Bühnenbildner Herbert Murauer eigentlich ganz ohne inszenatorische Not diesen "Faust" von Gounod - zumindest in den umrahmenden Akten - spielen lassen: im Heim für Langzeitpflege, Abteilung senile Demenz. Wenn Mephisto sein Zauberwerk vollbracht hat und der wieder jung gewordene Faust im dritten Akt seine Verführungskünste erfolgreich an Marguerite erprobt, geschieht das in einer ebenso gespenstisch echt wirkenden Plattenbauwohnung: wenigstens ein Ortswechsel, der nicht mit physisch-psychischem Verfall einhergeht, den betörenden Gesang von Faust und Marguerite somit zwar möglicherweise als Stilbruch, aber nicht als medizinische Absurdität erscheinen läßt. Allerdings fragt man sich auch hier, ob sich da nicht wieder einmal durch dramaturgische Beliebigkeit eine nahezu unerträgliche Diskrepanz zwischen Szene und Musik ergeben hat. Gounods schwelgerisch strömender Orchesterklang und seine elegant geführten Gesangslinien passen so vorzüglich zu dem eher auf das Volksstück, weniger auf Goethes Weltendrama zurückgehenden Libretto Jules Barbiers wie die Musik von Bernard Herrman zu Hollywood-Filmen: üppiger Klang zu großen Gefühlen. Üppigen, bisweilen berückend zarten, fein ausgehorchten Klang gibt es - dem jungen Dirigenten Johannes Debus und dem gut aufgelegten Frankfurter Museumsorchester sei Dank - zwar auch in dieser Inszenierung; dazu noch große Gefühle durch die für das Ensemble schon fast wie selbstverständlich herausragenden Gesangsleistungen. Allein die fatale Idee mit dem Altenheim, in dem sich Faust am Ende der Oper in seinem Zustand der Schüttellähmung wiederfindet, will nicht recht einleuchten. Dabei hat Christof Loy gerade mit seiner Frankfurter "Entführung aus dem Serail" vor zwei Jahren überzeugend belegt, daß man Opern zeitgemäß inszenieren kann, ohne ihnen eine Regieidee zu oktroyieren. Daß Loys Konzept hier das Thema verfehlt hat, sagt freilich nichts über die darstellerischen Leistungen der Protagonisten auf der Bühne aus. Was sie gestalten, mag falsch sein, aber wie sie es tun, ist mehr als respektabel. Aus hervorragenden Sängern gute Schauspieler zu machen ist offensichtlich eine hervorstechende Qualität des Regisseurs Christof Loy. Das gilt durchwegs für alle Sänger, aber auch für den vorwiegend als phantasievolles Lemuren-Ensemble agierenden Chor (Einstudierung: Alessandro Zuppardo). In Mark S. Doss steht Loy ein Mephisto zur Verfügung, der seinem Part alle schillernden Nuancen zwischen Verführung und Hexenmeisterei, zwischen Drohung und Schmeichelei abgewinnen kann und ihn mit gleisnerischem, eher hellem Baßbariton auch stimmlich beglaubigt. Für den amerikanischen Tenor Andrew Richards wäre der Abend möglicherweise besser verlaufen, hätte er durchgehend einen alten Faust verkörpern können. Als von Schüttellähmung befallener Heiminsasse besaß er geradezu Bruno Ganzsches Format aus dem Film "Der Untergang". Den jungen Verführer nahm man ihm musikalisch nur in den lyrischen Passagen ab, in den vokalen Emphasen fehlten ihm die entsprechende Höhe und ein makelloser Registerausgleich. Nina Stemme dagegen war eine etwas zu bieder angelegte Marguerite, was auch an dem merkwürdigen Fünfziger-Jahre-Outfit (Kostüme: Bettina Walter) gelegen haben mag, nicht aber an ihrem schön geführten, überaus beweglichen Sopran. Es spricht für das Frankfurter Ensemble, die vergleichsweise kleine Rolle des SoldatenValentin, des Bruders Marguerites, mit Zeljko Lui besetzen zu können, einem zugleich kraftvollen, formvollendet phrasierenden und warmen Bariton, der sich hier wieder einmal für die großen Rollen seines Fachs empfohlen hat. Jenny Carlstedt in der Hosenrolle des Siebel, des Verlobten Marguerites, mit schönem, nicht zu großem Sopran, Florian Plock als Soldat Wagner mit sonorem Baß und die ebenso agil spielende wie singende Mezzosopranistin Elzbieta Ardam komplettierten ein Ensemble, das den anhaltenden, nicht einmal durch ein einziges Regie-Buh getrübten Applaus dieser musikalisch-darstellerisch ansprechenden Inszenierung verdient hat. WOLFGANG SANDNER |
|
Nachbarin, euern Tropf! VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Lag es ihm in den Genen, dass er sich so gerne mit dem Allerheiligsten der Kunst vereinigte? Es gelang ihm, dem französischen Komponisten Charles Gounod, das Präludium C-Dur aus dem 1. Band des Wohltemperierten Klaviers von J.S.Bach mit einer so angenehmen Vokalise zu verzuckern, dass es als Ave Marie wunschkonzertnotorisch wurde. Mit ebensolcher Ungeniertheit verwandelte er Goethes Faust zu einer großen französischen Oper, die im Pariser Palais Garnier seit 1869 als nationales Repräsentationsstück zelebriert wurde, während in jenen frühen Jahren Georges Bizets weitaus genialere Carmen mit magerem Zuspruch an der bescheidenen Opéra comique dümpelte. Griff Charles Gounod zu den Sternen oder griffen diese nach ihm herunter? Im Gegensatz zu manchem trockenen Germanistikprofessor oder anderen musealen Bildungshütern hätte Goethe nichts gegen eine melodiöse Faust-Verwurstung in Zucht und Würde gehabt, und sein Sachwalter Thomas Mann fand für die Gounod-Oper verständig liebenswürdige Worte. Die Beschränkung auf den bürgerlichen Dramenteil des Faust I, den ohnedies auch im Worttheater repertoirebeständigeren, war mit guten Gründen kaum anzufechten. Dieser erfuhr ohne dramaturgische Verrenkungen (die dem Mefistofele von Boito einen etwas ruckhaften, fragmentarisch-facettierten Verlauf geben) eine gediegene Kompaktheit. An besonderer, auch unkonventioneller Insiprationswucht fehlt es nicht: Der fast einstündige 2. Akt ist gewissermaßen eine "Kammeroper in der Oper", ein reich aufgegliedertes Riesenquartett des Liebespaares Faust/Marguerite und des etwas vorbehaltlicheren alterserotischen Zwiegespanns Méphistrophélès/Marthe Schwerdtlein. Mag nicht alles von diesem ausgebreiteten Lyrismus aus erster Hand sein, so offenbart sich Gounods Meisterschaft erst recht in den schwungvollen oder pointierten Genreszenen der anderen Akte. Der komponierende Zeichenstift schafft aber auch bereits zu Anfang einen scharf zutreffenden Eindruck des brütenden, trüb grübelnden Faust'schen Greisentums. Wenn sich aus diesem auch mit gelehrtem Fugato-Garn durchhäkelten Orchestervorspiel-Grummeln dann eine zarte Kantilene hervorspinnt, glaubt man, das Porträt einer zierlichen Demoiselle aus der Picardie, also etwas ländlich-sittig Gretchenhaftes auf Französisch, zu erleben. Später merkt man, dass es sich um das Kernlied des treuherzigen, aber rauen Valentin handelte. Anspruchsvolle Sängerpartien Nicht zuletzt resultiert die Beliebtheit dieses Faust daraus, dass es hier fulminant dankbare, wenn auch sehr anspruchsvolle Sängerpartien gibt. Gewaltige Vokal-Prüfsteine werden gestemmt, gewuchtet, geschwungen, bezwungen oder kleingehackt. Manchem Organ wurden sie in der Frankfurter Neuproduktion federleicht und wirbelten daher wie durch Zauberei bewegt. Mit athlethischer Kraft und schwebender Eleganz tänzelte zumal der Méphistophélès von Mark S. Doss durch das Stück, fast wie ein blitzäugiger Wiedergänger von Sammy Davis jr. als Sportin' Life in der Verfilmung von Porgy and Bess; es fehlte nur das Spazierstöckchen. Dafür trug der Teufel bei seinem Auftritt ein kleidsam bizarres altertümelndes Landsknechtshabit mit Federhut (Kostüme: Bettina Walter). Sein kerniger, profunder Bass hinderte ihn nicht an verwegenen Sprüngen und katzenhaft gewandten Gängen, die ihn als allgegenwärtigen Maitre de plaisir erscheinen ließen. Locker und frei entfaltete sich auch die Stimme der Marguerite von Nina Stemme, dargestellt als eine naiv-herzchenhafte Lieblichkeit ohne mondänen Touch, aber als glühende Liebende groß anwachsend. Ein Glücksfall die schlanke Jünglingsgestalt des Faust von Andrew Richards, dessen tenorale Sensibilität den Umschlag von der Altersmüdigkeit zur jugendlichen Emphase spielend realisierte und auch den gefahrvollen Spitzentönen mit plausiblem Gebrauch der gut abschattierten "voix mixte" nicht auswich. Gerdazu stentormächtig der Valentin von Zeljko Lucic; ungewöhnlich charaktervoll auch die Hosenrolle des "Kümmerers" Siebel von Jenny Carlstedt. Besonders diese Partie war durch etliche geöffnete Striche im 3. Akt in der auch philologisch ambitionierten Aufführung (mit viereinviertelstunden Spieldauer eine üppige Ration Oper) aufgewertet. Als Marthe-Verkörperung ähnlich präsent wie kürzlich ihre Klytemnästra in Elektra ( wenn auch ganz anders, nämlich spießig-lauernd, aber auch nachbarschaftlich kordial charakterisiert): Elzbieta Ardam. Für eine durchweg faszinierende Bühnenoptik sorgte die Inszenierung von Christoph Loy, dem nun schon zweifachen Träger des Prädikats "Opernregisseur des Jahres". Als primärer, später modifiziert wiederkehrender Schauplatz exponierte sich keine Studierstube, sondern der kahle Aufenthaltsraum eines Alters- oder Pflegeheims. Pyrotechnische Turbulenzen Faust, ein Lädierter unter Lädierten, hadert mit seinem Geschick. Höchste Zeit, dass in diesem Elend ein Zaubergeist wie Méphistophélès auftaucht und das Ganze kräftig aufmischt. Dann erfährt auch das kunstgerecht triste Bühnenbild von Herbert Murauer pyrotechnische Belebung, und der öde Saal mit Fensterfront zu geschäftig vom Personal durchmessenen Gängen gerät in Turbulenzen. Zum Walzer kann aufs Balletcorps verzichtet werden: die Komparserie und der Chor (klangprächtig einstudiert von Alessandro Zuppardo) wiegen sich schrittlos in hautnaher Tanzseligkeit. Bei durchgängiger sechziger Jahre-Optik kommt im zweiten Akt die gute alte Plattenbau-Ästhetik ins Bild und zur Wirkung. Die aus dem Kriege heimkehrenden Soldaten mit dem jetzt erst recht brutal seine Familienehre demonstrierenden Valentin schmettern ihre patriotischen Gesänge mit karikaturistischen Elan auf der schäbigen Bühne eines Vereinslokals. Mit der Walpurgisnacht driftet der Handlungsbogen wieder ins Seniorenstiftige hinein. Hexenspuk als makabrer Insassen-Budenzauber. Glaubwürdig hier integrierbar der Gefängnisschluss mit Marguerite am Tropf auf ihrem Kranken- und Todeslager. Der Teufel windet sich am Rande. Zum "Gerettet" fahles Licht und eine wunderlich nüchterne allgemeine Verstörung. Loy gelingt es, das mit allerlei "metaphysischen" Zutaten und Tricks angereicherte bürgerliche Liebes- und Eifersuchtsdrama aus intensiven Personenspannungen heraus zu entwickeln und das Stück trotz vehementer Aktualisierungen nicht auseinanderzusprengen oder in beziehungslose Gags aufzulösen. Er nimmt die Intensität des vokalen Ausdrucks so ernst, wie wenn er Verdi inszenieren würde. Dass Faust damit nicht zum Spielball snobistischer "Einfälle" wird, hält diese Arbeit - die an triftigen Einfällen mehr als genug aufweist - stets in einer schönen Balance. Man würde sie - eingeschlossen das sorgfältig zwischen Bühne und Orchester vermittelnde, auf besonnene Weise steigerungsfähige und energische Akzente setzende Dirigat von Johannesa Debus - gerne als einen Höhepunkt der Frankfurter Opernsaison bezeichnen, aber es ist noch mehr: neuerliches Erreichen und Erfüllen einer inzwischen nahezu gleichmäßig hohen Aufführungsqualität, wie man sie hier schon kaum mehr anders erwartet. Faust in der Oper Nach der Faust-Vertonung "Mefistofele" des Italieners Arrigo Boito in der vergangenen Spielzeit präsentiert die Oper Frankfurt nun eine französische Version. Komponist Charles Gounod (1818-1893) konzentiert sich auf die Liebesgeschichte. elb [ document info ] Dokument erstellt am 07.02.2005 um 16:12:04 Uhr Erscheinungsdatum 08.02.2005 |
|
Ein Klassiker im Altersheim HAND AUFS HERZ: Noch einmal die Kraft der Jugend spüren – wer würde dafür nicht seine Seele verkaufen? Dieses menschliche Grunddilemma fesselt im Mythos um Doktor Faust seit Jahrhunderten über die Kulturen hinweg. Die Deutschen haben sich „Faust" – zumindest seit Goethe – vehement auf ihre Fahnen geschrieben und fanden es lange Jahre überhaupt nicht passend, dass italienische und französische Komponisten den hehren Stoff für ihre Veroperungen benutzten. Charles Gounods „Faust" von 1859 wurde im vergangenen Jahrhundert hierzulande noch schamhaft unter dem Titel „Margarethe" aufgeführt – und eigentlich beschreibt dieser Name diese Bearbeitung äußerst passend. Es geht hier – man mag es typisch französisch nennen – vor allem um die Liebesgeschichte von Faust und Gretchen. Frankfurter Opernbesucher hatten jüngst den Vergleich: In Arrigo Boitos „Mephistopheles" sind ungleich mehr „Faust"-Handlungsstränge verarbeitet. Trotzdem ist Gounods Version keinesfalls blutleer: Um die Gretchenfigur spannt sich mühelos ein umfangreicher Opernabend voll packender Charakterstudien. Das trifft schon auf die Musik zu – und auch auf die Inszenierung von Christof Loy. Es ist schon gewagt, einem gesetzten Opernpublikum den alten Faust in der ersten Szene als Insassen eines Altersheim zitternd im Rollstuhl vorzustellen. Loy verpflanzt die allzeit gültige Geschichte in eine ungefähre Ostblockszenerie, die sowohl das Erleben grausamer Kriege als auch tiefe Gläubigkeit der einfachen Menschen in greifbare Nähe rückt (Bühne: Herbert Murauer, Kostüme: Bettina Walter). Gounods Mephistopheles ist hier ein zauberischer Strippenzieher: Wie mit einer teuflischen Fernsteuerung treibt er Menschen durcheinander und führt ihnen die Hand – sei es zur Verführung, sei es zum brutalen Kindsmord. Doch auch seine Macht endet: Marguerites noch im Sterben überirdische Liebe zerstört den Pakt zwischen Faust und Mephisto, ein Auferstehungschoral dringt mit grellem Licht in das Altersheim. Riesenapplaus für Mark S. Doss (Mephistopheles), Zelijko Lucic (Valentin) und die bei aller Stimmstärke noch ungemein berührende Sopranistin Nina Stemme als Marguerite. Kleiner Wermutstropfen: Nicht nur der der bestens studierte Opernchor (Leitung: Alessandro Zuppardo) hatte Abstimmungsprobleme mit dem Dirigenten Johannes Debus: Er sorgte mit einigen Wacklern und oftmals sehr kompaktem Klang aus dem Graben für einige Irritationen. Claus Ambrosius ZWEIMAL FAUST – EIN TEUFEL: Mark S. Doss als Verführer VERGLEICHEN MACHT SPASS: Rund um die großen Gestalten des Macbeth und des Faust gibt es an der Oper Frankfurt Vertonungen verschiedener Komponisten zu erleben. Ein gewagtes Konzept: Schließlich ist nur mit Verdis „Macbeth" ein populärer Kassenerfolg gebucht.
|
|
Walpurgisnacht im Altenheim Von Michael Dellith Die Erwartungen waren hoch gesteckt, hatte doch der Essener Theatermann, der bereits zwei Mal in Folge zum "Regisseur des Jahres" gewählt wurde, in der vergangenen Saison mit Mozarts "Entführung" Furore gemacht. Nun also "Faust" von Gounod – eine Oper, die in Deutschland unter dem Titel "Margarethe" bekannt und deren Ruf hier zu Lande nicht ohne Tadel ist: zu rührselig die Melodien, die Musik eher dekorativ, zu wenig tiefgründig, zu wenig faustisch – so lauten die Vorwürfe. Für einen Regisseur wie Loy, der stets auf der Suche nach dramatischer Wahrheit ist, der dicht am Text arbeitet und die tiefenpsychologischen Schichten freilegen will, stellte dies natürlich eine Herausforderung dar. Kurzum: Es ist ihm gelungen, gegen das "Ave-Maria"-Image des Komponisten anzuinszenieren und zu zeigen, dass Gounods Werk durchaus ironische Brechungen, ja sogar komische Momente besitzt. Gegensteuern hieß also die Devise. Das demonstrierten auf musikalischer Ebene schon bei der Ouvertüre eindrücklich Kapellmeister Johannes Debus und das feinfühlig agierende Museumsorchester mit erdigem, gleichwohl kantablem Streicherklang, ganz auf Schlichtheit bedacht und jeglicher Süße vorbeugend. Entsprechend fiel auch die optische Umsetzung aus: Loy und sein Ausstatterteam, Herbert Murauer (Bühnenbild) und Bettina Walter (Kostüme), verlegten die Handlung in ein Altenheim. Schließlich ist Faust bei Gounod ein alter Mann, der wieder jung sein möchte, um das Leben noch einmal genießen zu können, und deshalb einen Pakt mit dem Teufel schließt. Die Atmosphäre ist entsprechend trist: ein großer Speisesaal, Kachelwände, Suppe schlürfende "Insassen", unwirsches Pflegepersonal (die karge Ausstattung mit dem riesigen Kruzifix und die Kostüme deuten auf Frankreich in den 70er Jahren hin) – und mitten drin der an Parkinson erkrankte Faust mit seinem Gehwägelchen. Folgerichtig spielt auch die albtraumartige Walpurgisnacht mit ihren lüsternen Alten in diesem Heim-Ambiente. Gretchen schließlich haust armselig in einem Plattenbau, wo allein ein paar Blumentöpfe Farbe in das Alltagsgrau bringen. Als größter Pluspunkt der Inszenierung erwies sich neben dem fabelhaften Chor, den Alessandro Zuppardo auf seine vielfältigen Einsätze sehr differenziert vorbereitet hat, die Leistung der Solisten, die Loy allesamt zu erstklassigen Sängerdarstellern geformt hat. Nina Stemme, die demnächst in Bayreuth die Isolde singen wird, verkörperte ein unschuldiges, frommes, fast engelgleiches Gretchen, blieb dabei ganz bodenständig, stimmlich souverän und steigerte sich im vierten Akt bravourös. Der Amerikaner Andrew Richards, der auch den sympathischen, naiven jungen Faust mimte, entfaltete seinen Tenor lyrisch-fein, bewahrte auch bei emphatischen Ausbrüchen Natürlichkeit, während sein Gegenspieler Mark S. Doss, der schon bei Arrigo Boitos "Mefistofele" den katzenhaft-satanischen Verführer gab, in seinem Harlekin-Kostüm die Szene beherrschte und sichtlich Gefallen an seinem attraktiven Bariton hatte. Mit großer Intensität füllte Zeljko Lucic die Partie von Gretchens Bruder Valentin aus – einem Soldaten mit strengem Sittencodex, der vor Brutalitäten nicht zurückschreckt. Elzbieta Adam verlieh der Marthe Schwerdtlein mit ihren hochtoupierten Haaren einen leicht ordinären Touch; liebenswürdig gestaltete schließlich Jenny Carlstedt die Hosenrolle des Verlobten Siebel. So gab es am Ende enthusiastischen Beifall, der mühelos ein paar vereinzelte Buhs für die Regie übertönte. |
|
Teufelspakt zwischen Pflege und Plattenbau Im Altenheim ist der greise Doktor Faustus gelandet. Aus den zitternden Händen fällt ihm die Fernbedienung für den Fernseher, und als er im Gehwägelchen einfach umkippt, hilft ihm ein Pfleger nur reichlich halbherzig auf die müden Beine. Kann man doch verstehen, dass sich so jemand den Teufel nicht nur wünscht, sondern sich auch mit ihm verbündet. Die Szene, mit der Christof Loy in seine Frankfurter Neuinszenierung von Charles Gounods romantischer Oper "Faust" einführt, wird beeindruckend typisch für diese Opernproduktion bleiben. Loy, der in Frankfurt zuletzt Mozarts "Entführung aus dem Serail" inszenierte und vom Magazin "Opernwelt" bereits zweimal zum "Regisseur des Jahres" gewählt wurde, bricht in seiner "Faust"-Inszenierung manchen tendenziell kitschigen Moment auf, den nicht zuletzt Gounods Musik bereithält. Doch zugleich findet er Bilder, die keineswegs nur eine Karikatur des Faust-Stoffs bedeuten, sondern in ihrer Stärke amüsieren und beklemmen. So hat Loy zum Beispiel die Wohnung Margarethes im zweiten Akt ins Erdgeschoss eines tristen Plattenbaus verlegt, vor dem Faust, dank teuflischer Hilfe zum jugendlichen Dandy mutiert, zwischen Topfpflanzen der Angebeteten huldigt (Bühne: Herbert Murauer). Oder der Soldatenchor im dritten Akt, der in so munteren Marschrhythmen vom Krieg erzählt: Er versammelt sich auf einer muffigen Bürgerhaus-Bühne, vor der das weibliche Volk seinen Helden zujubelt. Und ganz nebenbei lässt Loy einen Verwundeten im Rollstuhl zusammenbrechen: Starke Einfälle, die aber keine Einzelmomente bleiben, schon weil die Personenführung über stolze vier Stunden samt zweier Pausen durchweg sorgfältig ausfällt, bis Faust am Ende wieder in der Verwahranstalt angekommen ist. Bereits die Walpurgisnacht war ein Tanz fahler und greiser Gestalten. Musikalisch eher gemächlich und unauffällig sekundiert das Frankfurter Museumsorchester unter der Leitung des Kapellmeisters Johannes Debus, der im ersten Akt zu Loys erstarrenden Chor-Standbildern nicht immer den Kontakt zwischen Graben und Bühne optimal ausloten kann. In vokaler Hinsicht wird dieser Frankfurter "Faust" allerdings zum musikalischen Fest, und das vor allem dank der schwedischen Sopranistin Nina Stemme als Gretchen, hier (man singt Französisch) Marguerite heißend. Anfängliche Naivität wie finales Gebrochensein dieser Figur drückt Stemme mit berückend innehaltendem Pianissimo, fast schon mezzohafter Tiefenschärfung und zugleich mühelos wendigen, silbrigen Höhen phänomenal aus. Als fast schon smarter Méphistophélès im schwarzen Anzug (Kostüme: Bettina Walter) wirbelt Mark S. Doss bereits zum zweiten Mal in teuflischer Gestalt über Frankfurts Opernbühne - er hat dort bereits die Titelpartie in Arrigo Boitos "Mefistofele" gesungen. Als Dr. Faust findet Andrew Richards nach anfänglich uneinheitlich timbrierten vokalen Linien und manch forciert wirkendem Spitzenton bald zu geschmeidiger tenoraler Strahlkraft. Daneben Zeljko Lucic als ganz kultiviert und sonor singender Haudegen Valentin, das helle Timbre von Jenny Carlstedt in der Hosenrolle des Siebel sowie Elzbieta Ardam als Zigaretten rauchende Marthe Schwerdtlein - selbst die vermeintlichen Nebenrollen hat Loy treffend charakterisiert. Den stärksten Jubel gab’s nach der Premiere freilich für das Solisten-Ensemble. AXEL ZIBULSKI |
|
Teufelspakt zwischen den Rollstühlen Von Siegfried Kienzle
Starke, einprägsame Bilder aus unserer heutigen sozialen Tristesse findet der Regisseur Christof Loy für diesen "Faust" in der Oper Frankfurt. Er vermeidet jeden Hauch von Rührstück und Romantik und rückt Goethes Geschichte von Teufelspakt und verführter Unschuld in die Nähe von Janacek: Ein schonungslos sachlicher Sozialbefund wird hingestellt. Das geht unter die Haut, weil Loy, der in Bremen bereits den "Faust" von Berlioz eigenwillig erneuert hat, die Situationen schnörkellos ohne so genannte Regieeinfälle entwickelt. Herbert Murauer hat einen trostlosen Saal in einem geriatrischen Pflegeheim gebaut. Hier verdämmert der alte Faust vor dem Fernseher und schlurft mit seiner Gehhilfe an den Leidensgefährten im Rollstuhl vorbei. Auch die Walpurgisnacht spielt in diesem Krankensaal, bevölkert von Debilen. Die Vorhölle als Abbild der heutigen Vergreisung. Auch Marguerite endet nicht im Gefängnis, sondern in dieser Klinik am todbringenden Tropf. Zuletzt krümmt Faust sich in spastischen Zuckungen am Boden wie zu Beginn. In diesem Kreislauf des Elends bleibt der triumphale Engelchor, der bei Gounod die Erlösung verkündigt, nur ein schattenhafter Nachklang von außen. Packend gelingen Loy die heiklen Chor-Tableaus. Der Soldatenchor ist ein patriotisches Gruppenbild. Während sich die Helden in Uniform feiern lassen, fällt ein Kriegskrüppel tot aus dem Rollstuhl. Die Walzerszene wird zur durchgezeichneten Psychostudie einzelner Gruppen, die von Mephisto gesteuert sich zwanghaft in Zeitlupe bewegen. Zunächst tritt Mephisto auf wie aus dem Bilderbogen des Mittelalters geschnitten: rotes Wams, Hahnenfeder. Mit Fausts Verjüngung verwandelt sich auch der Teufel: Mark S. Doss zeigt bei Gounod den halbseidenen zynischen Strippenzieher. Nicht mit tiefschwarzer Urgewalt in der Stimme, aber virtuos und komödiantisch in "Rondo" und "Serenade". Stimmlich und darstellerisch herausragend Nina Stemme als proletarische Marguerite. Sie lebt im Plattenbau, schlägt sich als Kellnerin durch. Von Mephisto bedrängt, erstickt sie ihr Baby im Kinderwagen. Die Koloraturen in ihrer Juwelen-Arie sind nicht virtuose Verzierung, sondern Sprachverlust. Das ist grandiose Schauspielkunst, wenn die Worte zerbrechen, sich unter dem Überdruck des Gefühls auflösen zu gestammelten Silben. Stemme hat in ihrer Stimme auch die liedhaft verhaltenen Töne für dieses Mädchen aus dem Volk und die Ausbrüche der Verzweiflung. Der Spitzenton in der großen Faust-Arie klingt bei Andrew Richards arg gequält. Doch unterhalb der exponierten Lage zeigt der Tenor imponierendes lyrisches und heldisches Format. Valentin ist bei Zeljko Lucic ein vierschrötiger Familien-Macho. Vor dem Verhaltenskodex, den Lucic mit baritonaler Fülle in seinem Gebet ausbreitet, kann Marguerite nur entsetzt die Flucht ergreifen. Elzbieta Ardam geht hochtoupiert als Marthe auf Männerfang, Jenny Carlstedt als Siebel mit Pferdeschwanz darf diesmal auch die sonst gestrichene Romanze singen. Souverän und mit Gespür für die filigranen Feinheiten der Partitur führt Johannes Debus das Museumsorchester durch den Abend. Viel Begeisterung, weil aus einem Repertoirestück aufrüttelndes Musiktheater wird. |
|
Gretchen im Plattenbau Von Volker Milch
Der Deutsche denkt bekanntlich, während der Franzose das Leben genießt und, oh la la, die Frauen liebt. . . Man kann nun nicht gerade sagen, dass Charles Gounods "Faust" das rechte Stück Oper wäre, um gut abgehangene National-Klischees zu widerlegen: Gounod hat aus Goethens Tragödie bekanntlich ein delikates Rührstück gemacht, in dem neben den weltlichen auch die sakralen Gefühle zu ihrem Recht kommen: Das dicke Kreuz, das in Christof Loys Frankfurter Inszenierung in den Ecken hängt, ist das optische Äquivalent zu Orgelklang und andächtigen Kantilenen. In Gounods klingenden Herrgottswinkeln kann es allerdings auch ungemütlich werden, wie Loy zeigt: In der Kirchenszene, die in einer trostlosen Mehrzweckhalle stattfindet, gewinnt das Requiem dumpfe Bedrohlichkeit und treibt Marguerite, wie unser Gretchen in Frankreich heißt, zur Verzweiflung. Sie hatte es ohnehin nie leicht im Leben, fristet ein gar kärgliches Dasein im Plattenbau: Blumentöpfe ersetzen den Garten. Gegen Gounods Version des Faust-Stoffes ist Arrigo Boitos "Mefistofele" geradezu ein Muster an Werktreue, versucht er doch gerade in der ersten Fassung auch mit Motiven aus dem zweiten Teil eine "ganzheitliche" Faust-Tragödie. Zum Publikumsliebling indes wurde nicht Boitos hochfliegendes Unternehmen, sondern Gounods Gretchen-Story, die nicht ohne Länglichkeiten ist und sich in Frankfurt in den vier Akten der kritischen Oeser-Ausgabe (mit zwei Pausen) über satte vier Stunden erstreckt. Man hält gerne durch, weil Christof Loy spannende Bilder findet und die vokalen Beiträge von hoher Qualität sind - während es unter dem Dirigat von Johannes Debus zwischen Bühne und Orchestergraben vor allem in den Chorszenen einige Wackelkontakte gibt. Nina Stemme, die künftige Bayreuther Isolde, gibt der Marguerite eine anrührend tragische Größe. Spezifisch "französischen" Schmelz wird man bei Andrew Richards´ Faust vermissen, zumal seine tenoralen Höhenflüge keineswegs makellos bleiben. Aber ein paar Kratzer in der Politur passen neben der Kraft der Darstellung zu einem im Leiden starken Faust. Ein großformatiger Valentin ist Zeljko Lucic, Jenny Carlstedt ein zarter Siebel. Sozusagen als Frankfurter Mefistofeles vom Dienst bewährt sich der wendige Mark S. Doss, hat er doch auch in Boitos Oper die Partie des Geists, der stets verneint: Der intelligente Beziehungszauber der Frankfurter Programm-Dramaturgie, die auch Blochs "Macbeth" Verdis Shakespeare-Oper gegenüberstellt, ermöglicht es dem Publikum, verschiedene Versionen des "Faust"-Stoffes zu vergleichen. Christof Loy, 2003 und 2004 von der Opernwelt zum "Regisseur des Jahres" erklärt und in Frankfurt zuletzt mit Mozarts "Entführung" erfolgreich, nähert sich Gounods Werk natürlich nicht mit gefalteten Händen. Er sorgt mit dem Bühnenbildner Herbert Murauer für ein szenisches Kontrastprogramm zum sahnigen Melos und weitet die Gretchen-Tragödie zu einem Drama des Alterns - ein Thema, das angesichts der vergreisenden Gesellschaft und des von diesem Prozess in besonderer Form betroffenen Opernpublikums allemal Interesse für sich beanspruchen dürfte. In Christof Loys Walpurgisnacht wartet statt appetitlicher Hexen der blanke demoskopische Horror der Zukunft: Allein unter Greisen. Faust hat im ersten Bild nicht etwa die Nacht über seinen Büchern vergrübelt, sondern ist nur noch ein Häufchen Elend, das im Pflegeheim vor der Glotze dahindämmert: Da muss ihm Schwester Marguerite als ein rettender Engel erscheinen, und wie ein altdeutscher Volksbuch-Teufel springt Mephisto im roten Samtwams auf die Bühne. Der Kerl hat eine deutlich ironische Note. Einen herrlichen Budenzauber entzündet Loy mit diesem Mephisto, der die marode Elektrik des Saals für pyrotechnische Späße nutzt. Es kracht und blitzt ganz famos, und wie er aus dem Tattergreis einen strahlend jungen Tom-Cruise-Faust zaubert, ist eine Meisterleistung. Am Schluss freilich hat den am Boden zusammengekrümmten Dr. Faust wieder das große Zittern gepackt. Und von Gretchens Erlösung weiß die Musik entschieden mehr als die Szene. |
|
Oper Gretchen lebt im Plattenbau Eine dramatische Inszenierung zu parfümierten Klängen Von Albrecht Schmidt FRANKFURT. Wer kennt nicht jene schmelzend-schnulzige „Ave-Maria"-Melodie, mit der Charles Gounod die Arpeggien des Bachschen C-Dur-Präludiums überzuckert hat? Auch in seiner „Faust"-Oper, die jetzt in Frankfurt (im französischen Original der durchkomponierten zweiten Fassung von 1869) Premiere hatte, findet Gounod zu einer primär lyrisch geprägten, mit französischer Eleganz parfümierten Musik. Dieser Vorlage ein wenig von ihrer Süßlichkeit zu nehmen, tut sich Johannes Debus am Dirigentenpult schwer. Das Frankfurter Museumsorchester präsentiert ein sämig schimmerndes Klangbild, das den Bedürfnissen der Sänger nach schwelgerischem Aussingen zwar entgegen kommt, schärfere Konturierungen und kantigere rhythmische Ausformungen jedoch ausklammert. Dramatischere Zuspitzungen hätten indes Christoph Loys Inszenierung durchaus entsprochen. Dem „Opernregisseur des Jahres 2003 und 2004", der in Frankfurt bereits mit Mozarts „Entführung" einen großen Erfolg verbuchen konnte, ist wiederum eine großartige Arbeit gelungen. Als schlüssigen Rahmen verlegt er Beginn und Ende der Handlung, die sich auf die Gretchen-Tragödie konzentriert, in den nüchternen Aufenthaltsraum eines Altersheimes (Bühne: Herbert Murauer). Dort wartet ein alternder, von Parkinson gezeichneter Faust auf den Tod und lässt sich mit Mephisto, der anfangs wie ein Harlekin der Opéra comique erscheint (Kostüme: Bettina Walter) und sich dann zu einem skrupellosen Zyniker entwickelt, auf den Teufelspakt ein: Der Wissenschaftler Faust, der emotionale Bindungen stets hinter seinen intellektuellen Forschungsdrang gestellt hat, erkauft sich seine Jugend zurück und verpfändet seine Seele. Die Chor- und Massenszenen, die folgen, sind von einer brillanten Bewegungsregie bestimmt. Bei plötzlich zu Standbildern eingefrorenen größeren Gruppen konzentriert sich das Auge auf einzelne Aktionen, die in erhellender Korrespondenz zu den musikalischen Aufsplitterungen der Partitur stehen. Und obwohl die Walzer-Szene ohne eine einzige wirbelnde Drehung auskommt, entsteht gerade durch die Suggestivkraft konsequenter Verlangsamung das Gefühl einer ins Extreme gesteigerten Turbulenz und Intensität. Christoph Loy liefert innerhalb seiner Figurenzeichnung präzise Milieustudien ab: Bierzeltatmosphäre herrscht in der Trinkszene, der Soldatenchor wird umfunktioniert zu einer Männerchor-Parodie auf einer Geimeindehausbühne, und Margarete lebt in kleinbürgerlicher Enge in einem Plattenbau-Hochhaus mit Vorgärtchen, wo sie – in Kittelschürze und Gummihandschuhen – ihre Blumen umtopft. In vollkommener Einheit mit ihrem Glauben wird sie zur starken Gegenfigur Mephistos, der am Ende scheitert und sich in die Reihe der Verlierer einreiht. Ein exzellentes Solisten-Ensemble setzt Loys Intentionen sängerisch und darstellerisch optimal um: Mark S. Doss bringt die destruktive Seite des Bösewichts mit zwingendem arroganten Sarkasmus und prächtigem Bariton zur Geltung. Andrew Richards ist ein Faust, der seinem lyrischen Timbre in bruchlosen Übergängen heldische Spitzentöne beizumischen vermag, und Nina Stemme singt die Marguerite mit jugendlichem Zugriff. Begeisterte Zustimmung mit nur schüchternen Buhs in der Frankfurter Oper, die nun mit Boito und Gounod gleich zwei selten gespielte Adaptionen des „Faust" im Spielplan hat. |
|
DER TAGESSPIEGEL Frühlingsluftgefühle Christoph Loy wagt sich in Frankfurt an Charles Gounods „Faust"-Oper Von Jörg Königsdorf Es steht nicht gut um Doktor Faust. Kreidebleich und klapprig sitzt er im Tagesraum eines Seniorenheims, die rechte Hand von Parkinson geschüttelt, um ihn herum dämmert noch eine Hand voll Altersgenossen in ihren Rollstühlen dahin oder wird von gelassenen Zivis über die Flure geschoben. Christoph Loy greift gerne zu solchen hyperrealistischen Details, um den Opern des 19. Jahrhunderts neues Leben einzublasen: Donizettis „Roberto Devereux" hat er in München durch eine Thatcherisierung der alternden Virgin Queen wieder flott gemacht, jetzt stellt sich Deutschlands „Regisseur des Jahres" an Frankfurts Opernhaus der noch weitaus kniffligeren Aufgabe, zu beweisen, dass auch Gounods „Faust" mehr ist als ein Album schöner Melodien. Schwierig ist die Aufgabe vor allem deshalb, weil Gounod die idyllischen Genreszenen liebevoll auspinselte: die balzenden Städter in der lauen Frühlingsluft, die schneidigen Soldatenparaden, der splatterige Grusel der Walpurgisnacht. All diese Szenen gibt es in Frankfurt in kaum je gehörter Vollständigkeit zu hören. Und für jede dieser Szenen fällt Loy ein Bild ein: Die Soldaten um Margarethes Bruder Valentin (mit Verdi-Format: Zeljko Lucic) bekommen im städtischen, nach Fünfziger-Jahre-Mief riechenden, Gemeindesaal ein Veteranen-Ständchen, Gretchen selbst fristet ihre Mauerblümchen-Existenz im Plattenbau und zur Walpurgisnacht drehen die Insassen des Altenheims richtig auf. Tempo und Drive hat das allemal, genauer nachdenken sollte man darüber aber besser nicht. Denn irgendwann kommen sich die Requisiten gegenseitig in die Quere, hebt sich der vorgetäuschte Realismus durch immer mehr Unwahrscheinlichkeiten selbst aus den Angeln: Mal deuten Bühne (Herbert Murauer) und Kostüme (Bettina Walter) den rigiden Moralismus der Fünfziger an, mal ist es die schrille Kleinbürgerlichkeit der Siebziger. Dass der Abend dennoch streckenweise außergewöhnliches Format erreicht, liegt vor allem an einer Sängerin: Nina Stemme. In Wien sang sie die Senta im Holländer, Glyndebourne und Bayreuth haben sie schon als Isolde verpflichtet. Ihre Margarethe zeigt deutlich, warum: Denn Stemme steht vom zerbrechlichsten pianissimo bis zum strahlenden fortissimo nicht nur (bei vorbildlicher Diktion und unaffektiertem Spieltalent) eine schier unbegrenzte Vielfalt an stimmlichen Facetten zur Verfügung – die junge Schwedin zeigt sich vom ersten, berührend schüchternen „Bin weder Fräulein" bis zum herzzerreißenden, ganz untheatralischen „Heinrich, mir graut vor Dir" als Ausdruckssängerin in der Nachfolge ihrer legendären Landsfrau Elisabeth Söderström. Kein Ton, der bei Stemme nicht von Seele, von Hoffen und Verzweifeln künden würde. Der Vorwurf, Gounod habe Goethe nicht ernst genug genommen, wird so nicht von Seiten der Regie, sondern überraschenderweise durch eine Sängerin entkräftet. Eindrücklich zeigt Stemme, dass bei Gounod nicht Faust und Mephisto, sondern Margarethe das eigentliche emotionale Zentrum des Stücks ist. Gegenüber dieser außergewöhnlichen Leistung hat es der Rest der Besetzung naturgemäß schwer, obwohl Frankfurts Intendant Bernd Loebe und sein ganz auf Farbnuancen und duftige Atmosphärewerte hin dirigierender Kapellmeister Johannes Debus auch diesmal wieder ein durchaus überzeugendes Ensemble versammelt haben: Der junge Amerikaner Andrew Richards singt einen Faust zwar ohne französische Kavalierstöne, aber mit virilem, aufs Dramatische zielenden Schneid, der Mephistophéles von Mark S. Doss ist als blödelnde Kunstfigur zwar über vier Stunden etwas anstrengend, imponiert aber mit wendig-prägnantem Bass. Und dass dem alten Doktor Faustus nicht durch den Regisseur, sondern durch ein junges Mädchen wieder auf die Beine geholfen wird, liegt ja irgendwie auch in der Natur der Sache. |
|
Mit Wonne leiden und sterben von Manuel Brug Ist so Wagners Isolde angezogen? Schwarzes Kleid, darüber blaue Kittelschürze. Bequemstiefel, Gummihandschuhe. Aber nein. Nina Stemme ist jetzt Marguerite in Gounods "Faust" in Frankfurt am Main. Ausgerechnet. Wagner hätte das nicht gefallen. Noch dazu ein Gretchen als verdruckste, sich an ihr Kruzifix-Kettchen klammernde Saaltochter in einem schmuddeligen Demenzpflegeheim. Isolde, das wird wieder im Sommer sein. In Bayreuth. Wo Nina Stemme freilich bereits auf dem Grünen Hügel debütiert hat: 1994 als Freia im "Ring". Jetzt wird sie als irische Maid in Christoph Marthalers Inszenierung zurückkehren. Vielleicht sogar in Kittelschürze? Mal sehen, was der Kostümbildnerin Anna Viebrock so einfällt. Gounod und Wagner, die französisch Lyrische und die teutonisch Dramatische. Das ist nicht nur operngeschichtlich kurios, das hat es in der Historie des Gesangs noch nie gegeben. Koloratur und Wahnsinn, Liebestrank und endloses Sich-Verströmen. Höchstens die Callas fällt einem ein mit ihrem irren Einspringakt, von der Brünnhilde zu Bellinis "Puritani"-Elvira, innerhalb von elf Tagen, 1949 in Venedig. Doch Nina Stemme lächelt entspannt, amtet durch und geht es mit aller Nerven- und Stimmbandruhe locker an. Die Höhe hat sie, die Beweglichkeit auch, breite Mittellage und das Durchhaltevermögen. Alles eine Frage der Technik, der Ausgeglichenheit, der Balance, seelisch wie musikalisch. Die schwedische Sopranistin hat sich die laufende Saison gut eingeteilt. Ein Höhepunkt freilich fand nicht auf der Bühne statt. Im Dezember sang Stemme die Isolde in den Londoner Abbey Road-Studios für eine CD. An der Seite ihres Tristans Placidó Domingo, dessen Nachwuchs-Wettbewerb sie 1993 gewann - so schließen sich Karriere-Kreise. Jetzt singt sie in Frankfurt noch einmal die Marguerite: "Das hat perfekt in die Planung gepaßt", sagt sie lachend lakonisch. Dann freilich muß sie tschechisch lernen. Die erste Jenufa steht an. "Aber ich träume immer noch schwedisch", gluckst Nina Stemme. Und dann soll mal die Isolde kommen. Diese zwölf Monate sind die vorläufige Krönung einer ganz außerordentlichen Sängerinnenkarriere. Wo alles paßte und stimmte. Nichts strategisch gemacht und nichts gehypt war. Eine langsam ansteigende, aber solide Linie. Nur die Familie, zu Hause in Stockholm, hat augenblicklich ein wenig das Nachsehen. Doch Nina Stemme wird es nicht übertreiben. Sicher, es ist zur Zeit ein viel, aber "es paßt". Schließlich sind die Grundlagen gut gelegt worden. Erst hat Nina Stemme, geboren 1967, Viola studiert und im Chor gesungen, dann neben einer Wirtschaftsausbildung den Gesang intensiviert. Nach zwei Jahren Opernstudio an der Königlichen Opern in Stockholm und einem ersten Cherubino in Italien wechselte sie gleich ins Ensemble. Eine jugendlich Dramatische, von Anfang an. Tosca, Madame Butterfly, aber mit der Flexibilität für die "Figaro"-Gräfin, und der Spielfreude für die "Fledermaus"-Rosalinde. Neugierig und fleißig dazu. Mit einer leicht aufsteigenden, festen Höhe, gut beherrschtem Vibrato, langem Atem. Eine junge, schöne Frau, theaterhungrig, kraftvoll, gestaltungsfreudig, mit geschmeidigem Stahl in den Stimmbändern. Ein Traum. Sie hat ihn mit Arbeit und Fleiß fortgeführt. Sie gewinnt den renommierten "Singer of the World"-Wettbewerb in Cardiff. Arbeitet vier Jahre im Ensemble der Kölner Oper, dann frei. Immer hervorragend vorbereitet, die Lehrerin kontrolliert regelmäßig. Sie ist Eva und Mimì, Agathe und Elisabeth, Elsa, Manon Lescaut, aber auch "Wozzeck"-Marie, die nackte Nyssia in Zemlinskys "König Kandaules" in Salzburg und die Katerina in Martinus "Griechischer Passion" in Bregenz. Sie leidet und stirbt mit Wonne, ist aber auch gern komisch. Eine Theatersängerin, eine blutvolle Künstlerin, eine bescheidene Kollegin. Mit Fundament. Kein aufgeblasenes Mediengeschöpf. Jetzt, mit noch nicht einmal 40 Jahren, geht ihre große Zeit erst richtig los. Salome schaut schon um die Ecke, und wenn ab 2007 die "Ringe" mehr und die regierenden Brünnhilden wegen Altersschwäche und Stimmbandspliß Mangelware werden, dann winken der Stemme auch die. "Aber erst einmal will ich mehr Verdi". Die "Maskenball"-Amelia folgt im September. Und die Strauss-Arabella. "Ich bin immer ehrlich mit meiner Stimme umgegangen", sagt sie. Um so mehr soll man sich jetzt noch über Nina Stemmes Marguerite freuen, über ihre Agilität, ihre Breite, sanft verschattet, dann wieder gleißend hell. Regisseur Christof Loy, wie immer ein exzellenter Personenführer, weiß zwar nicht so Recht, was er eigentlich erzählen will. Wirres mit Goethe, Gounod und Geriatrie. Eine bigotte Gesellschaft, die sich aber vom Kreuz abwendet. Der Speisesaal dreht sich. Faust mit Fernbedienung im Rollstuhl und Walpurgisnacht im Irrenhaus. Das Ende ist der Anfang. Man kennt das. Man will es nicht wirklich wissen. Der junge Johannes Debus dirigiert ganz fabelhaft einen auf gallische Frivolität verzichtenden, elegant schweren, sehr deutschen Gounod. Mit dem nur in der Kopfstimme schwächelnden Andrew Richards (Faust), dem elegant bösen Mark S. Doss (Méphistophélès), der sanften Jenny Carlstedt (Siebel) und dem knorrig baritonalen Zeljiko Lucic (Valentin) steigert sich zudem ein Top-Ensemble in brodelnden Belcanto. Nina Stemme geht aus der Inszenierung als Siegerin hervor. Der Schrei der ledigen Mutter, die ihr Neugeborenes im Kinderwagen erstickt und der Schluß, am Tropf im Krankenhausbett, wo sie sich den Engeln entgegen in den Exitus deliriert, ist Klasse; und der dritte Akt, Paradiesgärtlein und Plattenbau, ganz der ihre. Keusche, noch mezzosatte Entrüstung beim Hyazinthenumtopfen beim "König in Thule". Girrendes Erstaunen in der Juwelenarie. Ungläubige Innerlichkeit bei der ersten Begegnung mit Faust. Und dann dieser Schrei, dieses gierige Wachgeküßtwerden am Appartementfenster! Ekstatisch und schmerzensreich. Höchste Lust, sehr bewußt. Das Hemd geht auf, der Rolladen runter. Marguerite ist Frau geworden. Die große Tragödie der kleinen Serviererin hat begonnen. Als Isolde wird sie sich bald fortsetzen. © WELT.de 1995 - 2005 |
|
Die Liebe ist los im Heim Von Gerd Döring Es gab Zeiten, da hat man den Originaltitel der erfolgreichsten Oper von Charles Gounod hier zu Lande gern abgeändert. Aus dem Faust Gounods wurde auf deutschen Bühnen eine Margarethe, zu frivol schien das Libretto, zu wenig dem Ernst der goetheschen Vorlage angemessen. Jetzt, in Christof Loys Frankfurter Inszenierung, wird unversehens aus dem Faust wieder eine Margarethe oder, richtiger, eine Marguerite: Die schwedische Sopranistin Nina Stemme drückt, von Szene zu Szene stärker werdend, mit ihrer Interpretation des Gretchens der Aufführung ihren Stempel auf. Eine immens starke Sängerin mit innigem Sopran und zudem eine hinreißende Schauspielerin. In Loys Inszenierung sitzt Doktor Faust zu Beginn im Altersheim, einem blassblauen, pflegeleichten Nichtort, mit abwaschbaren Wänden und angetrockneten Zimmerpflanzen - ein ebenso nüchternes wie tristes Ambiente, das uns in den nächsten drei Stunden begleiten wird. Mal dient die nüchterne Kulisse als biederer Gemeindesaal, mit zwei, drei Biertischgarnituren und Lampenketten wird sie zum Dorfplatz und am Ende ein tristes Gefängnisspital. Aus dem mittelalterlichen Deutschland versetzt Loy seinen Faust in eine Szenerie, die so zeitlos anmutet wie die Geschichte um Liebe und Begierde, um Verführung und Erlösung, auf die sich das Libretto der Oper beschränkt. Sprache und Musik lassen uns an ein provinzielles Städtchen in Frankreich denken - die behutsame Regie und Ausstattung (Bühne: Herbert Murauer, Kostüme: Bettina Walter) schaffen eine französische Aura ohne platte Eindeutigkeit. Aus dem Doktor Faustus, dem so urdeutschen Wahrheitssucher, wird ein zweifelnd-verzweifelter Alter, dessen einziges Streben das nach Jugend ist - und nach Sex. Ein Wunsch, den ihm der flugs herbeigeeilte Mephisto leicht erfüllen kann. Aus dem müden Greis wird ein schmucker Jüngling, ein Beau mit breitem Revers und langen Koteletten, der seine Liebste trifft auf einem Dorffest. Hier werden junge Soldaten verabschiedet, die in den Krieg gehen, Marguerites Bruder, der polterige Valentin (Zeljko Lucic), und seine Freunde, unter ihnen der junge Siebel (mit nicht immer passendem lyrischem Mezzo, Jenny Carlstedt), Marguerites Verlobter. Lucic, mit markantem Bariton, ist dem alerten Méphistophélès von Mark S. Doss im ersten Akt ein kräftiger Widerpart. Der Afroamerikaner darf ein smarter Teufel sein mit zurückgegelten Haaren, Schlangenhautjacke und Lederhose, bläst mit biegsam-kräftigem Bassbariton den frivolen Faust-Walzer an und verkörpert einen trefflichen Anwalt des Bösen. Andrew Richards, der Faust, entwickelt in der zweiten Szene für einen Manta-Fahrer ungewohnt lyrische Vorstellungen von Liebe und schleicht sich mit beachtlichem tenoralem Schmelz in Gretchens Schlafzimmer. Im weiteren argen Verlauf der Geschichte bleibt er, stimmlich immer noch stark, darstellerisch verzagt. Aus der Vagheit lockt ihn auch nicht die von Loy gruslig inszenierte Walpurgisnacht - ein Chor aus Alten und Kranken bedrängt den Umnachteten -, und so bleibt der überragenden Marguerite, die Oper zu einem triumphalen Ende zu führen. Ein letztes Choraufseufzen: "Gerettet!" Gounods "Faust" ist eine hochmoralisches Werk, das gestützt wird von mitreißender, eingängiger Musik. "Schwelger der langsam geschlürften Süßigkeiten" nannte Oskar Bie den Komponisten, und so wie Johannes Debus mit dem Museumsorchester die Partitur umsetzt, könnte man süchtig werden nach dem gounodschen Zuckerkram - die Oper hat weit mehr herrliche Arien als nur Mephistos böses "Lied vom goldenen Kalb" und die " Juwelenarie" der Marguerite. Ein Werk mit herrlichen Chören (Alessandro Zuppardo) und oft seligem Kirchenton, dessen Musik Loy zuweilen subtil verfremdet: den grandiosen Walzer lässt er in Zeitlupe tanzen, den scheppernden Militärmusiken versetzt er szenisch bittere Akzente. Ein Jahr nach Boitos Faust-Oper "Mefistofele" in Frankfurt überzeugt auch die Inszenierung von Gounods zwischen Opéra lyrique und Grande Opéra changierendem Bühnenwerk durch die gekonnte Abstimmung von Musik, szenischem Spiel und Gesang. |
|
Tod und Teufel Der "Faust"-Walzer ist wohl eines der meistgespielten Wunschkonzertstücke der Opernliteratur, und auch sonst hält Charles Gounods Verarbeitung des Faust-Stoffes etliche musikalische Highlights bereit. Aber kann dieses Werk, das im deutschen Sprachgebiet mit Rücksicht auf den "wahren", Goetheschen "Faust" bis in jüngere Zeit unter dem Titel "Margarethe" figurierte, auch für einen Regisseur zur Herausforderung werden? Christof Loy hat sich ihr in der Frankfurter Oper gestellt. Zusammen mit dem Bühnenbildner Herbert Murauer führt er den Beweis, dass die zentralen Themen der "Faust"-Oper noch heute virulent sind: die Macht des Glaubens, die Gesetze bürgerlicher Moral, die Sehnsucht nach der Fülle des Lebens, die von einem dämonischen Verführer und Volksaufwiegler zynisch missbraucht wird. Es bedarf nur eines adäquaten Umfelds, um diese Themen ans Licht der Gegenwart zu holen. In Frankfurt ist dieses Umfeld ein die ganze Bühne füllender, verglaster Mehrzwecksaal, der, mal gedreht, mal neu dekoriert, für drei der vier Akte den Schauplatz bildet. In diesem Saal sehnt zu Beginn der greise Faust, umgeben von Debilen und Invaliden, den Tod herbei, hier findet danach das Fest statt, bei dem die ausziehenden Kämpfer verabschiedet werden. Man denkt dabei an Bürgerkriegskonflikte in postsozialistischen Staaten und bei Valentins beschwörenden Ermahnungen an seine allein zurückbleibende Schwester Marguerite an den Moralkodex einer Gesellschaft, in der Jungfräulichkeit als kostbarstes Gut einer jungen Frau gilt. Doch Loy insistiert nicht auf solchen Bezügen, er verwendet sie eher assoziativ. Vergleichsweise dezent geht es später - wiederum in der Irrenanstalt - auch während der Walpurgisnacht zu. Umso beklemmender wirkt die Kirchenszene: im Hintergrund die Menge der schwarz verhüllten Betenden, vorne Marguerite mit dem Kinderwagen, dazwischen der Dämon Méphistophélès, bei dessen Fluch Marguerite, verzweifelt, von Kirche und Gesellschaft verstossen, ihr Kind erwürgt. Und dann, im Moment, wo sie sich ihrer Tat bewusst wird, der fürchterliche Schrei. Das zeigt den Regisseur auf der Höhe seines Könnens und lässt Abgeschmacktheiten wie die knipsenden Asiaten beim Abschiedsfest oder die Sex-Szene Fausts und Marguerites bei fallender Jalousie vergessen. Das Kirchenbild macht aber auch deutlich, wo das Zentrum dieser "Faust"-Interpretation liegt: Es ist Marguerite bzw. deren Alter Ego Nina Stemme, die die Aufführung trägt. Wie sehr diese Figur in sich und ihren Wertvorstellungen ruht, erkennt man schon an der Plattenbauwohnung mit üppigem Blumenbeet, die im zweiten Akt den Gegenpol zum kalten, nüchternen Saal bildet. Vor allem aber ist es die Persönlichkeit Nina Stemmes, die Marguerite so greifbar gegenwärtig und lebendig macht. Solche Natürlichkeit, verbunden mit höchster Präsenz, ist allein schon als schauspielerische Leistung ein Glücksfall, doch Nina Stemme ist darüber hinaus auch als Sängerin eine Ausnahmeerscheinung: wunderbar weich und agil ihr in jeder Lage mühelos leicht ansprechender Sopran, das Timbre klar, warm und rein. Ein weiterer Höhepunkt in der Laufbahn dieser erstaunlich vielseitigen Künstlerin. Aber auch bei der Besetzung der übrigen Partien hat die Frankfurter Oper eine glückliche Hand gehabt. Dem Tenor von Andrew Richards mag es zwar gelegentlich noch an klanglichem Feinschliff fehlen, doch meistert er den enormen Umfang und die heiklen Lagewechsel der Partie souverän und nimmt immer wieder mit delikatem Piano für sich ein. Der Bariton Mark S. Doss singt den Part des Méphistophélès so wendig und elegant, wie er ihn - bald im roten Samtwams aus dem Theaterfundus, bald im modischen Lederoutfit eines Entertainers - spielt. Eine Idealbesetzung ist auch der stimmlich aus dem Vollen schöpfende Valentin von eljko Lui: frei von Sentimentalität, sängerisch kultiviert selbst dort, wo er brutal zu sein hat. Markante Rollenporträts steuern zudem Jenny Carlstedt als Siébel und Elzbieta Ardam als Marthe Schwerdtlein bei. Etwas weniger Profil als das Bühnengeschehen gewinnt der Orchesterpart. Der junge Dirigent Johannes Debus hat den grossen Apparat zwar sicher im Griff, doch mit dem spezifisch französischen Tonfall der Komposition tut er sich eher schwer, und der erdige, satte Klang des Orchesters steht in einem gewissen Gegensatz zur Brillanz von Gounods Idiom - nicht aber zu der auf die Tiefendimension des Werkes zielenden Lesart des Regisseurs. Marianne Zelger-Vogt |
 6.2.2005 Faust im Altersheim Nach einem Bericht von Wolf-Dieter Peter
Faust als Insasse eines Altenpflegeheims, Gretchen als seine Pflegerin und Mephisto als der Trickser aus der Flimmerkiste: So setzte Christof Loy, Regisseur des Jahres 2004, in Frankfurt die Faust-Oper von Charles Gounod um und machte dabei einen überzeugenden Eindruck. Als Jules Paul Barbier dem Komponisten Charles Gounod den Vorschlag zu einer Faust-Oper unterbreitete, hatte Gounod, der Goethes Faust in französischer Übersetzung 1838 kennen gelernt hatte, bereits selbst über eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Stoff nachgedacht. Im Unterschied zu anderen musikalischen Bearbeitungen des Faust-Stoffes, die entweder die Titelfigur oder den dämonischen Mephisto als zentrale Figur akzentuieren, konzentriert sich das eher lose mit Goethes Vorlage verbundene Libretto Barbiers und Carrés auf die Liebesgeschichte zwischen Marguerite und Faust. Verwirrung stiftende makabre Späße, doppelsinnige Intrigen und ein entfesselter Theaterspuk des Méphistophélès lassen die Liebe zwischen Marguerite und Faust entstehen und schließlich ins Verderben treiben. Mit einer bewusst lyrischen Einfachheit der Musik zeichnete Gounod die Gefühlswelt der Figuren nach und verlagerte den Schwerpunkt von der Schilderung des äußeren Bühnengeschehens auf die innere Handlung. In der Inszenierung von Christof Loy ist Faust Insasse eines Altenpflegheims, ein altes Wrack mit Tremens in beiden Händen. Als er grad den Wunsch äußert, er möge doch auch noch einmal anderes erleben, erscheint Mephisto aus dem Fernseher, zunächst im klischeehaften, beinahe klassischen Mephisto-Kostüm, das er dann abwirft und sich als junger, sportlich und trendy gedresster Farbiger präsentiert. Der gibt Faust die neuesten Designerdrogen, woraufhin dieser die Wirklichkeit verklärt wahrnimmt. Gretchen ist hier eine junge Pflegerin in dem Heim. Faust gelingt es, sie zu bezirzen. Am Schluss wird Gretchen über den Mord an ihrem Kind wahnsinnig und landet in derselben Anstalt wie Faust. Der Drogenrausch endet mit dem Zusammenbruch Fausts. Der Kritiker Wolf-Dieter Peter lobte in Fazit die musikalische Qualität der Aufführung und das "geschlossene Ensemble ohne Ausfälle". Auch die Choreographie Loys hob er lobend hervor und dessen Kunst, "in alten Stücken das Heutige zu finden". |
|
Ansprüche an Gott
„Dieser Gott – was tut er für mich?" Fausts hypertrophe Frage wird zum beklemmenden Topos der Frankfurter Inszenierung Christof Loys von Gounods „Faust". Er überlagert die gestörten Lebensgefüge der dramatis personae, was sich im existentiellen Selbstzweifel (auch Gretchens) zu transzendierender Spiritualität steigert: Gounods „Faust" gelangt durch diese inszenatorische Konsequenz zu klassischer Größe. Das zwischenmenschlich-gestörte Beziehungsgeflecht wird in Posen distanzierter Nähe nachvollziehbare Bühnenrealität, bleibt aber in zentralen Szenen in opernhafter Statik bloße Behauptung. Die realistisch-kühle Bühne Herbert Murauers verweist auf die konkrete aktuelle Gültigkeit, verblüfft mit überraschenden Räumlichkeiten (Altersheim als Fausts Domizil) und schafft kommunikative Räume für das turbulent-intensive Agieren von Solisten und Chor. Das wird vor allem von den imaginativen Balletszenen Jacqueline Davenports bravourös genutzt. Johannes Debus greift mit dem hellwachen Frankfurter Museumsorchester die angebotenen szenischen Konstellationen auf: Gounods Musik wird nicht nur mit ihrer bezwingenden Melodik hörbar, vielmehr funkeln die verborgenen Glanzlichter instrumenteller Brillanz – und es werden Schichten dämonischer Bedrohung hervorgehoben, die im gängigen Gounod-Klischee gewöhnlich im schmelzenden Klang untergehen. Die Solisten verbreiten in ihren Ausstellungs-Arien den Glanz der berauschenden Kantilenen, identifizieren sich mit ihren archetypischen Rollen und sind überzeugende Repräsentanten gescheiterter Lebensentwürfe und blasphemischer Gott-Bezüge. Doch bleibt vieles zu statuarisch, die angelegten zwischenmenschlichen Bezüge mit ihren emotionalen Brüchen verbleiben opernhaftes Agieren und problematorisches Singen. Andrew Richards ist ein zweifelnder Faust, auch als jugendlicher Schnösel, mit durchaus strahlendem Tenor; Mark S. Doss ist ein omnipräsenter Méphistophélès mit stimmstarken Bariton; Nina Stemme gibt der Marguerite fast wagneri sche Statur: verletzlich im Spiel, tiefgründig in den differenzierten Klängen, erschütternd in ihren unbegriffenen Lebenssituationen, ergreifend in ihrer Verweigerung am Schluss; Željko Lučić beeindruckt mit melodisch-strömendem Bariton und zeichnet einen selbstgerecht-bigotten Valentin. Das Frankfurter Ensemble – mit einer unbürgerlich-penetranten Elzbieta Ardam als Marthe Schwerdtlein, einem hilflos-sensiblen Siebel der Jenny Carlstedt und einem hörenswerten Florian Plock als aggressiv-angepassten Wagner – beweist außerordentliche Spielfreude, Rollenidentifikation und stimmliche Kompetenz: bewundernswert!Das Frankfurter Premieren-Publikum – die üblichen Repräsentanten ihrer selbst, die engagierten Opern-Freaks – feiert das vielschichtig-anspruchsvolle Ereignis mit Leidenschaft. Offenbar auch vorbereitet durch eine intensiv-umfassende Vorberichterstattung in der regionalen Presse; nachzulesen auf einer Pinnwand mit Beiträgen in Blättern von Bild (!) bis FAZ. Ein offenbar nicht folgenloser Triumph der PR des ambitionierten Hauses – Glückwunsch! (frs) POINTS OF HONOR Gesang ****/***** Regie ****/***** Bühne ****/***** Publikum ****/***** Chat-Faktor ****/***** |
|
FINANCIAL TIMES Faust, Frankfurt Opera Gounod'sFaust is often billed in Germany as Margarethe. The frivolous Frenchman's melodies should not be confused with Goethe's masterpiece. That would be blasphemy. Frankfurt Opera, not a house given to frivolity, has chosen a new critical edition of Faust. Minus the usual cuts, plus intervals, the evening lasts four hours. Add Johannes Debus on the podium, drawing plump, earthy sounds from the orchestra, and you start to hear Gounod with an earnestly German accent. If the piece still seems more Gretchen than Faust, it is only because when Nina Stemme is on stage, the rest of the world ceases to exist. Her Marguerite is the core of the evening, a performance of mesmerising dramatic power. Stemme has a simple self-assurance and directness of expression that seem made for the role. She progresses from maidenly purity to infanticide with such unfettered honesty that you believe every second. The voice is round, even, true and thrilling, the phrasing has such vitality that each note seems created as she sings it. And she moves with the instincts of a real stage animal. Satan hasn't a hope in Hades. In fact, Mark S.Doss's Méphistophélès is no slouch. Doss plays the Devil with relish, the voice dark and charged, the figure all demonic dash. The director Christof Loy sets the action in a shoddy village hall, roughly 40 years ago (sets: Herbert Maurauer), in turn church, beer-hall, prison and geriatric home common-room. Loy plays the supernatural straight. Pact made, youth regained, girl seduced, child dispatched, execution, amen. Only Marguerite's salvation is left unstated. But there is no doubt of Faust's damnation, as he falls, twitching, to end the opera where he began - old, ill and alone. In Hell. Andrew Richards as Faust is self-absorbed, irresistibly sexy, doomed. Zeljko Lucíc's Valentin is disturbingly brutish, hinting at the siblings' troubled family history and the patterns of violence they will repeat. Loy's details ring truer than his metaphysics, which are muddled. No matter. We may not know where we are going, or why, but it is a great ride. |