|
MUSIKTHEATER Von unserem Redaktionsmitglied Stefan M. DettlingerSo märchenhaft kann Oper sein: Eine Frau sucht einen Schatten, weil sie ohne keine Kinder zu kriegen glaubt. Binnen drei Tagen muss das Ding gefunden sein, sonst muss die Arme dorthin zurück, wo sie herkam: ins Geisterreich zu Papa Keikobad. Ihrem Mann aber, der sie einst aus einer Gazelle gejagt hatte und der sich nun Nacht um Nacht mit ihr jenen Dingen zuwendet, die Mann und Frau immer wieder gerne tun, blüht noch Schlimmeres: Er, der Kaiser, "muss versteinen!", wie ein roter Falke von den Himmelsdächern herabzupfeifen weiß, und deswegen macht sich die Kaiserin mit ihrer arglistigen Amme auf die Suche nach dem Schatten. Eine hübsche Märchenstunde, bei der am Ende das Gute siegt. Wer sich so etwas Haarsträubendes ausdenkt? Kein minderer als der bedeutendste Librettist des 20. Jahrhunderts: Hugo von Hofmannsthal, der den Stoff 1919 zusammen mit einer "Wahnsinnspartitur" von Richard Strauss und glänzendem Erfolg auf die Wiener Opernbühne warf. Doch "Die Frau ohne Schatten" ist ohne Peinlichkeiten eigentlich nicht inszenierbar. Viele sind deshalb ins "Regietheater" geflüchtet, haben, wie John Dew, das Werk teils im Kreißsaal spielen lassen oder, wie Kirsten Harms, die Prüfungsrituale von Akt III in veritable Schützengräben verfrachtet. Mannheim geht einen anderen Weg. Regisseur Gregor Horres und Ausstatterin Sandra Meurer setzen mit Strauss' "Schmerzenskind" auf kühle Abstraktion, auf Design, Symbolik und Konstruktivismus, mit denen sie die ganze Märchenmottenkiste beiseite legen und noch einmal von vorne anfangen, irgendwo zwischen Schlemmers Triadischem Ballett, Bob-Wilson-Ästhetik und Suprematismus. Als Psychodrama, in dem alle Männer aussehen wie die hinzuerfundene Figur des Hofmannsthal. Eine sich im Prozess ständigen Wandels befindende Multiplex-Einheitsdrehbühne ist ihnen dabei behilflich, eine Bühne mit Himmelsrahmen, mit der man, gäbe es ihn, den Hebebühnen- und Fahrstuhlpreis gewinnen könnte. Alle naselang fährt jemand nach oben oder unten. Mechanisierte Zauberei ist das, die im C-Dur-Happy-End mit Kindersegen auch noch in die sexuelle Vereinigung des unteren Bühnenkubus mit dem Himmelsrahmen mündet. Kopulation von Bühnenelementen. Wie schön! Überhaupt sind sexuelle Konnotationen überall versteckt, man kann sie sogar in der Riesenschreibfeder und dem Falknerhandschuh sehen, die immer wieder von oben durch das Himmels-Loch herunterschweben - der eine, der Kaiser, befriedigt seinen Trieb tags mit der Jägerei und seinem Falken, der andere, der Färber (den Horres zum Schriftsteller, ja, zu Hofmannsthal selbst macht), durch die Schriftstellerei. Eine eisige Symbolsprache. Eisig bleibt der Abend indes nicht. Wohl aber Zauber-haft. Und das liegt mitunter am Orchester unter GMD Axel Kober, der den gigantischen "Produktionsapparat" einer "Komponiermaschine" (Adorno) zu klanglichen Höhenflügen leitet. Grandios umgesetzt wird die Explosionskraft, die ungeheure Schönheit und Delikatesse dieser Partitur, die bis hin zur Glasharmonika sowie Wind- und Donnermaschine so üppig besetzt ist, dass man beinahe von zwei Orchestern sprechen kann - zumal dem eruptiv-drängenden Tutti, das fürs Irdische steht, immer auch das schattenlos Transparente der Geisterwelt in Form eines Kammerensembles gegenübersteht. Es ist, nach diesem Erlebnis im Nationaltheater Mannheim, kaum vorstellbar, dass diese Partitur plastischer und perfekter erklingen kann. Auch Tondokumente prominenter Orchester reichen hier nicht heran. Ganz ohne Schatten ist diese "Frau ohne Schatten" trotzdem nicht, denn sängerisch voll überzeugend ist nur sie: Susan Maclean als Amme, deren Boshaftigkeit sie in immer kultiviert strahlender Mezzo-Dramatik, sicheren Koloraturgirlanden und ungemein schnippischer Darstellung verklanglicht und zeichnet. Neben ihr wirkt Ludmila Slepnevas Kaiserin als verunsicherte Frau, die buchstäblich keinen geraden Ton herausbringt. Zu viel Vibrato. Zu wenig Diktion. Was auch auf Caroline Whisnant (Baraks Frau) zutrifft, die zudem Deutschdefizite erkennen lässt. John Horton Murrays Kaiser ist davon das Gegenteil. Seine beachtlich dramatische Stimme wirkt etwas fest und steif und bleibt auf der Farbpallette immer an der gleichen Stelle. Nuancenreich wäre etwas anderes. Dem Papier-mit-Tinte-Färber Barak verleiht Thomas Jesatko Schlappi-Charakter in Ton und Bild. Den Impotenten nimmt man ihm bestens ab, wirkte sein Bassbariton doch zu weich, zu wattig. Seinen Brüdern, dem Einäugigen, Einarmigen und Buckligen, verhelfen Frank van Hove, Taras Konoshchenko und Oskar Pürgstaller in gewohnt zuverlässiger Singmanier zum lausigen Leben. Ein tolles Trio. Im Programmheft lesen wir Eva Hermans umstrittene Thesen zur Rolle der Frau in der Gesellschaft. Dass man "Die Frau ohne Schatten" auch auf Themen wie Gebärmaschine, Fruchtbarkeitsmetaphorik und Feminismus aktueller befragen könnte, ist klar. Das Theater weist ja selbst darauf hin. Und doch entscheidet es sich dagegen - und fährt nicht schlecht mit dieser an die 1980er Jahre erinnernden Inszenierung. Tosender Applaus, einige Buhs für die Regie. |
|
Die Welt der Feen in Klangwolken Von Gabriele Weingartner MANNHEIM Große Oper im Nationaltheater Mannheim mit der "Frau ohne Schatten". Dirigent Axel Kober und Regisseur Gregor Horres lieferten eine überzeugende Interpretation der selten gespielten Oper von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Dabei könnte man nicht sagen, wem es besser gelang, Hofmannsthals verquastes Libretto oder Strauss´ gigantischen Klangapparat besser zur Geltung zu bringen. Sicher ist, dass Gregor Horres eine kongeniale Kostüm- und Bühnenbilderin an seiner Seite hatte, Sandra Meurer nämlich, der es gelang, die komplizierte, auf mehreren Ebenen spielende Handlung auf eine logistisch trickreich genutzte Drehbühne zu verfrachten, welche die Ganzheitlichkeit der in der Oper verhandelten Feen- und Menschenwelt eindrucksvoll demonstrieren konnte. Zweifellos war aber auch die Entscheidung richtig, in Anbetracht dessen, dass es in der "Frau ohne Schatten" nicht zuletzt um die Institution Ehe geht und um Kinder, die zur Welt kommen oder nicht, sich nicht um eine oberflächliche Aktualisierung zu bemühen. Das Geschehen um die beiden Paare - Kaiser und Kaiserin, Barak, der Färber, und seine namenlose unwirsche Frau - wurde in eine nicht näher definierte Epoche verlegt, was für seine Überzeitlichkeit spricht. Auch dass man den um seine Worte ringenden Dichter selbst auf die Bühne gestellt hatte, scheint sinnvoll. Wie Barak, der von seiner Frau unterdrückte Färber, rang er "um sein Handwerk". Allenfalls die Tatsache, dass man von diesem Handwerk nichts sah, nichts von der Armseligkeit des Lebens, die eine arme Ehefrau auf den Gedanken bringen konnte, ihren Schatten zu verkaufen, nichts von der körperlichen Fron, der Barak, ihr Mann, sich unterwerfen musste, verlangte vom Publikum Willen zur Fantasie. Denn Barak sah aus wie Hofmannsthal und trug Ärmelschoner, was natürlich einige Assoziationen zum Handwerk des Schriftstellers nahelegte - so ähnlich wie die überdimensional große Schreibfeder, die immer wieder einmal ins Bild hineinragte. Ansonsten versank man willig und mit gutem Gewissen in den Klangwolken, in die einen das prächtig aufspielende Orchester des Mannheimer Nationaltheater sowie dessen Chöre immer wieder tauchte. Auch die Sänger schlugen sich wacker, versanken nicht etwa in der Dynamik der so raffiniert instrumentierten und auch solistisch - das Cello! - wunderbar ausgekosteten Partitur. Susan Maclean als böse Amme war darstellerisch phänomenal, ihr Mezzo schillernd ambivalent, Ludmila Slepneva - als Kaiserin ein zerrissenes, melusinenartiges Wesen - steuerte ihren Sopran sicher durch das sie umbrandende orchestrale Meer, ebenso Caroline Whisnant, die der herrischen Erscheinung der Färbersfrau auch stimmlich kraftstrotzende Form verlieh. Thomas Jesatko schenkte seinem Barak warme, fast lyrische Töne. Einzig John Horton Murray als Kaiser vermochte es nicht immer adäquat, seiner liebenden Verzweiflung Ausdruck zu verleihen. Das Textlaufband am oberen Rand der Bühne brachte es mit sich, dass man Hofmannsthals Libretto bisweilen mitlesen musste. Sein bestes in der Zusammenarbeit mit Richard Strauß ist es freilich nicht. |
|
Fingerzeig vom Himmel Oper: Gregor Horres inszeniert in Mannheim „Die Frau ohne Schatten" von Richard Strauss Von Sigrid Feeser MANNHEIM. Und ewig rotiert die Drehbühne. Podeste heben und senken sich, das Personal geht über sich in die Tiefe öffnende schiefe Ebenen ab. Ein gleich großer Rahmen schwebt in wechselnden Positionen über dem von Bernhard Häusermann in wechselnde Modefarben getauchten Spielort. Bambi ist da, Plastikfische sind da, mal kommt eine rote Hand aus dem Bühnenhimmel, mal ist es ein altmodischer Federhalter, mal geht ein Statist, sehr kunstvoll, hoch oben durch die Luft. Die Kostüme der Ausstatterin Sandra Meurer: leicht chinois, schnöde einfach. Das passt zur Einheitsszene. Warum aber, um Himmelswillen, trägt die unfruchtbare Kaiserin Strapse über dem Rock? Kindliches Staunen über die neue Mannheimer „Frau ohne Schatten", die hier 1984 zum letzten Mal herauskam. Regie in Strauss’ Kunstmärchenoper führt Gregor Horres, der Sohn des früheren Darmstädter Intendanten Kurt Horres, mit viel Geschick für eindrückliche Bilder, bequeme Positionen beim Singen und nüchtern hochgerüstetes Lifting einer alten Mär. Gute Sänger, aber dann doch keine richtigen großen Strauss-Stimmen im ausschließlich mit hauseigenen Kräften besetzten Ensemble. Am besten schneidet Thomas Jesatko als durch stumme Doppelgänger vervielfachter Schriftsteller Barak ab. Der eigentliche Held ist das Orchester. Unter Interims-GMD Axel Kober darf die vom Schönen und Schrecklichen durchdrungene Partitur mächtig aufschäumen, sich in großen Bögen rauschhaft aufbäumen, dynamisch bis an die Schmerzgrenze gehen. In dem prinzipiell voluminösen Klangbild gibt es kammermusikalisch selig ausmusizierte Ruhepunkte mit exzellenten Soli; nur ein paar von hinten dröhnende Verstärkungen machen missmutig. Dass nach einem fulminant gesteigerten zweiten Finale der Einfall mit der nimmermüden Drehbühne endgültig verbraucht ist und die Spannung auch musikalisch zunehmend durchhängt, bleibt dem Komponisten anzulasten; Strauss-Hofmannsthals symbolistisch sich aufblähende Geschichte ist und bleibt halt eine schwer verdauliche Angelegenheit. |
|
Großtat mit kleinen Schönheitsfehlern Von Thomas Tillmann Wer ist die Hauptfigur in der zweifellos schwer auf die Bühne zu bringenden Frau ohne Schatten? Hugo von Hofmannsthal hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass es die Kaiserin ist, Gregor Horres schenkt ihr in seiner Neuinszenierung zwar erfreulicherweise mehr Aufmerksamkeit als manch anderer Regisseur, wenn er sie fast immer auf der Bühne präsent sein, die Ereignisse beobachten und nach und nach auch verstehen lässt. Aber noch mehr scheint ihn der Dichter selbst zu interessieren, der hier in persona auftritt (Jost-Jochen Wacker bewältigt die Aufgabe immerhin sehr diskret), so dass man als Betrachter zum Zeugen der Werkentstehung wird, leider aber dadurch auch immer wieder auf Distanz gehalten wird zu der Geschichte, die doch eigentlich eine interessante, bewegende ist; wenn ich mich über die Genese des Librettos oder die Befindlichkeiten und Probleme ihres Verfassers informieren will, besorge ich mir die entsprechende Literatur. Barak ist in dieser Konzeption also eine Verdopplung des Autors, der seiner literarischen Arbeit deutlich mehr Aufmerksamkeit schenkt als seiner Gattin, die hier nicht Pauline Strauss ist, die ja eine wichtige Inspiration für die Figur war, sondern eher Gerty von Hofmannsthal.
Auch hinsichtlich der Kostüme von Sandra Meurer ist das Stück in seiner Entstehungszeit fixiert, die Brüder des Färbers etwa werden als Kriegsversehrte gezeichnet, was Sinn macht und berührt, ohne dass dieser Gedanke weiter aufgegriffen würde. Ähnlich ergeht es der im Programmheft aufgegriffenen Frage der Emanzipation der Frau, die spätestens zu Beginn des 20. Jahrhunderts Alternativen zur Mutterschaft als einzigem Lebensinhalt entdeckt. Da werden sogar die mir unerträglichen reaktionären Vorstellungen von Nachrichtenleserin Eva Herman abgedruckt, ohne dass man das Gefühl hat, dass Horres solchen Gedanken das Wort reden will. Auf Antworten wartet man indes bedauerlicherweise vergebens, hier hätte man sich mehr Entschlossenheit gewünscht.
Ansonsten hat das Regieteam sich für einen unspektakulären Ansatz der reduzierenden Entmythologisierung entschieden, alles Märchenhafte wird vermieden, auch die Ausstattungsorgie, in die sich mancher meint flüchten zu müssen angesichts der komplexen Aufgabe: Auf der von Bernard Häusermann exzellent ausgeleuchteten Spielfläche konzentriert sich alles auf eine Tür, ein Bett, ein Tisch, ein paar Stühle und das Schreibpult für den Dichter, sie wird durch häufiges Drehen in Bewegung gehalten und lässt sich nach unten öffnen, über ihr hängt ein riesiger weißer Rahmen, in dem mitunter Symbole wie der rote Handschuh des Kaisers oder des Dichters Füller sichtbar werden. Es gibt auch keine zwei Welten, sondern zwei Menschenpaare - Kaiserin und Kaiser tragen längere weißgraue Haare und heben sich dadurch von den übrigen Figuren ab -, die ähnliche Beziehungsprobleme auf verschiedenen Ebenen zu lösen haben, und erfreulicherweise spürt der Regisseur dabei immer wieder auch augenzwinkernd komisch-ironische Momente auf. Weniger überzeugend fand ich den Verfremdungseffekt, die Sängerinnen und Sänger, die die Partie des Geisterboten, des Hüters der Schwelle, des Falken, des Jünglings oder der Stimme von oben zu singen zu haben, in T-Shirts auftreten zu lassen, auf die der Rollenname gedruckt ist - es hätte völlig gereicht, ihre Einsätze über die Beschallungsanlage des Hauses einzuspielen oder sie vom Zuschauer ungesehen am Bühnenrand oder im Orchestergraben singen zu lassen. Besonders im dritten Akt gelangt Horres dann doch mehr und mehr zu einer Konzentration auf die Hauptfiguren, verzichtet auf alle ablenkenden "Mätzchen" und findet zu einer ganz schlichten, jede Peinlichkeit vermeidende Erzählweise, die nicht zuletzt der Wirkung der Musik den Vortritt zu lassen scheint, was auch der Umstand belegt, dass die Sänger fast immer günstige Positionen auf der Bühne haben und nicht permanent Dinge zu tun haben, die sie allzusehr ablenken, ohne dass man das Gefühl hätte, altmodischer Rampensteherei beizuwohnen oder man szenischen Leerlauf zu beklagen hätte.
Eine exzellente, vielschichtige Amme war Susan Maclean, die die Partie nicht nur in allen Lagen ausgesprochen schön und gleichermaßen expressiv sang, ohne in Sprechgesang und grelle Überzeichnungen zu verfallen, sondern auch durch ihre exzellente Diktion, die Übertitel beinahe überflüssig machte, und eine faszinierende Darstellungsgabe immens für sich einnahm.
Man hatte von der exzellenten Salome gehört, die Ludmila Slepneva am Nationaltheater und anderswo gesungen hat, und in der Tat passt eine an Partien des italienischen Fachs geschulte Stimme sehr gut zur Kaiserin (erinnern wir uns, dass auch Maria Jeritza, Leonie Rysanek oder Anna Tomowa-Sintow großen Erfolg in diesem Bereich hatten). Es war bemerkenswert zu hören, wie viel Mühe sie sich mit dem Text gab, wie viele feine Details sie vokal wie darstellerisch herausarbeitete. Nicht zuletzt hat sie auch dieses leicht hysterische Flirren bei hohen Tönen, das hier sehr attraktiv und passend ist, auch ihre Legatoqualitäten verdienen Erwähnung, und zudem konnte sie sich noch von Akt zu Akt steigern und sang ein wirklich aufregendes "Vater, bist du's?". Über deutlich weniger Applaus konnte sich dagegen Caroline Whisnant freuen, die inzwischen eine erstaunliche Karriere im hochdramatischen Fach macht und beängstigend viele Vorstellungen außerhalb ihres Stammhauses zu singen hat. Zweifellos hat sie eine Riesenstimme und alle Töne für diese Partie, erstaunliche Stamina in den entscheidenden Momenten besonders am Ende des zweiten Aufzugs und zu Beginn des dritten - das muss man wirklich erst einmal so singen! -, aber unter den beeindruckenden Tönen sind nicht nur einzelne auch einfach nur laut, schrill und flackernd. Leider hatte ich auch anders als bei den anderen Protagonisten nicht das Gefühl, dass sie sich mit dem Gesungenen wirklich intensiv auseinandergesetzt hat (Ausnahmen wie das Pianissimo auf "und meinte zu fliehen dein Angesicht" sollen indes nicht unerwähnt bleiben), selten gelangte sie zu einer wirklichen Interpretation, was nicht zuletzt daran liegen mag, dass sie intensiver an ihrer Aussprache und ihrem Deutsch arbeiten muss. Auch darstellerisch war sie weit davon entfernt, die "junge schlanke Verdrossene" zu sein, von der der Dichter in seiner Handlung spricht. Vielleicht hätte sie doch besser mit Ludmila Slepneva als Kaiserin alternieren und die Färberin nur mitstudieren sollen - diese vertrackte, anstrengende Rolle hätte sie auch noch in ein paar Jahren singen können. Ein noch sehr junger Barak mit schönem Legato, ebenmäßigem Ton und exzellenter Aussprache war Thomas Jesatko, der an Ausstrahlung zweifellos noch gewinnen wird. Manchen Hörer von heute mag die wirklich dramatische Stimme von John Horton Murray irritieren, die nicht die helle Farbe und den Glanz eines lyrischen Tenors besitzt, dafür aber das Gewicht eines Heldentenors, wie man sie von historischen Aufnahmen kennt und schätzt, und ähnlich wie sie muss er für den einen oder anderen Ton oberhalb des Systems hörbar arbeiten und um die korrekte Intonation das eine oder andere Mal kämpfen, nicht immer, aber doch meistens mit Erfolg. Ein kluger Gestalter ist der bemerkenswerte Künstler in jedem Fall, und so sind auch seine Szenen - nicht wie in manch anderer Produktion - mehr als vokale Höhepunkte.
Auf außerordentlichem Niveau und mit großer Präzision sangen Frank van Hove (Einäugiger), Taras Konoshchenko (Einarmiger) und Oskar Pürgstaller (Buckliger) die drei Brüder des Färbers, Jan Buchwald war ein gewichtiger Geisterbote von großer Würde, die am Nationaltheater so beliebte Cornelia Ptassek mit frischem, tragfähig-durchdringendem Sopran ein aufhorchen lassender Hüter der Schwelle, solide Leistungen kamen von Marina Ivanova als Stimme des Falken, Yonka Hristova als Stimme von oben sowie Avtandil Merebashvilii, Junchul Ye und Stephan Somburg als Stimmen der Wächter der Stadt. Axel Kober, der junge, immens talentierte kommissarische GMD des Nationaltheaters, hat den gewaltigen Klangapparat beeindruckend im Griff und macht dem Bühnenpersonal die ohnehin schwere Sache nicht noch schwerer, er nimmt sich auch die nötige Zeit und hetzt nicht durch das Werk, er überrumpelt die Zuhörer nicht, "so daß sie gar nicht recht zur Besinnung kämen", wie es Fritz Schalk als Kritik in seinen Blicken in die Partitur referiert, es gelingen Momente von großer Dichte wie etwa der erste Aktschluss, aber andere wirken noch zu einstudiert, zu wenig gefühlt, so dass man den Eindruck hat, dass der Dirigent wie sein weitgehend hinreißend musizierendes Orchester noch eine Zeitlang brauchen, damit sich dieses besondere Werk setzen kann, damit die innere musikalische Gedankenwelt dieser Oper noch überzeugender erfasst werden kann. FAZIT |


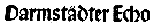

 Die Kaiserin (Ludmila Slepneva, links) fragt ihre Amme (Susan Maclean, rechts),
Die Kaiserin (Ludmila Slepneva, links) fragt ihre Amme (Susan Maclean, rechts),  Die Amme (Susan Maclean, Mitte) weiß ihrer Herrin (Ludmila Slepneva als Kaiserin, links)
Die Amme (Susan Maclean, Mitte) weiß ihrer Herrin (Ludmila Slepneva als Kaiserin, links)  Die drei Brüder des Färbers (Frank van Hove als Einäugiger,
Die drei Brüder des Färbers (Frank van Hove als Einäugiger,  Die Kaiserin (Ludmila Slepneva) erkennt,
Die Kaiserin (Ludmila Slepneva) erkennt,  Der Kaiser (John Horton Murray) und die Kaiserin (Ludmila Slepneva)
Der Kaiser (John Horton Murray) und die Kaiserin (Ludmila Slepneva)