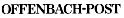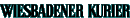|
Mit Anmut vor dem Abgrund Wiener Redouten-Zauber: Guillaume Bernardi läßt seine Frankfurter „Figaro"-Inszenierung tanzen Ein rechter Tausendsassa beherrscht nicht allein das Komponieren und mehrere Instrumente, sondern kann auch singen, tanzen, schauspielern. Mozart war so einer: Immer wieder berichtet er dem Vater von seinen Auftritten als Harlekin bei den „Masquerader" und Ballen in seiner Wiener Wohnung oder in der Offentlichkeit. ,,Die Erfindung der Pantomime", berichtete Wolfgang Amade am 3. Marz 1783 dem Vater, ,,und die Musick dazu war beydes von mir." Seine Musik, auch die rein instrumentale, ist von Tanz- und Gebardensprache durchdrungen, und die große Ballszene im ersten Akt von ,,Don Giovanni" wie der Fandango im ,,Figaro" mogen einen Eindruck vermittein von den Wiener Redouten vor allem zur Karnevalszeit, mit Mozart in vielen Rollen mittendrin. Von diesem Tanzansatz, genauer der Zusammenschau von Singen, Spielen und Tanzen, geht Guillaume Bernardis Frankfurter Neuinszenierung von ,,Le nozze di Figaro" aus, von Bernd Niedecken choreographisch mitgetragen. Da an diesem tollen Tag im Wirbel der Verkleidungen und Verwechslungen jeder jedem etwas vorspiegelt und vorspielt, lag zudem die Idee eines Theaters im Theater nahe. Beide Komponenten sind nirgends überstrapaziert, sondern organisch in ein harmonisches Gesamtkunstwerk eingebunden. So manifestiert sich der Tanz in seinen Fixpunkten, etwa im durchchoreographierten Fandango und den ebenso sorgfaltig ausfigurierten Hochzeitstanzen danach. Daneben charakterisieren Tanzfiguren auch Individuen oder Momente - etwa, als ironische Pointe, Susannas kluges Durchschauen brenzliger Situationen oder des Grafen barocker Balztanz beim Flirt mit der Zofe, der ihn zugleich als Angehörigen des maroden ancien régime am Vorabend der Franzosischen Revolution kennzeichnet. Das Inszenierte der Intrige bildet Moritz Nitsche ab in Form von sparsatn ausgestatteten Guckkasten innerhalb des großen Buhnenrahmens. Zum Blickfang gerat im Schlussakt das großmutige Verzeihen der Gräfin von einer dieser kleinen Bühnen herab. Nicht minder eindrucksvoll das Finale: Mit zwei Hochzeiten sind die Turbulenzen eben noch nicht ganz ausgestanden; und so wird das ganze Personal samt der halbabstrakten Architektur auf der Drehbühne wie in einen Sturm der Emotionen oder dem der kurz bevorstehenden Revolution durcheinandergewirbelt - ein Aufbegehren des Bürgertums gegen die Aristokratie, das Figaro mit Susanna und der ursprünglich ebenso bürgerlichen Gräfin Rosina schon einmal probt. Auch die Kostüme von Peter DeFreitas haben Anteil am Konzept: Elemente des Barock und der Commedia dell'Arte - Soon-Won Kangs Bartolo als Capitano, Michael McCowns Basilio als Dottore - entsprechen,der unaufdringlichen Tanzgestik. Besondere Ausstrahlung gewann diese unangestrengte, stilistisch geschlossene, in der Personenführung ausgefeilte, doch zuweilen die Konvention streifende Inszenierung durch hervorragende musikalische Leistungen. Das von Julia Jones glühend energisch geleitete Frankfurter Museumsorchester ließ von der rasanten, mit kleinen Sprengladungen durchsetzten Ouvertüre an keinen Zweifel an Mozarts umstürzlerischem Geist: Zu hören war eine Buffa mit Ecken und Kanten, aber auch mit Atem, Farber und klanggestischen Spannungen.. Die Rezitative waren, wie schon bei Christof Loys Frankfurter Inszenierungen von Mozarts ,,Entführung aus dem Serail" und ,,Titus", geistsprühend, witzig kommentiert und illustriert von Felice Venanzonis Improvisationen am Hammerflugel. Süperb gerieten auch fast sämtliche vokale Darbietungen. Johannes Martin Kränzles nobler Bariton bewahrte dem Grafen Almaviva auch in dessen amourösem Scheitern noch die aristokratische Wurde. Maria Fontosh gab dem Liebesleid der Gräfin einen metallisch-dramatischen Unterton. Simon Baileys so kraftwie klangvoller Figaro-Bariton ließ den Balanceakt zwischen Loyalität gegenüber der Herrschaft und leicht entflammbarer Revolte, auch in der Eifersucht, ahnen. Nicht weniger kernig, dabei immer flexibel klang Miah Perssons Susanna. Jenny Carlstedt zeigte den Cherubino als plastische Charakterstudie eines Erotomanen auf den Spuren Almavivas. Annette Stricker war bis in die Tanzfingerspitzen hinein eine köstlich uberspannte Marzelline, Elin Rombo eine bodenständige Barbarina mit anmutigem Sopran. Zwar hattees diese bereits dritte Frankfurter ,,Figaro"-Inszenierung der letzten zwanzig Jahre, anders als zuletzt Peter Mussbachs im Kohlenkeller der emotionalen Verwirrung landende Vorgängerin von 1996, nicht auf seelische Abgrunde abgesehen. Trotzdem war die ,,bedrohliche Anmut", die Thomas Mann in seinem ,,Doktor Faustus" an Mozarts Commedia per Musica ,,Le nozze di Figaro ossia La folle giornata" hervorhebt, wenigstens zuzeiten zu ahnen. ELLEN KOHLHAAS |
|
Oper Frankfurt Neue Drehung im Intrigen-Getändel VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Es war keine auf spektakuläre Art große Figaro-Inszenierung wie diejenigen von Claus Guth oder Christoph Marthaler in Salzburg, eher eine auf leisen Sohlen eindrückliche, sogar bedeutend, wie Jürgen Goschs Frankfurter Interpretation vor 20 Jahren. Leicht nämlich hätte man die Arbeit des kanadischen Gastregisseurs Guillaume Bernardi unterschätzt, beschriebe man sie als konsequente Stilisierung à la Commedia dell'Arte mit stereotypen Posen und komisch verdrehter Körpermechanik. So kündigte sich's schon als Schattenspiel hinter weißem Vorhang in der Ouvertüre an. Und so ließ auch die sanfte Ironisierung einer raumgreifend armrudernden "schönen Seele" bei der Auftrittsarie der Gräfin nach insgeheim zwinkernd-augendeckelflatternden Uneigentlichkeiten in dieser schwanengleich edlen Mozartkantilene suchen. Aber nein, nicht durchweg ins Eingekastelt-Künstliche gelenkt waren die Temperamente an diesem Abend, und manchmal - bei der herrisch auftrumpfenden Grafenarie im dritten Akt etwa - wurde das Prinzip der minimierenden Vertricksung ganz verlassen, wurde auch unumwegig dramatisch-vehement agiert. Mehr den Nebenpersonen war das puppenhaft Skurrile vorbehalten, so der geziert-präzisen Marzelline von Annette Stricker, dem bizarren Basilio von Michael McCown oder dem in seiner wieselig-wuchtigen Bass-Emission leicht unterbelichteten Bartolo von Soon-Won Kang. Versöhnungs-Schlichtheit Auch das Drehbühnenarrangement von Bernd Niedecken kam zunächst mit Understatement daher. Figaro nahm Maß auf dem winzigen Podest einer Wanderbühne. Links ragte ein dunkler Kasten, in dem man zu Recht die Gräfinnen-Kemenate, den Schauplatz des zweiten Aktes, vermutete. Nach einer weiteren Drehung wurde im dritten Akt die andere Seite jenes Kastens mit einem Treppenaufgang sichtbar, auch schon ein freies Gelände mit katafalkartigem Denkmal für das nächtliche Gartenverwirrspiel des Finalaktes. Merkmale "armen Theaters" mischten sich in dieser Szenenkonstruktion mit (auch beleuchterischem) Raffinement. In schönem Kontrast dazu Peter DeFreitas Kostüme, deren Gespreiztheit parallel mit der "altmodischen" musikalischen Konnotation zunahm. Recht genau, ja geradezu wörtlich nahm's diese Szenografie mit der musikalisch-dramatischen "Übersetzung" ins Sichtbare. Dabei verbot sie sich konventionelle, aber wichtige Requisiten wie den Sessel im ersten Akt nicht. Und Antonio (der unvermeidliche Carlos Krause) schwenkte seine Blumentopfscherbe vielsagend dicht über dem Kopfkissen der Gräfin. Es durfte viel gelacht werden. Auch über die im dritten Akt immer mehr um sich greifende Düpierung, Verfinsterung des Grafen - angesichts von Ereignissen, die sich eigens gegen ihn und seine edelmännische Verliebtheit zu verschwören anschicken. Johannes Martin Kränzle intoniert den Almaviva in allen erdenklichen Facetten von Autorität und schmeichelnder Kavaliersmäßigkeit. Ausgerechnet der Page Cherubino (schlank und groß, stimmlich etwas flach: Jenny Carlstedt) kommt ihm dabei dauernd als Running Gag in die Quere. Vielleicht ihre beste "Drehung" bekommt die Inszenierung - auch im Wortsinne - gegen Schluss. Das lyrisch sich aufwölbende "Contessa perdona" bereitet immer einiges Kopfzerbrechen. Ist es in da Pontes Text ein voluntaristischer Schlusspunkt, um eine Geschichte, die in ihrem Intrigen-Getändel ewig weitergehen könnte, quasi gewaltsam zu beenden? In ihrer Versöhnungs-Schlichtheit könnte man auch die musikalische Wendung als Opus 1 von Albert Lortzing bezeichnen, womöglich als sakralmusikalische Überhöhung. Ganz gewiss ist's eine Überschreitung, wie (un-)glaubwürdig auch immer. Bernardi verdeutlicht das, indem er die segensreiche Gräfin als Ikone auf einer winzigen Extra-Bühne erscheinen lässt. Aber dennoch geht das Stück weiter: mit der Schluss-Stretta, die sonst meistens nur als planer Ensemble-Kehraus an der Rampe funktioniert. Hier löst sich die Gruppe wieder auf und taumelt, irrlichtert wie verloren über die nochmals in hohem Tempo einmal mit allen Schauplätzen rotierende Drehbühne. Es ist Bernardi gelungen, eine alte Geschichte so zu erzählen, dass sogar der ausgepichteste Kenner wieder einiges Neue in dem (wie alle guten Stücke) unerschöpflichen Werk entdeckt. Dabei geht es ohne Verkrampftheiten ab, ohne ratternde Gags. Natürlich ist die (scheinbar) "unpolitische" Sicht auf das revolutionäre Sujet heute ebenso Ehrensache wie vor 40 Jahren das Gegenteil. Flinke Eloquenz Das nicht ganz einheitliche Vokalteam war mit der zierlichen, stimmlich substanzreichen Gräfin von Maria Fontosh bestens abgerundet; in vollendeter Balance erklang die erste Arie, etwas instabiler kam die emotional vielgestaltigere im dritten Akt. Luftig und dennoch kernig wirkte das Susanna-Timbre von Miah Persson. Schließlich Simon Bailey in der Titelrolle: ein nicht unbedingt auf "interessant" trainierter, stimmlich zwischen Leichtigkeit und Gewicht gut ausgleichender Drahtzieher und -gezogener. Anmutig Elin Rombos Barbarina. Die Dirigentin Julia Jones war bereits mit der Entführung in Frankfurt als profilierte Mozartinterpretin hervorgetreten. Auch diesmal brachte sie eine eigene, persönliche Note ins Spiel. Wohltuend, dass sie sich keiner übermächtig "aktuellen" Lesart beugte, etwa der von Nikolaus Harnoncourt neuerdings vorgegebenen magistral-altväterlichen Gravität. Sie vertraute mehr auf Beweglichkeit, flinke Eloquenz (auch bei der rasanten Hammerflügel-Rezitativsekundanz von Felice Venanzoni). Gelegentlich tendierte das zur Verflüchtigung der Tongestalten. Auch brauchte es eine gewisse Anlaufzeit, bis das Orchester (besonders das leicht knallige Blech im Tutti) sich auf die leichtfüßige, schwebende Diktion eingestellt hatte. Bewundernswert vor allem die Sicherheit, mit der die Ensembles in Fluss gehalten und abgestimmt wurden. Nicht ganz so vorteilhaft war der Konnex mit dem Chor (Einstudierung: Apostoplos Kallos), bei dem schon kleinere Bewegungsaktivitäten im dritten Akt geringfügige Störungen hervorriefen. Gleichwohl fast unverständlich, dass es für Julia Jones auch einige Buhs gab. Ist herrschende Musikmode wirklich ein Zwangskorsett? Umso notwendiger dann, wenn Jones/Figaro "revolutionär" gegen Imperator Almaviva/Harnoncourt aufbegehrt. [ document info ] Copyright © FR online 2007 Dokument erstellt am 05.03.2007 um 16:32:01 Uhr Letzte Änderung am 05.03.2007 um 17:23:30 Uhr Erscheinungsdatum 06.03.2007 |
|
Im Chaos der Gefühle Von Michael Dellith Intendant Bernd Loebe kann stolz auf dieses Ensemble sein: Fast ausschließlich mit hauseigenen Kräften konnte diese Neuproduktion des „Figaro" realisiert werden. Und das auf einem bis in die kleinste Partie hinein durchweg hohem Niveau. Auch so spielstark hat man das Frankfurter Ensemble seit längerem nicht mehr erlebt. Regisseur Bernardi hat mit seiner ausgeklügelten Personenführung die von Peter DeFreitas ebenso prunk- wie fantasievoll kostümierten Bühnenfiguren zu einer prägnanten Körpersprache animiert. Auf diese Weise wurden Da Pontes mitunter herrlich ironisches Libretto und Mozarts augenzwinkernde Musik detailreich umgesetzt – und das oft verwirrende Spiel dieser Opera buffa, die mit ihren Intrigen, Verwechslungen und Verkleidungen die Protagonisten geradezu in ein Chaos der Gefühle stürzt, wesentlich erhellt und für den Zuschauer verständlicher gemacht. Als Kontrast zu den üppigen Kostümen schuf Moritz Nitsche eine sehr sparsame, nüchterne Kulisse auf der offenen Drehbühne mit mehreren Spielflächen, wobei das mit vielen Türen versehene Schlafgemach der Gräfin als perspektivisch verengte Guckkastenbühne im Zentrum steht. Als Requisiten reichen ein paar Vorhänge, Bett und Stühle völlig aus. Inspiriert wurde das lebhafte, jedoch nie übertrieben turbulente, ganz natürlich anmutende, oft tänzerisch bewegte Bühnengeschehen von der hervorragenden Arbeit aus dem Orchestergraben. Mit Julia Jones am Pult, die sich in Frankfurt bereits mit der „Entführung" und „La finta semplice" als erstklassige Mozart-Interpretin vorgestellt hat, spielte das Museumsorchester wie „aufgekratzt". Der durch den Einsatz von Naturtrompeten und -hörnern apart eingefärbte Klang war stets schlank in der Kontur, mit trockenen Akzenten klar profiliert, pulsierend in der rhythmischen Grundierung und wunderbar ausdrucksvoll in den Gesten. Die Tempi wählte Julia Jones sehr rasch, zuweilen bis hart an die Grenze gehend, besonders wenn sie zu den Akt-Finali hin noch einmal richtig Gas gab. Als Glücksgriff erwies sich Felice Venanzoni, der die Secco-Rezitative auf dem Hammerklavier statt auf dem sonst üblichen Cembalo begleitete und diese oft vernachlässigten Passagen mit seiner ideenreichen Ausgestaltung zu funkelnden Kleinodien werden ließ. Uneingeschränktes Lob auch für die Sänger, die mit ihren Mozart-tauglichen Stimmen eine homogene Einheit bildeten: Bei den hohen Frauenpartien harmonierten Maria Fontosh als sich nach Liebe sehnende Gräfin und Jenny Carlstedt als naiv-unsicherer Cherubino vortrefflich mit Miah Perssons liebreizender Susanna. Die schwedische Sopranistin stellte nicht allzu sehr das kokette Element der Kammerzofe in den Vordergrund, agierte vielmehr mit Witz und Charme. Die Männer standen dem freilich nicht nach. Johannes Martin Kränzle gab den Grafen Almaviva großspurig, rachsüchtig und verletzlich, aber nie polternd in seinen leidenschaftlichen Ausbrüchen. Simon Baileys grundgütiger Figaro gefiel durch die noble Kultiviertheit seines Bassbaritons. Als clowneskes Paar sorgten Annette Stricker (Marzelline) und Soon-Won Kang (Bartolo) für Lacher. Carlos Krause als trinkfreudiger Gärtner Antonio, Michael McCowns spaßiger Basilio sowie Elin Rombo als entzückende Barbarina ergänzten das muntere Team, wobei der von Apostolos Kallos einstudierte Chor nicht unterschlagen werden sollte. Die Choristen haben zwar bei Mozarts „Figaro" nicht allzu viel zu tun, aber ihre Einlagen gelangen ausgesprochen klangschön. „Zu viele Noten", kritisierte einst der Kaiser die Mozart-Oper bei der Uraufführung. Die Frankfurter Inszenierung zeigt, dass bei diesem Meisterwerk keine einzige Note zu viel ist. Der einhellige Beifall am Premieren-Ende bestätigte es. |
|
Auch beim Opern-Schach wird die Königin geschützt
Kein düsteres Beziehungsdrama, kein Aufstand der kleinen Leute gegen die da oben: In der Frankfurter Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts "Hochzeit des Figaro" wird ein Spiel im Spiel spannend abgezogen. Wie beim Schach lässt Regisseur Guillaume Bernardi Diener und Graf Zug um Zug um ihre Königin kämpfen. Dabei setzt er auf eine eigenwillige Personenregie, die starke Sängerdarsteller verlangt. Kein Problem an der Oper Frankfurt, die mit der Britin Julia Jones am Dirigierpult und dem hoch motivierten Museumsorchester den elastischen, schlanken Mozart-Ton bevorzugt. Alles Voraussetzungen für ein weiteres hochwertiges Fest der Stimmen, das zur Premiere am Sonntagabend mit kräftigen Bravos gefeiert wurde. Der eine will sie heiraten, der andere pocht auf sein "Recht der ersten Nacht", das er eigentlich abgeschafft hatte: Doch Textdichter Da Pontes Graf - die Oper fußt auf dem Intrigenstück "Der tolle Tag" von Beaumarchais - hat nicht mit dem Objekt seiner Begierde gerechnet, der seinem Diener versprochenen Susanna. Samt gewitztem Figaro zieht sie ein Verwechslungsspiel ab, bei dem der gnadenlos demontierte Schlossherr am Ende seine frustrierte Gemahlin um Vergebung bitten muss. Wie Scherenschnitte muten die Helden schon zur locker-flockig abgespulten Ouvertüre an, hinter hellem Vorhang die Köpfe komisch zusammensteckend und höfische Begrüßungsrituale übend. Die Posen kehren wieder auf halbdunkler Szene mit einer Art Wanderbühne, auf der Figaro die Maße für sein Ehebett ermittelt. Im Hintergrund deutet eine nackte Frauenskulptur den ebenfalls kargen herrschaftlichen Park an, schwarze Außenmauern, später sich in Kolonnaden verwandelnd, lässt die seitliche Holzkonstruktion erahnen. (Ausstattung: Moritz Nitsche). Gespielt wird in Kostümen der Mozartzeit, das als Huldigungsmasse vorgesehene und samt Hofstaat Fandango tanzende stimmsichere Chor-Volk (Einstudierung: Apostolos Kallos) tritt in schlichtem Delft-Keramik-Blau auf. Die Gewänder der Hofschranzen sind je nach Intrigierfaktor fantasievoll aufgepeppt. Der als Musikmeister und Richter fungierende und bewusst meckernd seinen Tenor einsetzende Michael McCown etwa trägt Perücke und eine besonders spitze Nase. Doch mehr als die Kostüme und das unnatürlich bonbonfarbene Licht, im Schlafzimmer-Kubus der Gräfin mit dem Bett auf schräger Ebene, einem riesigen ovalen Einschnitt in der Decke und Türen zum Versteckspielen, ordnet die intensive Körpersprache der Akteure das Verwirrspiel, überdeutlich künstlich, wenn ein neuer Schachzug ansteht, stark zurückgenommen, wenn es um echte Empfindungen geht. Das dieses permanente Gestikulieren ohne Peinlichkeiten abgeht, liegt an der Musik, ebenfalls ein Wechselbad aus echten und falschen Gefühlen, in den wie geschliffenen Quartetten und Ensembles sogar gleichzeitig ausgespielt. Julia Jones, die am Dirigierpult sehr suggestiv arbeitet, die tanzt und noch mit den Augen Einsatz fordert, hat straffe Tempi verordnet, Affekte verstärkt und Effekte (gestopfte Hörner) nicht verschmäht. Die musikalische Spannung schüren Rezitative, die Felice Venanzoni wie improvisatorisch am Hammerflügel begleitet, dabei sogar in die Vollen greifend, wenn’s um faulen Zauber geht. Für die Sängerdarsteller ist das ausgesprochen motivierend; allen voran für Figaro, den mit allen Wassern gewaschene Schachspieler. Doch Bassbariton Simon Bailey weiß in seinen Arien auch Nachdenklichkeit zu säen. Als Susanna ist Miah Persson eine Wucht, mit ausdrucksstarkem Sopran, prädestiniert für die lyrischen Momente und ein durchtriebenes Persönchen, das freilich auch Betroffenheit bezeugt. Den gnadenlos auf Affären erpichten Grafen gibt Johannes Martin Kränzle so souverän wie eh und je, dabei mit starkem wie empfindsam verhaltenen Bariton sogar echte Gefühle (für Susanna) zeigend. Doch die bleiben der Gräfin, Maria Fontosh, vorbehalten, deren charaktervoller Sopran nicht nur in "Hör mein Flehn, o Gott der Liebe" anrührt. Zum Publikumsliebling wird am Premierenabend die Finnin Jenny Carlstedt. Den hin und her gerissenen, permanent zum Rollenwechsel gezwungenen Cherubino spielt sie verschämt jungenhaft - bei standfester Sopranstimme. Letztlich angelt sich diesen Heißsporn Barbarina, trotz einfachen Gemüts die große Durchblickerin, eine Paraderolle für die auch stimmlich kompetente schwedische Sopranistin Elin Rombo. In der Norm: Annette Stricker mit veritablem Mezzo als Marcellina und der stimmlich ein wenig unentschlossene Bass Soon-Won Kang als Bartolo. Fazit: Es geht auch ohne Anna Netrebko. Vor allem in Frankfurt, wo das Ensemble der Star ist in einer völlig jugendfreien Inszenierung, die zum Publikumsrenner werden könnte. KLAUS ACKERMANN |
|
Flacher "Figaro" in Frankfurt Ein wenig flach geriet in Frankfurts Oper Guillaume Bernardis Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Le nozze di Figaro". Während die Dirigentin Julia Jones einige Buhrufe einstecken musste, gab es begeisterten Applaus für die Sänger der Premiere. Ein Herz für Graf Almaviva Ganz schön harmlos: Mozarts "Le nozze di Figaro" an der Oper Frankfurt Von Volker Milch
FRANKFURT Revolution? Rollende Köpfe? Aufbegehrender Pöbel? Aber nein. Von dem, was da am Horizont von Mozarts Oper "Le nozze di Figaro" aufdämmert und in der bekannten Herausforderung anklingt, ob der Herr Graf ein Tänzchen wagen möchte, ist auf der Bühne der Oper Frankfurt kaum etwas zu spüren. Friede, Freude, Eierkuchen herrschen denn auch im Schlussbild, wenn der Text von Mozarts Librettist Lorenzo da Ponte ganz wörtlich umgesetzt wird: Alles eilt zum fröhlichen Fest. So weit, so bunt. Elf Jahre nach Peter Mussbachs Frankfurter Kohlenkeller-"Figaro", bei dem es die Festgesellschaft nicht mehr bis zum Fest schaffte, nun eine Neuinszenierung durch den kanadischen, bereits im Bockenheimer Depot hervorgetretenen Regisseur Guillaume Bernardi. Er wollte laut Programmheft versuchen, "das Stück nicht so sehr unter dem Aspekt zu betrachten, wo es hinführte, sondern unter dem Aspekt, wo es herkam." Gemeint ist aber nicht etwa eine satirische Schärfung im Rückgriff auf die der Oper zugrundeliegende Komödie von Beaumarchais, sondern primär eine Rückbesinnung auf ästhetische Traditionen wie die Spielweise der "Commedia dell´Arte". Das hat zunächst durchaus seine Reize. Man spürt, dass der Regisseur und sein choreografischer Mitarbeiter Bernd Niedecken ihre ganze Energie in die detaillierte Personenführung stecken, selbst die Position der Fingerspitzen nicht dem Zufall überlassen. Man bewegt sich "geziert", grotesk, galant, und in der Überzeichnung des Gestischen teilt sich die Situation mit: Theater auf dem Theater. Dazu passt das kleine Podest einer Stegreif-Bühne, die Moritz Nitsche gebaut hat. Vor ihr hängt, wie provisorisch, ein gelber Vorhang. Die Drehbühne ermöglicht immer wieder den Blick hinter die Kulissen, die im Fall des Zimmers der Gräfin ziemlich groß geraten sind: Ein kalter weißer Raum, in der die traurige Gattin des lüsternen Grafen zu barocken Posen erstarrt. Neben dem kleinen Straßentheater wohnt die große Oper. Die choreografische Personenführung verfehlt ihre Wirkung nicht und wird von fabelhaften Sängerdarstellern getragen. Charmant wirbelt Jenny Carlstedts Cherubino über die Bühne, und über die Susanna der Miah Persson müsste man Superlative ausschütten - stimmliche Brillanz und Spielfreude dürften schwer zu übertreffen sein. Höchst vitale Präsenz zeigen auch, mit schön geführtem Bariton, Simon Baileys Figaro und Johannes Martin Kränzles souveräner Almaviva. Als Gräfin hat Maria Fontosh zunächst mit kleinen Intonationsproblemen zu kämpfen - im "Dove sono" aber wird ihr großformatiger Sopran anrührend aufblühen. Mit ihren Mezzo-Qualitäten wertet Annette Stricker die Figur der Marcellina auf, nicht zuletzt köstlich im exaltierten Spiel. Dennoch wird die Freude über die musikalische Seite der Premiere im Schlussapplaus nicht ungetrübt sein: Die Gastdirigentin Julia Jones und das Museumsorchester werden mit sehr deutlichen Buhrufen abgestraft. Sorgen vielleicht die würzigen Originalklang-Bemühungen für Irritationen? Es scheppert gelegentlich ziemlich blechern aus der rechten Ecke: Historisches Instrumentarium ist ja bekanntlich nicht leicht zu domestizieren, wird aber im Museumsorchester bereits seit ein paar Jahren (und mit steigender Tendenz) eingesetzt. Trotz einiger Koordinationsprobleme (bereits in der Ouvertüre) überwiegt aber der Eindruck eines inspirierten, temperamentvollen Dirigats. Auf Dauer hat man jedenfalls mehr Freude am musikalischen als am szenischen Konzept des Abends. Der Regie geht nämlich nach dem zweiten Akt zunehmend die theatralische Puste aus. Vielleicht sollte man künftig doch ein bisschen weniger "Commedia dell´Arte" und etwas mehr Grafen-Dämmerung spüren lassen. Es müssen ja nicht gleich die Köpfe rollen. |
|
Frankfurt erfreut sich an "Nozze di Figaro" Die Oper am Main hat das Kunststück fertig gebracht, drei Premieren in einer Woche zu stemmen: neben den - vom Aufwand her - zwei Leichtgewichten "Weiße Rose" von Udo Zimmermann (im "Depot") sowie "Mozart & Salieri" von Rimski-Korsakoff das Schwergewicht "Le Nozze di Figaro" von Mozart. Der kanadische Regisseur Guillaume Bernardi hat diesen "Nozze" auf ganz amerikanische Weise gemacht: klarer verständlicher Handlungsablauf, präzise Personenführung mit theatergenauen Gesten, "dramaturgenfreie" Eliminierung jeglicher sozialer, politischer oder zeitbezogenen Problematik, ästhetische farbige Ausstattung (hier insbesondere der Kostüme - von Peter DeFreitas) und hoher Unterhaltungswert, und da es sich um eine Buffa handelt, nämlich die Fortsetzung des "Barbiers von Sevilla" von Beaumarchais/Paisiello, eine kontrastreiche Akzentuierung auf Witz, Komik und Slapstick. - Wer einmal in Nordamerika Mozartopern auf der Bühne gesehen hat, wie z.B. "Die Entführung aus dem Serail" in Kansas City, wo sich das Geschehen im Orientexpress abspielt, aber haargenau dem Libretto entsprechend umgesetzt wird, oder "Die Zauberflöte" in Toronto, in der der Held Tamino einen bunten fürstlichen Nachen für seine abenteuerlichen Reisen benutzt, der weiss die handwerkliche und schweißtreibende Arbeit der dortigen Regisseure und ihrer Designer zu schätzen. - Ebenso fleißig und gründlich, im Effekt aber mit leichter Hand, haben hier in der "Nozze" Regisseur Bernardi und Bildner Moritz Nitsche den Ablauf und die Räume gestaltet, so dass die Sänger-Darsteller immer einen Fixpunkt oder Halt für ihre variationsreiche Stellungen finden, anfangs eine Minibühne mit Sessel und abschließenden Vorhang, im nächsten Akt ein im Vordergrund offenes hohes Schlafzimmer mit vielen Türen und seitlichen Aufgängen, dann eine Arkadenwand mit Stufen davor, wo sich trefflich agieren lässt, und am Ende eine offene Bühne mit Gartendenkmal, Seitenarkade und eine erhöhte Guckkastenbühne im Abschluss, auf der am Ende die versöhnte Gräfin erscheint, im Triumph, worauf sich die eigentliche Theaterbühne zu drehen beginnt, mit zunehmend zentrifugalen Kräften. - Dem musikalischen Duktus entsprechend entwickeln sich aus den Bewegungen verschiedentlich Tänze, so auch "Fandango´s" (Mitarbeit Choreograf Bernd Niedecken). - Sehr viel Fantasie sowie Aufwand wurde gleichfalls in die Kostüme aus alter Zeit gesteckt; Graf und Gräfin edel und elegant, Marzelline und Bartolo, die Eltern Figaros, üppig aufgedonnert bis hin zu den auffälligen Hüten, die Bediensteten in höfischer Arbeitskleidung. Die überwiegend junge, meist aus dem Ensemble stammende Sängerschar sang insgesamt vortrefflich. Die guten oder sehr guten Stimmen waren zudem stets auf den theatralischen Ausdruck fixiert. Hervorzuheben "Graf" Johannes Martin Kränzle, der in voller Breite den Schlossherrn, ausgetricksten Liebhaber und Arrangeur charakterisierte, der Gewinner "Figaro" Simon Bailey mit schönen Baritontönen, kaum eine Miene verziehend, "Gärtner" Carlos Krause, scheinbar betrunken und schon in Rente. Tadellos auch alle Damen, so Maria Fontosh als Gräfin, die in ihren leidvollen feinen Arien gleichfalls etwas Selbstironie entwickeln konnte, Miah Persson die Susanne, die herumwirbelte und allen Situationen gewachsen war, Jenny Carlstedt als Cherubino, der keine peinliche Lage ausließ, und Annette Stricker als muntere, energische Marzelline. Dirigentin Julia Jones entfachte mit dem auf alten Klang eingestimmten Orchester ordentlich Schwung und originelle, glühende sowie beredte Tonfarben, selbst der Pauker hatte viel zu tun. Felice Venanzoni am Hammerklavier glänzte mit Improvisationen bei der Mitgestaltung der Rezitative. Die kollektive Übereinstimmung von Musik, Einzel- und Chorgesang (Leiter Apostolos Kallos) mit den Choreografien und der Bebilderung erhöhte das Vergnügen an dieser Aufführung, die ungetrübt auf Lachen und Schmunzeln und Musikgenuss ausgerichtet war - wohl den Realisierungen im alten Wien zur Mozartzeit sehr nahe kommend. Ulrich Springsguth |