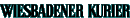|
Zimmermanns "Weiße Rose" VON HANS-JÜRGEN LINKE Der Bühnenraum, den Kaspar Glarner (Ausstattung) und Matthias Paul (Licht) entworfen haben, ein Kubus aus schattenlosem Licht, ist eine schlüssige Darstellung des Nichts - nicht irgendeines, sondern des Nichts, vor und in dem Sophie und Hans Scholl stehen während der letzten Stunde, die ihnen zum Leben bleibt. In solch einer Stunde fasst sich, einer alten Gewissheit zufolge, das Leben selbst noch einmal zusammen; für die Scholls ist es ihr Weg zum Licht, ihr Widerstand im Namen des Lebens und der Wahrhaftigkeit gegen die Tyrannei der Vernichtung und der Heimtücke. Ein Stück Erinnerungspolitik Udo Zimmermanns 16 Szenen für zwei Sänger Weiße Rose - als eine Art Jugendwerk 1968 erstmals angegangen, später überarbeitet und 1986 als Auftragswerk in Hamburg uraufgeführt - hat eine Statur, die es zu einem geradezu offiziellen Stück deutscher Erinnerungspolitik prädestiniert: Es ist geprägt durch klare Fronten, klare Absichten und klare ästhetischen Entscheidungen, eine Sammlung von Skizzen existenzieller Verzweiflung und eine Apotheose der transzendenten Gerechtigkeit. So wünschte man sich den deutschen Widerstand: ohne politisches Kalkül, ohne Strategien, die ernsthafte Gedanken über Macht erkennen ließen, einzig dem Motiv menschlich verpflichtender Betroffenheit entsprungen. Zimmermanns Musik liefert selbst ein anschauliches Stück Unbeugsamkeit. Sie scheut keine Pathosformel und zeichnet das Drama der letzten Lebens-Stunde in holzschnitthafter Zuspitzung mit dem kompromisslosen Gestus beständigen Aufrüttelns. Als erinnerungspolitischer Gestus ist das mittlerweile historisch geworden, parallel zum mählichen Verschwinden jener Generation, die sich von den scharf geschnittenen Klängen einer musikalischen Moderne noch rütteln und verstören ließ. Es ist aber nicht ohne Reiz, diesem Gestus beim Veralten zuzuschauen. Die Inszenierung von Christoph Quest betont den Historismus, indem sie auf geradezu altmodische Weise Werktreue und eine geradlinige Inszenierungs-Reinheit aufweist. Dass neben die beiden eindrucksvollen Sänger-Darsteller Britta Stallmeister (Sophie) und Michael Nagy (Hans Scholl) als dritte (stumme) Figur der Schauspieler Dominik Betz als Christoph Probst gestellt wird, ist weniger eine gegen den Strich bürstende Inszenierungsidee als vielmehr nachdrückliche Betonung des existenziell-politischen Impetus der 16 Szenen. Zwingend indes erscheint dieser Kunstgriff nicht, die Dreierkonstellation lässt keine Anreicherung des dramatischen Settings erkennen. Auch lassen die dramatische Klarheit und die geradezu antike Größe, zu der Britta Stallmeister und Michael Nagy stimmlich fähig sind, keine Lücke für einen Dritten. Deklamatorischer Habitus Dem monologisch-deklamatorischen Habitus, den Zimmermanns Werk pflegt, entspricht die oratorische Rhetorik der Schauspielerführung, und die drei Stühle - die einzigen Bühnenrequisiten - sind eine etwas klischeehafte Möblierung des Nichts am Ende des Lebensweges. Äußerste Präzision und Werktreue charakterisiert die musikalische Gestaltung des 15-köpfigen Orchesters unter Leitung von Yuval Zorn, der ein vorzüglicher Anwalt der forcierten Schärfe und Härte in Zimmermanns Klanggestus ist. Seine Art, mit Zeit umzugehen, betont die tiefe Beunruhigung, die das Werk als Wirkungsabsicht wie ein Banner vor sich her trägt. [ document info ] Dokument erstellt am 11.03.2007 um 16:52:01 Uhr Letzte Änderung am 11.03.2007 um 21:33:44 Uhr Erscheinungsdatum 12.03.2007 |
|
Missgunst bis in den Tod „Dramatische Szenen" nannte Nikolai Rimski-Korsakow seine Oper „Mozart und Salieri", in deren Mittelpunkt die weit verbreitete Mär steht, Mozart sei 1791 von Antonio Salieri vergiftet worden. Todesahnungen hatte er, seit kurz zuvor ein „schwarzer Unbekannter" bei ihm ein Requiem bestellt hatte. Musikhochschule und Oper ist es zu verdanken, dass dieser musikalische „Thriller" im Opernspielplan aufgenommen wurde. Und weil die Handlung ohne die Musik von Mozarts Requiem unvollständig und unverständlich wäre, baute man in Benjamin Schads Inszenierung die stark an Salieris Stil angelehnte Musik Rimski-Korsakows mit den Mozart-Passagen des Requiems zusammen. Um dem Zuhörer einen authentischen Eindruck von dessen Unvollständigkeit zu vermitteln, wurde auf alle Zutaten – etwa von Süßmayr – verzichtet. Dramaturgisch geschickt wirkte der Einsatz von „Dies irae" in einem Moment, in dem Mozart Salieri von der Musik eines Stehgeigers vorschwärmt und der von Selbstzweifeln zerfressene Salieri neidvoll auf Rache zu sinnen scheint. Die Hauptpersonen hatten in Peter Marsh (Mozart) und Bálint Szabó (Salieri) zuverlässige Darsteller. Besonders der kindlich-unbeschwerte Charakter Mozarts kam gut heraus. Das von Mitgliedern des Museumsorchesters verstärkte Hochschulorchester bot unter Hartmut Keils Leitung eine weitgehend makellose Leistung. Auch brachte der Hochschulchor die Faszination des Requiems angemessen zur Geltung. Trotzdem wirkte manches akustisch stumpf – ein Requiem gehört eher in einen Kirchenraum. Doch dann hätte man diesen aufschlussreichen Abend nicht erleben können. Verhaftet, verurteilt, hingerichtet: Beim Verteilen von Flugblättern, in denen sie zum Widerstand gegen Hitler aufriefen, wurden Hans und Sophie Scholl aufgegriffen und zum Tode verurteilt. Mit ihrem Tod am 22. Februar 1943 starb auch die studentische Widerstandsgruppe „Weiße Rose". Udo Zimmermann beließ es bei seiner Kammeroper „Die weiße Rose" für zwei Sänger und 15 Instrumentalisten nicht beim Dokumentarischen. Vielmehr versuchte er, die Gefühle zweier junger Menschen eine Stunde vor ihrer Hinrichtung nachzuzeichnen. Manchmal etwas zu holzschnittartig konfrontiert er dabei die Brutalität des Terrorregimes durch erbarmungslose Marschrhythmen mit lyrischen Melodien in den Gesangspartien von Hans und Sophie, vermischt Bach-Choräle sentimental mit den Klängen Neuer Musik. Christoph Quest ist die Gratwanderung im Bockenheimer Depot gelungen. In seiner ersten Regiearbeit für die Oper stehen die Geschwister fast beziehungslos nebeneinander, gefangen in den eigenen Bildern. Gelegentliche Umarmungen wirken unvermittelt, fast mechanisch. Die offene Bühne (Kaspar Glarner) bleibt nahezu ungestaltet, es wechselt nur das Licht (Matthias Paul). Dem Geschwisterpaar stellt Quest als stumme Rollen ein weiteres Mitglied der „Weißen Rose", nämlich Christoph Probst (Dominic Betz) und die beiden Gefängnisbeamten Eva Weiler und Martin Georgi zur Seite. Das hebt die historische Dimension hervor, erweist sich aber als überflüssig. Bariton Michael Nagy gibt den Hans mit beweglicher Stimme, die über eine volle, warme Tiefe verfügt und auch leise gut klingt, Britta Stallmeister singt die Sophie auch in extrem hoher Lage noch mit sicherer Intonation. Yuval Zorn und das Museumsorchester zeichnen die Zerbrechlichkeit der äußerst expressiven Musik sensibel nach. Gläsern ertönt sie zu Beginn, sacht wiegend, wenn Sophie von wachem Herzen und dünner Haut spricht, ländlerhaft, wenn das Bild der Kinder auftaucht, und hart, fast martialisch, als Hans schreit: „Nicht schießen!" (ge/car) |
|
Konzentration auf die Geschwister Opern-Premiere Frankfurt: Udo Zimmermanns "Weiße Rose" als Kammerstück Von Axel Zibulski
Die Geschwister Scholl: Szene mit Hans (Michael Nagy) und Sophie (Britta Stallmeister). Runkel FRANKFURT Die Inszenierung beginnt, sobald man das Bockenheimer Depot betritt. Das Einlasspersonal trägt Mäntel und Hüte. Dann fällt der Blick auf eine meterhohe Wand, daran 2 000 Flugblätter. Schüler der Bensheimer Geschwister-Scholl-Schule haben sie gestaltet. Und drinnen, links und rechts der Bühne, wachen zwei Statisten, Gefängnisbeamte. Sobald es still wird, hört man den Regen, der am Premierenabend unaufhörlich auf das Dach des ehemaligen Frankfurter Straßenbahndepots fällt, als ob er ein leise bedrohlicher Teil der Inszenierung wäre. Der 1943 in Dresden geborene Komponist Udo Zimmermann hat mit seiner Oper "Weiße Rose" in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Geschichte der Widerstandsgruppe mit ausgeprägt realistischen Zügen erzählt. In einer grundlegend überarbeiteten Zweitfassung wurde das Stück 1986 erstmals in Hamburg gezeigt, nun als Kammeroper, als "Szenen für zwei Sänger und 15 Instrumentalisten". In dieser Zweitfassung mit ihrem von Wolfgang Willascheck revidierten Text verbinden sich die Worte von Hans und Sophie Scholl nur ganz vereinzelt zum Gespräch, bleiben im Übrigen Monolog, etwa auf Texte von Dietrich Bonhoeffer. In dieser Fassung hatte die Oper jetzt in der Regie des Schauspielers Christoph Quest im Bockenheimer Depot Premiere; man sieht die Geschwister in dem Gefängnis München-Stadelheim am Ende ihres Lebens, in den letzten Stunden vor ihrer Hinrichtung im Februar 1943. Christoph Quest und sein Ausstatter Kaspar Glaner lassen die "Weiße Rose" auf einer nahezu leeren, zu den Seiten hin offenen Bühne spielen. Den größten Teil der etwa eineinviertel Stunden stehen Hans und Sophie für sich, sie links, er rechts, wie durch eine imaginäre Linie getrennt. Einen Stuhl und seine Kleidung hat jeder, aber auch eine große Zahl starker Gesten; und wo diese nicht ausreichen, bringt Regisseur Quest einen stummen Schauspieler (Dominic Betz) ins Spiel, der Christoph Probst, einen Freund der Geschwister Scholl, darstellt und bisweilen wie ein Chronist notiert. Zugleich unterstreicht das die Konzentration auf die Geschwister, auf ihre Gedanken. Konzentrierter lässt sich eine Aufführung dieser Kammeroper kaum vorstellen. Daran haben natürlich auch die beiden exzellenten Sänger ihren Anteil: Britta Stallmeister als Sophie und Michael Nagy als Hans Scholl, die ihre oft in entgrenzt wirkende Höhen führenden Partien mit äußerster Sicherheit und Intensität gestalten. Und jene Kantabilität, die Zimmermann in diesen Szenen immer noch zulässt, wirkt bei ihnen immer beklemmend, ausdrucksstark, nie larmoyant oder gar wie ein Schönklang um seiner selbst willen. Dazu passt auch die kammerorchestrale Gestaltung durch Mitglieder des Frankfurter Museumsorchesters, geleitet von dem israelischen Dirigenten Yuval Zorn, mit der hier nur scheinbaren Süßlichkeit der liedhaften Momente und ihren von Yuval Zorn besonders drastisch geformten Eruptionen: Wirklich hinter sich lassen kann man danach die Wand im Bockenheimer Depot mit den 2000 Flugblättern keinesfalls.
|
|
Es überleben die Ideen Kritik von Andreas Schubert Manchmal ist die Stille so laut, dass man sie nicht zu durchbrechen wagt. Ganz verhalten nur beginnt der Applaus. Ein paar Hände regen sich im nicht ganz ausverkauften Bockenheimer Depot, dann ein paar mehr. Auch zwei, drei Bravorufe sind später zu vernehmen. Doch zur vollen Stärke, zu einer Intensität, die jener der soeben erlebten Aufführung gerecht werden würde, vermag sich der Beifall nicht emporzuschwingen nach dieser Premiere. Das ist durchaus als Kompliment zu verstehen. Christoph Quest, der mit Zimmermanns ‘Weiße Rose’ als Opernregisseur debütierte, hatte in seiner hochkonzentrierten Inszenierung so viele eindringliche Augenblicke erzeugt, die Zuschauer emotional so tief in das innere Geschehen auf der Bühne verstrickt, dass man sich danach unmöglich in irgend einer Weise lautstark hätte äußern können. Entsprechend der geistig-immateriellen Handlung – in der letzten Stunde vor ihrer Hinrichtung setzten sich die Geschwister Scholl mit ihren Ängsten, Erinnerungen und Hoffnungen auseinander – reduziert Quest das Bühnenbild (Kaspar Glarner) konsequent auf einen hellen, nur mit drei Stühlen ausgestatteten Kubus, und fokussiert so die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die sich in vorwiegend geistigen Räumen bewegenden Charaktere. Deren Zahl allerdings erhöht sich von zwei auf drei, indem Quest zusätzlich zu den in Zimmermanns Partitur vorgesehenen Protagonisten Hans und Sophie Christoph Probst auftreten lässt, der mit den Scholls zusammengearbeitet hatte und ebenfalls am 22. Februar 1943 hingerichtet wurde. Diese dritte, als stumme Rolle angelegte (und von Dominic Betz ausdrucksstark gespielte) Figur schafft nicht nur durch ihre bloße Präsenz eine größere szenische Plastizität, sondern ihr kommt die bedeutende Aufgabe zu, jenes äußere Geschehen pantomimisch zu abstrahieren, dem die Geschwister in ihren Monologen weitgehend entzogen scheinen. Doch auch auf rein menschlicher Ebene stärkt die symbolträchtige Dreizahl das ohnehin schon dichte dramaturgische Gefüge, etwa wenn sich gegen Ende alle für einen Moment in den Armen liegen (ein kurzes Wiedersehen vor der Hinrichtung ist historisch verbürgt), letzte Berührungen stattfinden, ein letztes Lächeln, ja sogar ein Humorbruchteil die Gesichter streift. Am Schluss überleben die Ideen. In der letzte Szene der Oper lässt Quest die Todgeweihten bezeichnenderweise noch einmal das tun, was ihnen zum Verhängnis wurde: schreiben. Ihren Appell gegen das Schweigen schreiben sie nieder, auf dass die Botschaft überdauere, während aus Lautsprechern ihre Worte erklingen, erst einzeln, dann sich überlagernd und konstant anschwellend zu einer gewaltigen Polyphonie, eben jenem ‘tausendfachen Schrei’, der von Sophie gegen den Wahnsinn angerufen wird. Dann senkt sich der Vorhang, ein großes schwarzes Fallbeil, über den Mutigen. Dass das anspruchsvolle Stück eine fast schon paralysierende Wirkung entfalten konnte, war aber – ohne Quests Leistung auch nur im Mindesten schmälern zu wollen – nicht in erster Linie auf die Inszenierung, sondern die hervorragenden musikalischen Leistungen des Abends zurückzuführen. Yuval Zorn leitete das exzellente, aus fünfzehn Mitgliedern des Frankfurter Museumsorchesters bestehende Instrumentalensemble weitsichtig und mit präzisem Schlag durch die komplexe, Zwölftontechnik und traditionelle Anklänge vereinende Partitur und erreichte so eine beeindruckende Ausleuchtung aller ihrer Facetten. Noch ergreifender gelangen jedoch die vokalen Psychogramme, die Michael Nagy und Britta Stallmeister von Hans und Sophie Scholl zeichneten. Beide Sänger zeigten sich den hohen stimmlichen und gestalterischen Anforderungen der Partien vollends gewachsen, meisterten weite, nicht immer eingängige Intervallfolgen technisch ebenso souverän wie den ständigen Wechsel zwischen Sprechen und Singen. Nagy verfügt über einen wohlgeformten, klangschönen Bariton mit überraschend reifen Zwischentönen und enormem Potenzial in der Höhe, was sich an diesem Abend besonders auszahlen sollte (nicht ohne Grund wird Hans auch öfter von Tenören gesungen). Stallmeisters leichter Sopran vereint mädchenhaftes Timbre, das sich in Sophies Naturlyrismen ätherisch verströmt, mit der seltenen Fähigkeit, auch die exponiertesten Passagen (etwa in der ersten Szene) in ein filigranes, perfekt fokussiertes pianissimo zurückzunehmen. Besser kann man ‘Weiße Rose’ im Grunde nicht besetzten. So darf man nach 75 Minuten alle Fasern durchdringenden Musiktheaters nachdrücklich feststellen: eine Aufführung, die man erlebt haben muss. |