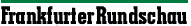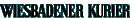|
|
"Herzog Blaubarts Burg" VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Quasi ein Heimkehrer: In Frankfurt begann einst Christoph von Dohnányis Dirigentenlaufbahn (als Assistent von Georg Solti), in Frankfurt hatte er dann von 1969 bis 1978 eine erfolgreiche Operndirektorenzeit. Nach langer internationaler Karriere kam der fast Achtzigjährige nun einmal wieder als Gast in die Mainmetropole und brachte in der Alten Oper - zusammen mit dem NDR-Sinfonieorchester, das er seit 2004 leitet - ein anspruchsvolles Programm. In dessen Mittelpunkt stand die konzertante Aufführung der Oper "Herzog Blaubarts Burg" von Béla Bartók (auf Ungarisch). Dieses Werk fasziniert stets aufs neue durch seine Mehrdimensionalität: als Dokument des historischen Sprungs von neuromantischen zu expressionistischen Orientierungen, als Musik in der Spannung zwischen scheinbar ungebremsten Ausdrucksgegensätzen und äußerst reflektiertem Umgang mit dem Tonmaterial. Die altertümelnd-folkloristische Grundierung von Bartóks avancierter künstlerischer Haltung betonte Dohnányis Interpretation auch dadurch, dass sie den meist gestrichenen Prolog mit einbrachte, eine (von Károly Mécs) gesprochene Anrede ans Publikum, dramaturgisch ein ähnlich naiv-eindringlicher Zeigefinger auf die Handlung wie der "Pagliacci"-Prolog. Zu den letzten Worten des Vorspruchs setzte schon die Musik ein mit ihrem geisterhaft leisen Streicher-Unisono. Der immense spieltechnische Standard des Orchesters, das spätestens seit Günter Wand zu den allerbesten Deutschlands gehört, zeigte sich bereits in der dynamischen Nuancierungsfähigkeit mit den Extremen eines fast unhörbaren Pianissimo und berstender Klangentladungen in den Mittel- und Schlussphasen. Die Musik spricht Immer wurde dabei jedoch der "sprechende" Charakter der Musik hervorgehoben. So war es selbstverständlich, dass vom Pult her nicht nur die breite Palette der instrumentalen Klangfarben vermittelt, sondern vor allem der sängerischen Sekundanz liebevoll-aufmerksam gedient wurde; die Mezzosopranistin Yvonne Naef war eine vehemente, merklich vom dramatischen Impetus berührte Judith, Matthias Goerne ein in seiner finster-autoritativen Baritondiktion idealer Blaubart. Beide Opernfiguren haben im Stück eine gemeinsam-gegenläufige "Geschichte": Anhand der Metapher der sieben geheimnisvollen Türen beschreitet Judith den Weg von der Erwartung zur Desillusionierung, und Blaubart erlebt die erotische Situation als stets erneuerte Qual der "ewigen Wiederkehr". Mit seiner ungarischen Tönung verwies das Konzert diskret auf die Herkunft der Familie Dohnányi. Haydns Symphonien entstanden sozusagen aus dem magyarischen Humus; die Nr. 64 in A-Dur (mit dem Untertitel "Tempora mutantur") markiert das Gärend-Experimentelle des mitten in seiner Entwicklung begriffenen Haydn'schen Großprojekts. Die Wiedergabe gelang ebenso entspannt wie sorgfältig, mit Gusto für die feineren wie für die gröberen (Menuett-Hauptteil) Passagen dieses schon recht "reif" anmutenden, aber kaum je gespielten Werkes. Dessen blitzhaft hervortretendes, genialstes Detail vielleicht das Ende des langsamen Satzes ist: eine harmonisch bedeutsame, mit Feingefühl (Horn!) instrumentierte Schlussgeste. [ document info ] Dokument erstellt am 11.02.2008 um 16:48:02 Uhr Letzte Änderung am 11.02.2008 um 16:59:42 Uhr Erscheinungsdatum 12.02.2008 |
|
|
Jede Tür ein Geheimnis Im nächsten Jahr wird der Mann, der in Frankfurt lange Jahre Operndirektor war, 80. Und er ist dynamisch wie für mindestens 20 Jahre jünger (so was macht die Musik). Er hat eine Haydn-Sinfonie zu Beginn dirigiert, die den tiefgreifenden Titel „Tempora mutantur" trägt. Wie weise. Aber wie schön auch, wie Dohnányi das macht, mit Geist, mit Sanftheit, mit Grazie, auch mit der Lust an den Gegensätzen. Es wirkt, als wolle (und könne) er mit seiner Art des Musikmachens hypnotisieren. Natürlich nicht ohne das feinfühlige Orchester. „Herzog Blaubarts Burg" von Béla Bartók ist konzertant aufgeführt worden, aber das weckt alle Bilder, die man sich dazu nur vorstellen kann. Es ist ja ein Liebesdrama, und es eskaliert mit jedem Bild, das heißt: mit jeder Tür, die in dieser Burg geöffnet wird. Die Aufführung haben die wunderbare, ausdrucksstarke Yvonne Naef (die sogar auch ein bisschen mit den Farben ihres Gewands spielt) und der feine Bariton Matthias Goerne zubereitet – nur hat die Dame Judith zwar nicht die Macht, aber gegenüber dem Herzog Blaubart die stärkere Partie. Es ist vorzüglich gelungen, diese imaginäre Oper in Ausdruckskraft zu fassen. Donányi hat es geschafft, mit dem Orchester diese poetische, aber auch schaurige Szenerie klanglich entstehen zu lassen. (GN) |
|
|
Die Frauen-Bewegung fällt aus Von Volker Milch FRANKFURT Blaubart in Frankfurt: Viele Opernfreunde werden sich da an Herbert Wernickes geniale Doppel-Inszenierung von Béla Bartóks Einakter erinnern. "Herzog Blaubarts Burg" gab es 1994 zwei Mal an einem Abend, die Wiederholung als Rückspiel mit Perspektivenwechsel. Nun stand Frankfurt wieder im Zeichen einer Blaubart-Verdopplung, allerdings etwas anderer Art: In der Alten Oper erklang unter Christoph von Dohnányis Leitung Bartóks Einakter als konzertante Aufführung mit hochkarätiger Besetzung (Yvonne Naef und Matthias Goerne), während sich das Opernhaus selbst der 1907 uraufgeführten, hierzulande selten zu erlebenden Blaubart-Version von Paul Dukas widmete: "Ariane et Barbe-Bleue". Die Frauen-Bewegung ist in Sandra Leupolds Inszenierung dieser Rarität eine ziemlich statische, oft regelrecht konzertante Angelegenheit. Das liegt freilich auch an der Struktur des Werks: Der Lichtgestalt Ariane gelingt es nämlich trotz ausdauernden Monologisierens nicht, Blaubarts Bräute aus ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit hinauszuführen. Sie verlässt also alleine die Burg, während die übrigen Damen, die Namen aus früheren Dramen des Librettisten Maeterlinck tragen, ihre masochistischen Neigungen pflegen und den verletzten Peiniger nicht im Stich lassen wollen. Sélysette, Mélisande, Ygraine, Bellangère und Alladine steigen in Frankfurt schließlich zurück in eine Eiswand gefrorener Gefühle und nehmen ihre Posen ein - die Frauen-Bewegung auf breiter Front fällt aus. Sandra Leupold hat mit ihrem Bühnenbildner Dirk Becker diese Eiswand als sehr einprägsames visuelles Leitmotiv exponiert: transparente Planen, an denen die Sängerinnen wie in einer Kletterwand hängen - und übrigens auch Blaubart selbst als Gefangener seiner selbst. Er hat bei Dukas nur 27 Takte zu singen, den vokalen Löwenanteil muss Ariane selbst bewältigen. Mit dieser gewaltigen Partie hat sich einst die von Claude Debussy als Mélisande verschmähte Muse Maeterlincks, Georgette Leblanc, Genugtuung für die erlittene Schmach verschafft und die Emanzipation zumindest auf musikalischer Ebene radikal vollzogen. Die Mezzosopranistin Katarina Karnéus bringt in Frankfurt für diese nun wirklich tragende Rolle eindrucksvolles Format mit, gleichermaßen Kraft und Sensibilität vermittelnd. Über intensiven Applaus darf sich auch die für Elzbieta Ardam eingesprungene Julia Juon als Amme freuen, und Dietrich Volle stellt sich der geballten Weiblichkeit seiner Bräute-Sammlung mit männlich-markantem Bariton entgegen. Während Claus Guth in Zürich das Geschehen 2005 als Vorstadt-Grauen im Reihenhaus herangezoomt hat, spielt es in Frankfurt in einem weiten, abstrakten Seelen-Raum, in dem Arianes weißes Brautkleid (Kostüme: Eva-Mareike Uhlig) wie ein naiver Mädchentraum aufscheint. Dieser Mädchentraum ist eine Zwangsjacke: Ariana wird das Brautkleid ablegen und Blaubart in die Hand drücken. Sandra Leupold, die in Wiesbaden 2007 "Tosca" inszeniert hat, setzt in "Ariane et Barbe-Bleue" auf ganz reduzierte Bewegungen, die Dukas´ klingende Jahrhundertwende-Seelenkunst eher als inneres denn als äußeres Drama erfahrbar werden lassen. In ihm gibt es viel Raum für grandiose sinfonische Klangentfaltung der farbenreichen Partitur, deren Reize Generalmusikdirektor Paolo Carignani ins rechte Licht rückt. Bereits die düstere, auch szenisch suggestive Chorszene des Anfangs zeigt, dass sich diese Blaubart-Ausgrabung unbedingt gelohnt hat. |
|