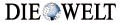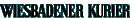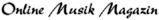|
"Billy Budd" VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Ob es die Personifikation des absolut Guten oder Bösen tatsächlich gibt? Herman Melvilles berühmte Erzählung "Billy Budd Foretopman" verlegt sich nicht unbedingt auf die schlüssige Beantwortung dieser Frage. Melville schafft indes eine Versuchsanordnung, bei der ein liebenswerter und harmloser junger Mann in einem älteren Vorgesetzten tödlichen Hass und Vernichtungswillen provoziert. Billy Budd ist das pessimistische Gegenbild zu Parsifal. Gerade kraft seiner Reinheit und Unschuld treibt er das Böse hervor, als bedürfe dieses des besonderen Anreizes durch sein pures Gegenteil. Das Gute wird dem Bösen zum Todfeind, das Schöne dem Hässlichen. Ort dieser Lehrgeschichte (die Benjamin Britten, Aufklärer und in jungen Jahren Kommunist, 1951 zu einer spannenden Oper verarbeitete) ist ein Kriegsschiff. Dessen Besatzung, eine geschlossene Gesellschaft, zudem strengen militärischen Reglements unterworfen, ist dazu angehalten, alle "zivilen" Gefühle zu unterdrücken. Zur Metapher für den verhängnisvollen kollektiven Trieb-stau wird (zu Beginn des 2. Opernakts) die vergebliche Vorbereitung auf eine Seeschlacht, die dann infolge Nebels wieder ausfällt und auf eine unbekannte Zukunft verschoben werden muss - die mit aller erigierenden Macht vorbereitete und in Stellung gebrachte Kampfmaschinerie darf keine Entladung finden. In dieser Situation wird der neu aufs Schiff gekommene Matrose Billy Budd zum Opfer einer teuflischen Intrige. Der düstere Waffenmeister Claggart zettelt sie an, kommt dabei aber überraschend auch selbst zu Tode. Kapitän Vere, der Claggart durchschaut, rettet Budd nicht vor der Hinrichtung - die er unter dem Bann des harten Kriegsrechts akzeptiert, aber wohl auch, um einer als unehrenhaft empfundenen Faszination durch den Jüngling zu entkommen. Das Wissen, dass er Budd gleichwohl auch hätte retten können, bleibt ihm lebenslang. Richard Jones, der Regisseur der Frankfurter "Billy Budd"-Inszenierung, thematisiert den homoerotischen Hintergrund des Sujets viel weniger auffällig als manche anderen Interpreten, und solche Diskretion hat ihre Meriten. Sie lenkt davon ab, die Oper als dezidiertes Kultstück einer Minderheit in Erscheinung treten zu lassen, und damit verstärkt sich der Eindruck einer allgemeinmenschlichen Tragik. Obgleich Britten in seinen Opern homosexuelle "concetti" nachdrücklich verfolgte, sind seine humanistischen Intentionen darauf nicht eingrenzbar. Virtuosität und Drastik findet Jones' Optik vor allem in der Zeichnung der seemännischen Militarisierung, die hier bis ins Bizarre hinein reicht. Etwa bei den Schlachtpräliminarien, ihren zugleich akribischen wie verschusselt-ineffektiv ins Werk gesetzten Verrichtungen mit allerlei kanonen- und feuerwehrmäßigem Maschinenkram, einem grotesken Gewusel zwischen Kriegspiel und Ernstfall. Oder auch bei der Bestattungszeremonie für Claggart (fast zeitgleich zum Tod Billys am Strick), wo die Mannschaften im Geschwindmarsch am fahnendrapierten Sarg vorbeiflitzen und pflichtschuldig-eilig ihre Mützen vom Kopf reißen. Scheinbar gewährte das Bühnenbild von Antony McDonald minuziösen Realismus, etwa den Längsschnitt durch den unteren Teil eines Schiffes. Doch den Hauptschauplatz bildete kein Oberdeck mit dem Meer als Hintergrund, vielmehr ein Turn- oder Trainingssaal, wo sich immer wieder Gruppen in hochleistungsförmigen Übungen betätigten. Beschränkung aufs Interieur (durchaus auch kontrastiv zu einer Musik mit viel "Ambiente", sozusagen mit hohem maritimen Salzwassergehalt) verstärkte das Explosive der unterm Deckel gehaltenen Männerleidenschaften. "Billy Budd", eine riesig besetzte Männeroper. Eine Herausforderung für die Theaterkapazitäten. Mit dieser eminent gelungenen Produktion kann sich Frankfurt an die Seite ganz großer Opernhäuser wie München und Wien stellen und auch musikalisch bestehen. Kraftvoll, intensiv und differenziert die von Alessandro Zuppardo einstudierten verstärkten Chorformationen. Erstrangig die sängerdarstellerische Realisierung der drei Hauptrollen: Clive Bayley war ein finster timbrierter Claggart, präzis angelegt auch mit konzentrierter Körpersprache und einem (erstaunlicherweise zivilen) Outfit, das die Unauffälligkeit (um nicht zu sagen: die Banalität) des Bösen vermittelte. Einnehmend als Verkörperung unbeschwerter Jungenhaftigkeit der Billy Budd von Peter Mattei, der mit seinem lyrischen Vermögen erst im ausgedehnten Schlussgesang (in einem Spind wie in einem aufrecht stehenden Sarg) zur Geltung kommt. Nicht minder vehement die Charaktertenor-Diktion des Vere von John Mark Ainsley, dessen Erzählung als alter Mann die Oper rahmt (er beschließt sie ungewöhnlich mit einer unbegleiteten Vokalmelodie). In Frankfurt wurde die zweite Fassung von 1964 präsentiert. Sie enthält nur einige Minuten weniger Musik als die ursprüngliche, und ihr entscheidendes Merkmal ist ein neuer, bruchloser Szenenübergang im 1. Akt. Das zu den aufwändigsten Britten-Opern zählende Werk geht auch mit der Zeit großzügig um. Eine der zentralen Musik-Episoden ist das Orchesterzwischenspiel vor Budds großem Monolog. Es besteht aus einer rätselhaften Aneinanderreihung fremdartig-unverbundener Dreiklangsäulen in ungemischten, gleichsam "reinen" Orchesterklängen. Vielleicht typisch für eine Schreibweise, die sich von spätromantischem Raffinement entfernt, ohne tonale Bindungen ganz aufzugeben. Die Tonsprache wirkt kantabel, manchmal volksliednah, aber polytonal aufgespreizt; oft scheinen die Melodiefloskeln sich vom Untergrund zu lösen und in einem freien Tonraum zu vagieren. So verweist die Musik auch - hoffnungsvoll, utopisch - auf Dimensionen jenseits der Handlung. Mit dem wunderbar zum Sprechen und Singen gebrachten Museumsorchester gelang Paul Daniel eine überragende, zu Herzen gehende, in Transparenz und Grandeur ausgeformte Darstellung dieser Partitur, die zu den Höhepunkten der Opernkunst des vergangenen Jahrhunderts gehört. [ document info ] Dokument erstellt am 19.11.2007 um 16:28:01 Uhr Letzte Änderung am 19.11.2007 um 16:38:45 Uhr Erscheinungsdatum 20.11.2007 |
|
Brittens „Billy Budd" in Frankfurt Der alte Mann kommt aus seiner Kajüte, hält sich an der Reling fest und tastet sich mit unsicheren Schritten langsam die Treppe hinunter. Auf halbem Weg zum Hauptdeck, nach einer Ewigkeit, setzt die Musik ein: Streicher, die sich kontrapunktisch ineinander verhaken, wehmütige Erinnerungsklänge, die die brüchigen Kantilenen von Kapitän Edward Fairfax Vere atmosphärisch untermalen, der auf seinem offenbar von Gott und der gesamten Mannschaft verlassenen Schiff gramgebeugt umherblickt. Es ist eine dieser archetypischen Szenen, aus denen der Betrachter unschwer auf die Art der Geschichte schließen kann, die sich gleich als Rückblende ereignen wird. Die epische Breite und die Tragik des Geschehens hat Benjamin Britten in den Prolog seiner Oper „Billy Budd" nach einer Erzählung von Herman Melville unauflöslich eingewoben. Man muss sich auf etwas gefasst machen, und man weiß, dass die Sache nicht gut ausgehen wird. So sind Augen und Ohren frei, sich auf das zu konzentrieren, was den zugrundeliegenden Konflikt ausgelöst hat, vor allem aber: wie es dem Komponisten gelingt, mit musikalischen Mitteln das Geschehen sinnfällig erscheinen zu lassen.
Mehr als der Kampf Gut gegen Böse Aber sind Augen und Ohren bei Benjamin Britten wirklich frei? Gibt es da nicht einen Unterton, der dem Geschehen einen mysteriösen Gestus verleiht, dem Betrachter das Gefühl gibt, etwas nicht ganz mitbekommen zu haben? In den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen England und Frankreich leistet der bei seinen Kameraden überaus beliebte Billy Budd 1797 als zwangsrekrutierter Vortoppmann seinen Dienst auf der „Indomitable", wird aber zum Tod durch den Strang verurteilt, weil er im Affekt den Waffenmeister John Claggart erschlagen hat, der ihn grundlos der Meuterei bezichtigte. Kapitän Vere, ein Schöngeist hinter der Fassade des strengen Vorgesetzten, hätte den unschuldig Verurteilten retten können, wenn er sich über das Kriegsgericht hinweggesetzt hätte. Das lässt sich als tragischer Konflikt zwischen dem Buchstaben des Gesetzes und den Forderungen nach Gerechtigkeit inszenieren, auch als immerwährende Konfrontation zwischen Gut und Böse, als Verkettung unglücklicher Umstände, die den stotternden Billy Budd dazu zwingen, sich - wenn nicht mit Worten, dann eben mit Taten - zur Wehr zu setzen. Selbst als Antikriegsstück, als Polarisierung zwischen den Errungenschaften der Französischen Revolution und monarchischer Restauration ginge „Billy Budd" durch. Aber wesentliche psychologische Ingredienzien würden bei solchen Interpretationen fehlen: Überkompensation, Verdrängung, Schuldkomplexe. Denn Kapitän Vere kann sich keine öffentliche Großmut erlauben, ohne sich dem begründeten Verdacht verbotener Zuneigung zu Billy Budd auszusetzen. Waffenmeister John Claggart hat ähnliche erotische Gefühle längst in Aggression gegen seine Untergebenen verwandelt. Die psychischen und physischen Schäden, die er Billy Budd und der ganzen Mannschaft der „Indomitable" zufügt, sind Ausdruck eigener seelischer Verletzung. So ist „Billy Budd", ähnlich wie „Peter Grimes", eine versteckte Darstellung psychischer Konflikte, die Benjamin Britten selbst sehr genau kannte. Zu seiner Zeit war es nicht ganz so leicht, sich mit dem Satz „Ich bin schwul, und das ist gut so" öffentlich zu bekennen.
Hinter der Mechanik der Ereignisse In Frankfurt nun hat das britische Team, bestehend aus dem Regisseur Richard Jones, dem Bühnenbildner Antony MacDonald und dem Dirigenten Paul Daniels, bei seiner Inszenierung von Benjamin Brittens „Billy Budd" in der zweiaktigen Version des Komponisten stets durchschimmern lassen, dass hinter der Mechanik der Ereignisse individuelle psychische Konflikte lauern. Nicht die vordergründige Handlung, die das Leben an Bord der „Indomitable" als aberwitzigen Kadettendrillplatz vorstellt, führt ins Zentrum des musikalischen Dramas, vielmehr die Haltungen der Protagonisten, ihre merkwürdigen Verklemmungen und zögernden Aktionen, die kleinen Handbewegungen, die die Zärtlichkeiten eher zurückhalten als ausspielen, die kleinen höflichen Übertreibungen, die nur mühsam die Aggressionen verbergen. Richard Jones konnte ganz auf die Magie der Musik vertrauen, die in epischen symphonischen Zwischenspielen, vom Frankfurter Museumsorchester souverän gestaltet, etwas Lauerndes bekommt und in den Arien geradezu in Schubertscher Manier die Gefühle der Sänger zu stützen vermag. Das größte Lob gebührte neben den fabelhaften Chören den drei Hauptakteuren, die die Gratwanderung zwischen äußerer Aktion und innerer Befindlichkeit grandios gemeistert haben. Peter Mattei mit seinem berückenden Bariton in der Titelrolle schien allein den Beweis antreten zu wollen, dass es seit dem elisabethanischen Zeitalter keinen Komponisten in England gegeben hat, der so wie Benjamin Britten ausdrucksstarke, der Prosodie der Dichtung wie dem logischen Sprachrhythmus gleichermaßen angemessene Melodien zu schreiben vermochte. Und Clive Bayley hätte mit seinem bis in die tiefsten Lagen wohlgeformten Bass als John Claggart wohl jeden Rekruten ebenso von seinem hintertriebenen Charakter ablenken können wie John Mark Ainsley mit strahlend-selbstsicherem Tenortimbre von den Zerreißproben in seiner Brust. Ein großer musikalischer Wurf ist der Oper Frankfurt da gelungen, der auch auf die nächste Britten-Premiere der Spielzeit neugierig macht. WOLFGANG SANDNER Text: F.A.Z., 20.11.2007, Nr. 270 / Seite 35 |
|
Knabeninternat auf dem Kanonenboot Von Uwe Wittstock Die Oper "Billy Budd" spielt unter englischen Seeleuten während der Napoleonischen Kriege. Die meisten von ihnen sind, offen gestanden, recht schlichte Naturen. Doch Herman Melville, von dem die Romanvorlage zu Benjamin Brittens Musikwerk stammt, hat die Figuren zu mythischen Größen überhöht. Der "hübsche Matrose" Billy Budd spielt die Rolle des Guten schlechthin, des edlen Mannes, dem die Herzen seiner Mitmatrosen zufliegen - und der schließlich für König, Vaterland und den Kapitän seines Schiffes sogar die Zustimmung zur eigenen Hinrichtung gibt. Der Gegenspieler ist der Waffenmeister John Claggart, das Böse in Person, der Teufel in Menschengestalt, der nur eines im Sinn hat: Das Gute, also Billy Budd, das ihm fern und unerreichbar ist, zu vernichten - und der dieses Ziel auch um den Preis der eigenen Vernichtung erreicht. Je nach Geschmack und Inszenierung kann man in all dem monumentalen Kitsch sehen oder ein Beispiel für den ewigen Kampf zwischen Liebe und Hass, Hell und Dunkel, Ying und Yang - oder was derlei holzschnittartige Begriffspaarungen mehr sind. Der englische Regisseur Richard Jones hat jetzt in Frankfurt am Main aus dem Schauplatz der Oper eine etwas halbherzige Mixtur aus Kanonenboot und Knabeninternat gemacht. Die Messe des Schlachtschiffes mutet bei ihm an wie eine Turnhalle, und den von Britten brünstig erregend vertonten Angriff auf ein feindliches französisches Schiff führt er vor als eine Art Wehrsportübung. Jones gibt dem unübersehbar homoerotischen Aspekt der Oper so eine aktuellere, umfassendere Bedeutung: Wenn die Offiziere von der Brücke herab den nackten Matrosen bei der Körperpflege zuschauen - um Hofmannsthal zu variieren: Manche freilich müssen drunten duschen - beschleicht einen der Gedanke, dass es nicht in allen Internaten zwischen Lehrern und Schülern sexuell so harmlos zugehen mag wie in Harry Potters Hogwarts. Auch ansonsten ist der Frankfurter "Billy Budd" größtenteils fest in britischer, oder zumindest angelsächsischer Hand. Das Bühnenbild stammt von Antony McDonald, Paul Daniel dirigiert mit viel Sinn für die dramatischen Effekte der Musik Brittens, John Mark Ainsley singt den wenig weisen Kapitän Vere, Simon Bailey und Nathaniel Webster zwei Offiziere und Clive Bayley den Dunkelmann Claggart, den er wunderbar wie einen verkrampften, von Hass verzehrten, heimtückischen Eckensteher spielt, ganz nach dem Modell Gollums aus Tolkiens Opus "Herr der Ringe". Überstrahlt aber wird all das vom mächtigen Bariton des Schweden Peter Mattei, der seinen Billy Budd sehr glaubhaft verkörpert wie einen übermütig lebensfrohen Hans im Glück, der am Schluss sogar sein Leben forttauscht gegen ein Seemannsgrab, nur weil man ihm sagt, er würde damit ein glänzendes Geschäft zugunsten von König und Kapitän machen. |
|
Echte Kerle auf See Von Axel Zibulski
FRANKFURT Reichlich Testosteron hat die "Indomitable" an Bord: Drill und Schweiß gehören ebenso zum Alltag auf dem englischen Kriegsschiff wie der Hass auf den "Franzmann". Unter sich scheint man sich freilich einig: Hier gibt es sie noch, die wahren, echten Männerfreundschaften. Im Jahr 1797 spielt Benjamin Brittens Oper "Billy Budd" nach einer Erzählung von Herman Melville; es geht um einen jungen Matrosen von eher schmalem Intellekt, dem selbst die Zwangsrekrutierung nicht die gute Laune und das naive Gemüt nehmen konnte. Und doch wird Billy Budd Unrecht widerfahren, darin ist er eine typische Figur Brittens. Die Neuinszenierung von Richard Jones zeigt das alles in einer durchweg realistischen Erzählweise. Im Zentrum der Bühne von Anthony McDonald ist der Innenraum eines Schiffs zu sehen, in dem das ausschließlich männliche Personal der Oper ebenso zu Liegestützen wie zum Angriff auf den französischen Gegner aufläuft. Betten, Spinde und Duschen links, rechts das Kapitänszimmer. Hier kommt es zur zentralen Szene: Billy Budd erschlägt jenen Waffenmeister Claggart, der ihn zu Unrecht der Meuterei verdächtigt. Schuld und Unschuld, Gut und Böse lassen sich in Brittens Opern kaum trennen. Dabei bieten es Benjamin Britten und seine Librettisten doch eigentlich an, den Blick stärker auf die Konflikte als aufs nautische Kolorit zu lenken. Denn erzählt wird die Geschichte aus der Erinnerung des Kapitäns Vere, der im Prolog und im Epilog als alter Mann auftritt: Eine abstrakte, aber auch eine bedrohlich surreale Darstellung lägen also möglicherweise näher; hier jedoch wirkt dieser Rahmen merkwürdig aufgestülpt, wenn der alte Vere im grauen Mantel durch die reale Szenerie geistert. Dass der Tenor John Mark Ainsley ihn mit enorm zwischentonreicher Leuchtkraft gibt, gehört zu den zahlreichen positiven Eindrücken von der musikalischen Seite dieser Neuproduktion. Auch die Titelpartie ist mit dem Bariton Peter Mattei fabelhaft besetzt, der bei aller das Jugendlich-Naive beglaubigenden Kraft stets kultiviert singt. Als sein Gegenspieler Claggart lässt es Clive Bayleys Bass an Eleganz nicht fehlen, die ihn umso mehr als Intriganten glaubhaft erscheinen lässt, auch wenn die Regie seinen Mobbing-Motiven (homoerotische Gefühle gegenüber Budd?) nicht auf den Grund geht. In der Spitze, aber auch in der Breite ist dieser Frankfurter "Billy Budd" vokal auf ganz überwiegend hohem Niveau besetzt. In solchen Produktionen zahlt sich Frankfurts solider Ensemble-Aufbau der vergangenen Jahre besonders aus, weil die zahlreichen Partien vom Maat bis zum Admiral charakteristisch besetzt sind. Auch die Chöre sowie das Museumsorchester unter der Leitung von Gast-Dirigent Paul Daniel finden zu großer, packender Form. So mag es fürs Auge viel zu sehen geben. Aber letztlich gewinnt das Ohr. |
|
Tödlich endet die Intrige Von Andreas Bomba Man mag kaum glauben, dass Brittens stürmische, leidenschaftliche Oper „Billy Budd" überhaupt zum ersten Mal in Frankfurt gezeigt wird. Das 1951 entstandene, 1964 auf zwei Akte komprimierte Stück führt (nach einer Erzählung von Hermann Melville) die zeitlose Denunziations-Dynamik einer zwangsweise geschlossenen Gesellschaft vor und verbindet sie mit der schreienden Ungerechtigkeit, die das sture Befolgen von Gesetzen zur Folge haben kann. Nur eine historische Folie ist der englische Seekrieg gegen Napoleon, das Jahr 1797. Billy Budd, passionierter Seemann, wird für die Fregatte „Indomitable" zwangsrekrutiert. Mit Lebenslust und aufrichtigem Ehrgeiz gewinnt er rasch die Sympathien der Mannschaft. Dem intriganten Waffenmeister John Claggart gelingt es mit Hilfe sadistischer Bösartigkeit jedoch, den tatendurstigen und von Menschenrechten träumenden Matrosen vor Edward Fairfax Vere, dem Kapitän, der Meuterei zu bezichtigen. Budd bringt im Verhör, weil er stottert, kein Wort zu seiner Verteidigung heraus; voll ohnmächtiger Wut erschlägt er deshalb seinen Peiniger. Die Folge, Tod durch Hängen, ist rasch herbeigeurteilt. Dass sowohl Vere wie Claggart Billy Budd eigentlich mögen, ja ihn heimlich lieben, eine Folge der homoerotischen Fantasien einer reinen Männergesellschaft, ist Richard Jones, dem Regisseur der Frankfurter Neuproduktion wichtig zu zeigen. Bedrückend, wie Claggart sich durch den Hass gegen das Schöne und das Gute zur Zerstörung Budds getrieben fühlt; Vere dagegen ist ein feiger Schöngeist, der Plutarch liest und in der Bibliothek zum Wein empfängt – an einem Ort, an dem unmenschlicher Drill herrscht, gefährliche Langeweile und von knüppelschwingenden Aufsehern erzwungene Zucht und Ordnung. Das alles geschieht in einer Art Turnhalle mit Foltergeräten der Leibesertüchtigung. Nebenräume gewinnt die Bühne (Anthony McDonald) geschickt durch Verschieben – rechts wird das Kapitänszimmer sichtbar, links der Schlafsaal der Mannschaft mit Doppelstockbetten und kargen Spinden. Befeuert durch die stark an der Sprache orientierte Musik spart die Darstellung nichts an Drastik, bis hin zum Hängen Budds, perfekt und spannend, wie im Film. Musikalisch ist die Aufführung Weltklasse. Der vielbeschäftigte Chor (Alessandro Zuppardo) muss marschieren, exerzieren, kondolieren (Choreografie: Lucy Burge) und Shantys singen und zu Beginn des zweiten Aktes turbulent eine Schlacht vorbereiten – wild und schön im Klang, präzise in Rhythmus und Intonation. Das von Paul Daniel geleitete Museumsorchester spielt äußerst konzentriert, von den heiklen Streicher- und Bläsertönen zu Beginn bis zu den bizarr gereihten Akkorden, die die suggestivste, bedrückendste Szene des Abends einleiten: den Klagemonolog Budds im beengten Spindgefängnis. Brittens Orchestermusik charakterisiert nicht nur in klanglich und motivisch stupender Vielfalt und unendlichem Einfallsreichtum die Personen, sondern umgibt, so scheint es, die Oper mit dem Meer. Peter Mattei trifft Budd perfekt als jugendlichen Draufgänger mit plötzlich existenzieller Tiefe im Nachdenken, Träumen und Leiden, John Mark Ainsleys heller Tenor versetzt Kapitän Vere in ein weites Spektrum zwischen schneidiger Selbstsicherheit und hysterischer, als Flucht empfundener Rechthaberei; die auch im Alter nicht nachlässt – das Stück spielt in Form einer Rückblende auf eine Episode aus Veres Leben. Clive Bayley gibt den Claggart als zynisch-schwarzen Alberich-Typ. Dazu (neben einem weiteren Dutzend Gästen und Ensemble-Mitgliedern) Altmeister Carlos Krause als Dansker – der einzige, der hier als Mensch, das heißt in Zivil auftreten darf. Insgesamt ein atemberaubend spannender, hinreißender Abend, vielleicht der bisher beste unter Bernd Loebes (an wunderbaren Produktionen nicht armer) Intendanten-Ägide. |
|
Mörderische Männer-Gesellschaft Ein beklemmender Psychokrimi, eine klassische Tragödie, bei der am Ende zwei Tote und viele seelisch Beschädigte zurückbleiben. Benjamin Brittens "Billy Budd" geht in der Neuinszenierung an der Oper Frankfurt an die Nieren. Weil Richard Jones’ Regie nicht nur den dramatischen Knoten konsequent schürzt, sondern psychologische Befunde erstellt. Unterstützt von Brittens düsterer Musik, die gnadenlos in seelische Tiefen leuchtet: Dirigent Paul Daniel und das Frankfurter Museumsorchester liefern ein packendes klangliches Szenario. Jones versetzt Herman Melvilles Erzählung aus dem englisch-französischen Seekrieg von 1797 in die Entstehungszeit der Oper, deren erste Fassung 1951 in London uraufgeführt wurde. In Frankfurt ist eine spätere zweiaktige Version zu erleben. Im Mittelpunkt stehen die Tragödien einer hermetischen Männergesellschaft. Deren unterschwellig auch in der Musik präsentes Zentralmotiv einer permanenten Gefährdung spiegelt Anthony McDonalds Bühnenausstattung, zwischen Schiff und Kadetten-Sporthalle changierend, mit genau markierten Hierarchien. Die untere Ebene bleibt den so genannten "Gepressten" vorbehalten, zwangsrekrutierten Matrosen, die von Vorgesetzten geschunden werden, wobei sich einer besonders hervortut, der keine Uniform trägt. Dieser John Claggert, seines Zeichens Waffenmeister, ist voller Selbsthass aufgrund seiner homosexuellen Veranlagung. Fasziniert von Unschuld und Schönheit Budds, weiß er, dass er ihn vernichten muss, um zu überleben. Clive Bayleys ausdrucksstarker Bass gewinnt vor allem beim Coming-Out, wenn brutale Härte in Verzweiflung umkippt. Sein Objekt fataler Begierde ist dagegen der Inbegriff des Guten, ein Schönling, der besser singen als reden kann, was ihm zum Verhängnis wird. In höchster emotionaler Not stottert Budd, kann sich bösartiger Meuterei-Vorwürfe nicht erwehren und erschlägt den Psychopathen Claggert. Der schwedische Bariton gibt ihn mit ansteckender Naivität auch stimmlich wie euphorisch, anrührend sein "Wiegenlied" im zur Gefängniszelle umfunktionierten Spind. Fern menschlicher Niederungen dagegen der Kapitän, ein Intellektueller, der Plutarch liest und bei bevorstehender Seeschlacht jene von Salamis zitiert. Die Vorbereitungen muten wie eine streng choreografierte Trainingseinheit an. Angeführt vom viel beschäftigten, gut gedrillten und zwischen starkem Aufbegehren und leichtfüßigem Shanty perfekt singenden Männerchor (Alessandro Zuppardo), dazu Schiffsjungen als Knabenchor. Doch auch der Kapitän scheint beeindruckt von Billy Budds Charme, eine Zuneigung, die ihn wie ein Blitz trifft. Dass er ihn vorm Galgen nicht rettet, wird zum lebenslangen Alptraum. In Prolog und Epilog ein gebrochener Mann, der die Geschehnisse noch einmal Revue passieren lässt. John Mark Ainsleys sich leidenschaftlich empor schraubender lyrischer Tenor ist hier von einer tief aus dem Inneren kommenden Intensität, die bis zum letzten ersterbenden Ton gefangen hält. Prädestiniert für die gesanglichen Selbstgespräche, Brittens Kennzeichen. Eine Musik, die Krimispannung erzeugt, ideale Stimmungswerte setzt, aber auch feinfühlig zu charakterisieren versteht. Bei hohem Bläseranteil: in den unruhigen Achteln des Vorspiels, wie von Nebelhörnern durchsetzt. In den grellen klanglichen Motiv-Fratzen wie im Altsaxofon-Blues, Klagelied der gequälten Kreatur. Das gipfelt in einem Trauermarsch, der aus aneinander gereihten Akkorden besteht, die Paul Daniel und das Museumsorchester in enervierender Klangruhe ausbreiten. Dem hohen Personalaufwand ist das Frankfurter Ensemble durchweg gewachsen. Von all den auch stimmlich typengenau agierenden Sängern sei stellvertretend das Opern-Urgestein Carlos Krause erwähnt, als Schiffsfaktotum Billys väterlicher Freund, dessen stimmlich stabile Kassandra-Rufe freilich verhallen. Auf diese Britten-Oper darf sich Frankfurt wieder etwas einbilden. Spannender ist sie nicht vorstellbar. In ihrer Unerbittlichkeit aber auch nichts für zarte Gemüter. KLAUS ACKERMANN |
|
Sängerische Spitzenkunst: Peter Mattei gab an der Frankfurter Oper den Billy Budd Herrentorte für Britten-Gourmets Von Götz Thieme Volltreffer, dieser freundlich-strahlende Billy Budd, der mit zwei anderen mehr unter Zwang als freiwillig von einem Handelsschiff, der Rights o’ Man, geholt wurde, um auf dem Kriegsschiff H.M.S. Indomitable angeheuert zu werden. Der sonnige „Beauty", wie ihn bald alle rufen, ist so kräftig wie gut aussehend und willig, im Kampf gegen die Franzosen 1797 auf hoher See zu kämpfen. Budd, der Vortoppmann, scheint so unbeugsam zu sein wie das Schiff heißt, auf dem er dient, nicht durch die Macht körperlicher Stärke, sondern durch die Menschenschwäche des guten Herzens. Ein Stachel für die, die zu solcher Reinheit in einer schmutzigen Welt nicht finden. Wie John Claggart, der für die Disziplin verantwortliche Waffenmeister. Billy Budd, dessen einziger Makel das Stottern ist, das ihn in Momenten der Bedrängnis befällt, muss untergehen in einer Welt der Verstellung und Uneigentlichkeit, des Neids und der Unterdrückung. Claggart will es so, intrigiert und dingt andere, den sonnigen Jungen wegen Meuterei zu denunzieren. Billy Budd, 1951 erstmals aufgeführt und 1961 revidiert, gehört mit Peter Grimes und Turn of the Screw zu den wichtigsten Bühnenwerken des Komponisten. E. M. Foster und Eric Crozier haben das Libretto verfasst und – auch durch persönliches Verstehen – die homoerotische Aufgeladenheit des Stoffs ins Symbolhafte umgelenkt. Trotzdem ist die Gefahr groß, schwule Schwüle auf den Schiffsplanken zu inszenieren und damit das eigentliche Thema des richtigen Lebens, des richtigen Handelns angesichts von Gut und Böse in rosigen Kitsch zu säumen. Richard Jones hat sie in Frankfurt vollständig umschifft, obwohl die Matrosen, hier stramme Kadetten einer Navy-Schule in den 1930er, 1940er Jahren, Muskeln zeigen, in der Gemeinschaftsdusche heißes Wasser zischt und Vere dem neuen Matrosen Budd einen schüchtern-sehrenden Blick sendet. Hier sind nicht die Körper nackt, sondern die Seele, die sich aussingt in Brittens ausgesparter, aber farbig instrumentierter Partitur. Jones gehört zu den Regisseuren, die dem Zuschauer genauso vertrauen wie der Musik. Was sie erzählt, muss er nicht zeigen. Wie blöd-flach oft das Erzählen auf der Opernbühne heute sein kann, merkt man in Aufführungen wie dieser. Woanders arrangierte ein Spielleiter Handgreiflichkeiten oder grelle Seifenspiele unter der Dusche: hier schaut der zugeknöpfte Claggart durch das Fenster – und wir wissen alles. Hier geht Vere auf der Empore, bemerkt unten Budd, der freudig heraufschaut, zögert, blickt kurz zurück und geht etwas langsamer weiter. Kein Gefummel, keine verschwiemelten Umarmungen. Jones zeigt mit schneidender Präzision die geopferte Unschuld – das hat die erregte Distanz eines Ang Lee und braucht ein herausragendes Ensemble, von dessen Gesichtern und Körpern sich alles ablesen lässt. Bernd Loebe, der Frankfurter Intendant, der sich mit dieser Produktion endgültig als einer der zurzeit klügsten Opernmanager ausweist, nimmt mit einem Weltklasse-Ensemble vorlieb. Für die drei Hauptpartien lassen sich schwerlich idealere Singdarsteller finden als Peter Mattei, John Mark Ainsley und Clive Bayley in den Rollen des Billy Budd, des Captain Vere und des John Claggart. Mattei als jungenhaftes Opfer seines Makels, des Stotterns, das ihn zu der Übersprungshandlung treibt, durch die Claggart getötet wird, singt sich vor seiner Hinrichtung in eine andere Welt. Eingesperrt in einen schmalen Spind lässt er Zündhölzer aufflammen und singt sich erschütternd die Angst vor dem Ende schön. Das Pianissimo ist die dominierende Farbe in dieser Tragödie. Und Ainsley stellt mit charaktervollem, doch weichem Tenor einen schmalen, fast schüchternen Seehelden dar, der in den rahmenden Szenen als Greis die Handlung erinnert, gebeugt unter einer schrecklichen Selbstlüge, die das Gute als Mysterium ortet. Bei Ainsley ahnt man, dass der Mensch sich nicht davonstehlen kann: Worte sind Taten. Die Jagofigur des Claggart ließe sich mit drohend-finsterer Augenbraue singen – Bayley sucht nicht den Ausdrucksnaturalismus des Bühnenbösewichts: wenn er bassknorrig singt, schaut man ihm in die Seele. Ein verirrter Mensch, arm, aber gefährlich. Das große Ensemble, das bis in kleine Nebenrollen genau besetzt ist, der verstärkte Chor und die Statisterie agieren mit einer Präzision von schmerzhafter Intensität. Die Verschiebung der Zeit vom 18. ins 20. Jahrhundert, die Veränderung des Schauplatzes von einem Schiff in eine Kadettenanstalt, sind die Indizien einer Irritation, einer anderen Zugehörigkeit (Antony McDonald hat Bühnenbilder und Kostüme von atemberaubender Detailgenauigkeit entworfen). Der fehlende Teergeruch verdichtet die Transferleistung des Zuschauers. So gestaltet Richard Jones die Szene der Verfolgung und des vergeblichen Angriffsversuchs auf eine französische Fregatte als eine Art hyperaktives „Spiel ohne Grenzen" in einem akustisch optimalen Exerzitien- oder Turnsaal, an dessen Rückwand eine Erinnerungstafel für die Gefallenen hängt – ein weiteres Moment der Vergeblichkeit färbt das Geschehen. Der grandios-kalte Bühnenraum lässt sich seitlich verschieben. Nach links, um die erhöht liegende Kapitänskajüte mit den Büchern und einem Porträt von George VI., dem Vater der heutigen englischen Königin, zu zeigen. Oder nach rechts: dort folgt auf den Waschraum die karge Unterkunft der Kadetten mit den Doppelstockbetten und einer Reihe von grünen Spinden. Zum Schluss hängt Budd, der weiße Engel, am Galgen – obwohl alle wissen, dass er unschuldig ist. Das Urteil hat Vere selbst überbracht. In der Oper wird das ausgespart. Britten überlässt den bittersten Moment dieser Nichtbeziehung zwischen den beiden Männern der Imagination – und der Musik: 34 Takte, 34 Akkorde von F-Dur über fis-Moll nach C-Dur, 34 mal ein Liebestod. Das formidable Museumsorchester und der Dirigent Paul Daniel lassen den Wind und die Pfiffe, Shanties und Mondnachtlieder erklingen, treiben den Schlachtrufgesang der Besatzung an, singen ein Requiem, begleiten Veres letzte Erinnerung. Links im Graben sitzen alle Streicher versammelt, rechts die Bläser, trennscharf ist das Klangbild und nachtdüster brummen die Kontrabässe. In Frankfurt hat ein unvergleichlich geschlossenes Ensemble an einem verstörenden, nahegehenden See(len)bild gemalt. |
|
KULTUR HEUTE Benjamin Brittens "Billy Budd" an der Oper Frankfurt Von Wolf-Dieter Peter "Billy Budd Foretopman" ist eine berühmte Erzählung von Herman Melville, die Benjamin Britten als große Oper, allerdings nur mit Männerstimmen, vertonte. Die Vorlage zeichnet sich durch eine Männer-Rivalität mit homo-erotischer Anziehung aus. Die Unterdrückung, ja Vernichtung des begehrten Objekts war es, die Benjamin Britten besonders interessiert hat. Regisseur Richard Jones hat die Oper jetzt in Frankfurt ganz aktuell gedeutet. ... der Sommer 1797 ist eher nur eine Ausflucht im Bewusstsein des alten, grauhaarigen und gebrechlichen Kapitän Vere. Er kehrt in der Eröffnungsszene an den Ort seines Versagens im militärischen Standgericht gegen Billy Budd zurück und singt etwas von "damals, vor Jahrhunderten". Diese Verdrängung scheint der Ausgangspunkt für das Bühnen-Duo Richard Jones und Anthony McDonald zu sein: die verleumderische Intrige, der unreflektierte Totschlag und die Hinrichtung finden in einer heutigen Kadettenschule statt. Auf dieser real existierenden britischen "Naval Academy" werden bis heute alle Abläufe wie auf einem Kriegsschiff simuliert. Anthony McDonalds Simultanbühnenbild besteht so aus vier Räumen - rechts Veres Direktoratskajüte mit zwei Bücherwänden; links anschließend eine Exerzier- und Sporthalle; dann ein Duschraum und ganz links ein Schlafraum mit Spinden und Stockbetten. Brückenartige Umgänge zeigen die hierarchische Abstufung zwischen Offizierslehrern, die auch mal Talare über der Uniform tragen sowie den Unteroffizieren und Kadetten. Wie ein auf- und abpendelndes Schiff fahren die jeweiligen Räume in das Bühnenportal. Darin hat Regisseur Richard Jones nun die alle Individualität auslöschenden Strukturen eines hermetisch geschlossenen, militärisch rigiden Männerkosmos geformt: unaufdringlich, aber gespenstisch expressiv, unentrinnbar und tödlich endend. Dirigent Paul Daniel traf den tristen Grundton, die kurz aufbrechenden Gewalteruptionen und den wieder in elegischer Klage versinkenden Tonfall der Partitur ungemein eindringlich. Er führte die großen Männerchöre wie die vielen kleinen Solorollen fein abgestuft, gipfelnd in der warmherzigen Pedell-Studie des 73jährigen Carlos Krause. Vor allem aber ließ Daniel drei überragende Sängerdarsteller sich entfalten: John Mark Ainsley gab zwischen den beiden Rahmen-Auftritten als Greis einen auf Abstand bedachten, schöngeistigen Akademiechef, dessen Humanität im entscheidenden Moment mit klagenden Tenorphrasen abstrakt realitätsfern bleibt und die militärische Ordnung höher stellt. Clive Bailey machte mit kalten, scharfkantigen Basstönen aus dem Waffenmeister Claggert eine beklemmende Studie: ein auch sexuell verklemmter Zwangsneurotiker mit penibel komplett zugeknöpftem Jackett und lauernd schleichendem Gang. Mit seiner schlacksigen Jungenfigur von über 1 Meter 90 und herrlich unverbraucht frischem Bariton überragte Peter Mattei die ganze Männerwelt mit unbedarft sonniger Ausstrahlung - und rührte am Ende zutiefst: in einem Metallspind als Gefängnis bereits wie in einem Sarg eingeschlossen, im gleißendem Licht Dunkelheit vorspielend, sang er seine Utopie einer besseren Welt in der er "danach" ankern wird, so bewegend, dass einem die Tränen kamen - denn da stellte sich ein großes Panorama als Gedankenkette ein: von Woyzeck bis zu den Geschwistern Scholl - und dann Schillers "Auch das Schöne muss sterben" weiter bis zu Rilkes "Alles Schöne ist nur des Schrecklichen Anfang" - unvergessliches, überwältigendes, kaum überbietbares Musiktheater ... © 2007 Deutschlandradio |
|
Brittens Jago Von Christoph Wurzel Eine Tat im Affekt: Der Matrose Billy Budd, Vortopmann auf der "Indomitable", tötet seinen Vorgesetzten, den Waffenmeister John Claggart, mit einem Schlag ins Gesicht, nachdem der Kapitän des Schiffes beide zu einer Gegenüberstellung in seine Kajüte gerufen hat. Billy Budd soll zu den Anschuldigungen Claggarts Stellung nehmen, er habe auf dem Kriegschiff eine Meuterei angezettelt. Dass diese Verdächtigung unhaltbar ist, ahnt auch Kapitän Edward Fairfax Vere, aber Billy Budd kann sich nicht rechtfertigen. Ihm versagen die Worte. Immer wenn er unter Druck gerät, kann er nur stammeln und stottern. Der Schlag mit der Faust ist in diesem Fall der einzige Impuls, der ihm zur Gegenwehr bleibt. Billy Budd ist nicht nur unschuldig, sondern sogar der Inbegriff des guten Jungen - idealistisch bei der Arbeit, fröhlich beim Singen, gutmütig im besten Sinn, der strahlende Mittelpunkt der ganzen Mannschaft.
Ursprünglich ist diese starke Geschichte im Kontext der aufgeklärten Freiheitsrevolutionen des 18. Jahrhunderts angesiedelt und spielt auf einem englischen Kriegsschiff, auf welchem noch absolutistische Regeln herrschen. Herman Melville, schrieb diese Novelle als sein letztes literarisches Werk im Geist eines tiefsten Humanismus. In der Frankfurter Inszenierung ist die Handlung aber ins 20. Jahrhundert und in eine Kadettenanstalt verlegt worden. Die Mechanismen der Entwürdigung und Unterdrückung sind hier nicht mehr Ausdruck politischer Verhältnisse, sondern zwangsläufige Folgen der herrschenden Befehls- und Gehorsamsstrukturen. Und es zeigt sich, dass beide Systeme sich bis aufs Haar gleichen. Militärische Zucht, Entindividualisierung des Einzelnen und unterdrückte Sexualität sind die bestimmenden Koordinaten dieser reinen Männergesellschaft. Offizielle Härte und klare Feinbilder bestimmen hier den Alltag. Das Weiche, Güte und menschliche Zuwendung, haben ihren Platz nur in den Kajüten unter Deck. Die Offiziere sind Funktionäre des Systems, auch der Kapitän Vere, an sich ein Zweifler, zollt dem System seinen Tribut. Claggart, der diabolische Fixpunkt des Geschehens, wirkt wie der zynische Normalfall.
Diese Neuformation der Oper geht in der Inszenierung des britischen Regisseurs Richard Jones vollkommen auf, und zwar in einer außergewöhnlich packenden und berührenden Weise. Bühnenbild ( drei seitlich verschiebbare Räume) und Regie ermöglichen einen Bühnennaturalismus von nahezu cinematografischer Genauigkeit. Die Präzision der Personenführung ist nicht zu übertreffen und alle Akteure setzen dies auch in faszinierende Rollenrealisation um. Drei exzellente Sänger stehen für die Hauptrollen zur Verfügung. Clive Bayley spielt den Claggart überzeugend als Inkarnation der Banalität des Bösen, ein zweiter Jago gleichsam. Peter Mattei gibt den Billy Budd auf anrührende Weise redlich und wahrhaftig. Auch John Mark Aisnley zeigt als Vere das überzeugende Charakterportrait eines zwischen Menschlichkeit und Pflichtgefühl schwankenden Mannes. Einzig die Selbstabsolution im Schlussbild wirkt vielleicht allzu pathetisch, was aber der Anlage der Oper geschuldet ist. Aus dem Ensemble ragt Carlos Krauses Verkörperung des alten Matrosen Dansker heraus. In dieser Inszenierung gibt es tatsächlich keinen einzigen Ausfall, weder darstellerisch noch sängerisch. Ein absoluter Glücksfall für diese zu selten gespielte, in ihrer Wirkung großartige Oper des hierzulande vielfach unterschätzten Benjamin Britten.
Leonard Bernstein charakterisierte Brittens Musik als tiefgründig und seelenvoll und widersprach damit dem gängigen Urteil, sie sei bloß dekorativ. Auch Eklektizismus wurde Britten vorgeworfen. Zu beweisen, dass diese Musik eine beeindruckende Bandbreite größter Ausdrucksstärke besitzt, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst dieser Frankfurter Produktion. Unter der Stabführung von Paul Daniel spielt das Museumsorchester die expressiven Seiten der Musik hervorragend heraus. Was an Klangintensität aus dem Graben kommt, erweist sich so als ein gutes Komplementär zur glasklar analytischen Bühnenrealität. FAZIT |
|
Frankfurt am Main Billy Budd Nicht eine, sondern gleich zwei Sternstunden bescherte das hiesige Opernhaus dem Publikum mit Benjamin Brittens „Billy Budd", einem Seemänner-Stück, in dem unter tragischen Umständen der sympathischste aller Kriegsmatrosen, William Budd, sein Leben lassen muß, widerwillig verurteilt von einem der tapfersten und humansten Kapitäne der alten englischen Kriegsflotte, Edward Fairfax Vere, genannt von seinen Leuten der „Sternen-Vere". An der Spitze der Beteiligten war eben auch die Elite der Elite versammelt: Der große Charakterspieler und -Tenor John Mark Ainsley als Kapitän, der jugendliche Brausekopf und Bariton Peter Mattei als „Baby" Billy Budd und Clive Bayley, Baß, als der schmierige Schiffsprofos John Claggert, der den unschuldigen Stotterer Billy Budd verleumdet, anklagt und durch einen Abwehrschlag von Billy den Tod findet. Die übrigen prachtvollen Stimmen und Gestalten gehörten allesamt zum Frankfurter Ensemble. Die anderen Stars des Leitungsteams, dem Seefahrervolk England zugehörig: Regisseur Richard Jones, Bühnenbildner, Kostümdesigner Antony McDonald, Choreograf Lucy Burge sowie Dirigent Paul Daniel. - Diesem Team nahezu ebenbürtig die Chorleiter Alessandro Zuppardo und Apostolos Kallos, vom Frankfurter Haus. Es wird unvergleichlich spannend und großartig gesungen, gespielt, mit hervorragender präzisester Personen- und Kollektivführung durch die Regie. Dazu wird realistisch, aber suggestiv-doppelgründig gemimt, parliert, schreiend Befehle, Schelte erteilt auf einem alten Kriegsschiff, von dem man geschickter Weise nur das Innere kennenlernt, nämlich den großen Trainingsraum und die zugeblendeten Kapitänskajüte sowie den Schlafraum der Matrosen mit Spind-Gängen. Ungemein expressiv, bösartig logisch, plausibel unbeeinflußbar verläuft der Handlungsgang, verfolgt von dem gebannten, atemlosen Auditorium, das sich trotz des kalten Novemberwetters kein Hüsteln, kein Schlucken, kein leisesestes Schniefen erlaubt. In Bestform naturgemäß gleichfalls Museumsorchester und die Chöre. Diese Aufführung, die ihresgleichen sucht, die unter die Haut geht wie keine andere, kann man noch bis zum 9. Dezember 2007 erleben. Ulrich Springsguth |
|
Brittens Oper "Billy Budd" in Frankfurt Mit einer Erstaufführung setzt die Oper Frankfurt ihren Benjamin-Britten-Zyklus fort, in dem u. a. schon "Peter Grimes" und "Death in Venice" zu sehen waren. Zu der erstgenannten Meeresoper passt die Premiere von Sonntag, die überdies als reine Männeroper ein Kuriosum in der Opernliteratur darstellt: "Billy Budd". Die Matrosenoper um Schuld und Sühne wartet zudem mit dem größten Orchesterapparat aller Britten-Opern auf. Die Vorlage für dieses 1951 entstandene Auftragswerk für das Londoner Covent Garden Opera House stammt von dem Moby-Dick-Autor Hermann Melville, das Libretto von E.M. Forster unter Mitarbeit von Eric Crozier. In Frankfurt wird die später von Britten überarbeitete zweiaktige Fassung in englischer Regie und mit exzellenten Sängern gezeigt. |
|
Billy Budd : Double helping of great BrittenRupert Christiansen reviews Billy Budd at Frankfurt Opera and at the BarbicanA happy coincidence allowed me to hear two tremendous performances of Britten's Billy Budd back to back. One was a staged production at the Frankfurt Opera, in which the libretto had been freshly interpreted by the director Richard Jones; the other was a concert performance at the Barbican, under the auspices of the London Symphony Orchestra. In both cases, the conductors, Paul Daniel (Frankfurt) and Daniel Harding (LSO), were undertaking the piece for the first time, as were two of our finest tenors, John Mark Ainsley (Frankfurt) and Ian Bostridge (LSO) in the role of Captain Vere, originally composed for Peter Pears. Jones takes the opera away from its setting on a Napoleonic man o'war and imagines the action taking place in a conservative naval academy, around the era of the opera's composition in 1950 (a portrait of George VI is toasted). Vere is its headmaster, wearing a black gown over his uniform, and bearing all the hallmarks of a privileged background and high culture; Claggart is a type I recall all too well from my own schooldays - the spruce ex-serviceman with a clipped moustache, in a patched tweed sports jacket and golf-club tie. Both he and Vere clearly adore Billy -Vere with a sort of Platonic delight in his beauty, Claggart with a repressed intensity that has turned him psychotically sadistic. Cunningly designed by Antony McDonald, the concept works brilliantly as an exposé of the sexual mentality of Britten and his librettist E. M. Forster. Only the great set-piece of the aborted encounter with the enemy in the second act seems slightly unlikely, played as a war exercise scuppered by a power cut. In other respects, Jones is wise enough to keep his approach austere and untricksy - certain scenes, indeed, could have been more overtly erotic without being gratuitously tasteless. Paul Daniel's conducting is dark and understated, even dreamy; at the Barbican, Harding puts the LSO through its paces in a breathtaking display which emphasises the score's nervous energy and virtuoso orchestration, and the amateur LSO chorus has the edge over Frankfurt's professionals. The Barbican also boasts the superior supporting cast, lining up a parade of the best British male singers, including Andrew Kennedy (the Novice), Alasdair Elliott (Red Whiskers) and Matthew Rose (Lieutenant Radcliffe). Their German equivalents struggled manfully with the difficulties of singing in English. Ian Bostridge's Vere seems more like a country vicar than a naval commander, but his musical intelligence and sensitivity to the text is always impressive; John Mark Ainsley has more vocal and dramatic authority. The Barbican's Claggart, Gidon Saks, is the most chilling of villains, but Frankfurt's Clive Bayley is more psychologically plausible, more insidious and deceptive. The LSO's Nathan Gunn doesn't sing the title-role as richly or warmly as Frankfurt's Peter Mattei, but Gunn radiates the right air of "beauty, handsomeness, goodness", while Mattei seems merely gormless. But these are connoisseurial distinctions: both these performances of Britten's grandest, if not greatest, opera were overwhelmingly moving and powerful. |


 Billy Budd muss hängen - Szene aus der Inszenierung von Richard Jones
Billy Budd muss hängen - Szene aus der Inszenierung von Richard Jones John Mark Ainsley, Peter Mattei und Clive Bayley in der Frankfurter Inszenierung
John Mark Ainsley, Peter Mattei und Clive Bayley in der Frankfurter Inszenierung