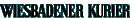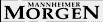|
OPER FRANKFURT VON HANS-JÜRGEN LINKE Aus heiterem Himmel ist im Wald von Fontainebleau plötzlich das Glück da, alles könnte so schön weitergehen: Elisabeth und Carlo, aus Staatsraison miteinander verlobt, begegnen sich zum ersten Mal und lieben sich ohne Umwege. Gefühl und Macht singen die gleiche Melodie, zart spinnt und zieht Carlo Franci im Orchestergraben schwelgerische Linien, Annalisa Raspagliosi und Yonghoon Lee als Elisabeth und Carlo geben in einem ersten großen Duett ein eindrucksvolles lyrisches Exposé und erreichen eine beträchtliche Fallhöhe. Der Rücksturz in die Wirklichkeit kommt umgehend und ist tief. In der Wirklichkeit verhält sich Staatsraison feindlich dissonant zur Harmonie der Herzen, Elisabeth soll, wie man hört, doch lieber den amtierenden König Philipp II. heiraten. Sie kennt ihre Pflichten als Staatswesen, und damit befindet sich Carlo in einem ödipalen Konflikt. Eine Oper mit solch einem ersten Akt braucht nicht noch eine Ouverture. Während Schillers dramatisches Gedicht über den Infanten von Spanien das historische Personal aus dem 16. Jahrhundert für eine exemplarische Arbeit über das Schicksal aufklärerischer Gedanken und Köpfe in unaufgeklärten Zeiten nutzte, haben Verdis Librettisten Joseph Méry und Camille du Locle den Stoff näher ans italienische Risorgimento gezogen. Der Gedanke nationaler Unabhängigkeit rückt in den Vordergrund, die katholische Kirche erscheint als ungebrochen düstere, ubiquitäre Macht. David McVicars Inszenierung zur Spielzeiteröffnung der Oper Frankfurt hat jeglicher Versuchung, den Stoff noch näher ans 21. Jahrhundert zu transportieren, widerstanden. Er hat als Ambiente einen unaufdringlichen altspanischen Historismus gewählt. Die Damen tragen höfische, elegant fallende und breit wallende Kleider, die Männer schwarzes Tuch, Stulpenstiefel und Halskrause, die Soldaten Cabasset, Brustpanzer, Schwert und Hellebarde und die Mönche große Kapuzen (Kostüme: Brigitte Reifenstuel). Die Mauern der Macht Der Ort der Handlung befindet sich immer zwischen hohen, gleichförmigen Mauern und Pfeilern aus hellen Ziegeln. Sie sind auch das Material der schmucklosen Kuben verschiedener Höhen und Ausmaße, die als Opfer-Altar, als Treppenabsätze oder Podeste hydraulisch dezent aus dem Boden gefahren kommen. Carlo, der letztlich an der Aufgabe scheitert, all das überschüssig überschäumende Gefühl seiner vergeblichen Liebe in Freiheitsdrang für den Kampf der Flamen zu verwandeln, ist kein schlaffer Versager, sondern erhält einen deutlich heroischen Akzent, obwohl er mit seinen Bemühungen nicht recht vom Fleck kommt und immer im falschen Augenblick den Degen zieht. Sein großer väterlicher Gegner Philipp (Kwangchul Youn) wirkt weniger brachial als grüblerisch und tritt lyrischer auf als üblich. So verliert er zwar nicht an Präsenz, aber an Härte, und erhält für seine Einsamkeitsklage zu Beginn des vierten Aktes stürmischen Szenenapplaus. Prinzessin Eboli (Michaela Schuster) bereut mit großem tragischem Ton und viel intensiver als sie verrät, Rodrigo, der Marquis von Posa (George Petean), ist ein lupenreiner tenoraler Held des großen Gefühls und der politischen Vergeblichkeit. So dass insgesamt dieser "Don Carlo" sängerisch ganz ausgezeichnet besetzt ist und einen grundsätzlich versöhnlichen Ton anschlägt: Alle wären viel bessere Menschen, wenn sie nur könnten, doch die Verhältnisse, die waren nicht so. Nur der mächtige, kalte Großinquisitor (Gregory Frank) vertritt eine repressive Macht ohne humane Kehrseite. McVicar hat keinen politisch polarisierten Verdi inszeniert, seine Aufmerksamkeit gilt der Fallhöhe und der tödlichen Konsequenz der Gefühle. Das Schleier-Lied der Eboli wird ausschließlich für werkimmanente Anspielungen benutzt, die Ketzer werden nicht verbrannt, sondern dürfen, mit dezenten Folterwunden bemalt, sich unterwerfen. Nur den Tod kann man Carlo am Ende nicht ersparen, obwohl der überirdische Großvater Karl V. ihn gern gerettet hätte: Ödipale Konflikte haben nun mal einen tödlichen Ausgang. Düstere Farben Die elegant gehandhabte, solide konventionelle Optik der Inszenierung hat als Gegengewicht also eine prachtvolle musikalische Seite, und das betrifft auch die Orchesterarbeit. Die Dramatik in Verdis Musik ist bei Carlo Franci in den besten Händen. Die vorwiegend düsteren Klangfarben sind von großer Klarheit, die Dynamik kennt enorme Feinheiten in den kammermusikalischen Phasen des ersten Akts und in leisen Passagen, dazu effektvolle Steigerungswerte bis hin zu Stellen, die die Sänger in kraftraubende Selbstbehauptungs-Scharmützel verwickeln. Pointiert herausgearbeitet wird die Raumwirkung der Musik durch klangliche Kontrastierung von Bläsern und Chor hinter und vor den Kulissen. Große Aufmerksamkeit widmet Franci der Plastizität der Klangsprache und dem eng geknüpften Ineinander von instrumentalen und vokalen Stimmführungen. Er forciert nie, sondern schlägt geduldige Tempi, bleibt maßvoll und aufmerksam. [ document info ] Dokument erstellt am 01.10.2007 um 16:48:02 Uhr Letzte Änderung am 01.10.2007 um 17:01:23 Uhr Erscheinungsdatum 02.10.2007 |
|
Liebe erstickt unterm Kreuz Von Michael Dellith Sie sind grau, monumental, streng symmetrisch und furchteinflößend: Die aus ebenmäßigen Ziegelsteinen geformten Säulen des von Robert Jones geschaffenen Einheitsbühnenbilds strahlen nicht nur die Kälte und Macht des von der Inquisition beherrschten Spaniens des 16. Jahrhunderts aus, sie wirken wie ein zeitloser Kerker, egal ob sie nun einen Kirchenraum oder die Palastmauern symbolisieren sollen. Robert Jones’ geniale Hallenkulisse, inspiriert von der strengen Architektur des spanischen Klosters San Yuste und dem Escorial-Palast, bietet mit ihren ansteigenden Steintreppen nicht nur dem großen Aufmarsch von Chor (wie immer vorbildlich von Alessandro Zuppardo einstudiert) und Statisten ein adäquates „Spielfeld". Sie schafft darüber hinaus die nötige Atmosphäre für ein Drama, das vor allem eins zeigen will: wie wenig sich ein Individuum in Zeiten einer erdrückenden staatlichen und religiösen Tyrannei entfalten kann, und wie die Liebe gleichsam unterm Kreuz erstickt. Dass der Schotte McVicar nichts von vordergründigen Aktualisierungen eines Opernstoffs hält, war auch an der Opulenz der sehr aufwendig gearbeiteten Kostüme zu spüren, bei denen sich Brigitte Reiffenstuel an historischen Vorbildern bis hin zur Halskrause orientierte. Die Brokat-Samt-und-Seide-Roben waren aber nicht nur eine Augenweide. Sie zeigten in ihrer Strenge vielmehr, dass die Gefühle der Protagonisten gleichsam im Korsett stecken, dass Haltung, Gesten, jede Regung vom Hofzeremoniell bestimmt sind. Somit geriet die Personenführung recht statisch, und zuweilen dominierte das An-der-Rampe-Singen. Aber es passte zum Gefangensein der Figuren, denen man einen quirliges Auftreten nicht abgenommen hätte. Und es hatte Vorteile für den Gesang. Das stimmliche Niveau war wieder bemerkenswert hoch, bis in die kleinste Nebenrolle hinein – so, wie man es von der Frankfurter Oper gewohnt ist. Der koreanische Tenor Yonghoon Lee empfahl sich – nach einer kleinen Eingewöhnungsphase im heiklen, weil gesanglich ungewöhnlich offen komponierten Fontainebleau-Akt zu Beginn – in der Titelpartie mit heldischen Qualitäten, gepaart mit juveniler Emphase. Sein Landsmann Kwangchul Youn verlieh der Partie des Philipp subtile Zwischentöne, stellte nicht nur den unbeugsamen Vater heraus, sondern ließ auch dessen Ängste und Zweifel aufscheinen. Gregory Frank war ihm mit seinem kernigen Bass als Großinquisitor ein ebenbürtiger Gegenpart, während George Petean mit seinem vollrunden, durch alle Lagen hindurch ausgeglichenen Bariton-Timbre als ebenso treuherziger wie mutiger Marquis von Posa glänzte. Nuancenreich, mit edler Anmut legte Annalisa Raspagliosi die Elisabeth an, wozu Michaela Schuster mit ihrem lodernden Mezzo als Prinzessin Eboli einen reizvollen Kontrast bildete. Insgesamt war vom 2. Akt an eine Steigerung der Ausdrucksintensität zu bemerken – nicht zuletzt deshalb, weil Altmeister Carlo Franci, schon vor Beginn mit herzlichem Beifall bedacht, Verdis oft düstere Musik am Pult des Museumsorchesters mit fast jugendlichem Feuer entzündete und dabei die Dynamik gelegentlich ein wenig zu sehr aufdrehte. Am Ende großer Jubel– auch für die Regie! |
|
Giuseppe Verdis "Don Carlo"an Frankfurts Oper Dass es so etwas noch gibt: Halskrause und Reifrock trägt man in Frankfurt, über 150 historische Kostüme wurden zusammengeschneidert an der dortigen Oper, die sich unter ihrem Intendanten Bernd Loebe gern rühmt, höchst unterschiedliche Regie-Sichtweisen zu präsentieren: Bei der ersten Saison-Premiere mit Giuseppe Verdis "Don Carlo" setzte Regisseur David McVicar jetzt auf eine Ausstattungs- und Kostümschlacht, wie sie an diesem Haus schon länger nicht mehr zu sehen war. Teuer war das bestimmt, doch am Wert darf man mindestens Zweifel haben. An das Innere einer Kathedrale erinnert das weite, von Mauern und Säulen geprägte Bühnenbild, das Robert Jones entworfen hat; der Altar und andere Kulissen lassen sich auf- und absenken. Sattgesehen hat man sich daran eigentlich schon im ersten, dem so genannten "Fontainebleau"-Akt - gespielt wird die fünfaktige italienische Fassung, die 1886 in Modena uraufgeführt wurde. Ärgerlicher noch: McVicar bietet zwar eine Menge Material, aber ansonsten ziemlich wenig Ideen. So treten an die Stelle einer durchdachten Personenführung längst vergessen geglaubte Bühnen-Peinlichkeiten. Die sich oft selbst überlassenen Sänger strecken die Arme zur Seite oder in die Höhe, bestens einstudiert scheint dagegen das Armkreisen bei den ständigen Verbeugungen zu sein. Nur eine der so zahlreichen wie überflüssigen Posen. So sieht man in diesem Frankfurter "Don Carlo" zwar viel Weihrauch suggerierenden Bühnennebel und am Ende des Autodafé-Bildes im dritten Akt auch ein großes brennendes Kreuz. Aber Charaktere, Menschen sieht man eigentlich nicht, und selbst die ganz schauerlich abgemergelten Ketzer lassen einen merkwürdig kalt. Zu viel bleibt hier Klischee; so trägt die Intrigantin Eboli natürlich rotes Haar, und der Großinquisitor wird als fast schon bemitleidenswerter adipöser Zittergreis dargestellt. Und wenn Gastsänger Kwangchul Youn zur Arie des König Philipp II. "Ella giammai m’amo" ansetzt, schaut er so gequält drein, als ob er eher an Kopfschmerzen als an Erkenntnis leiden würde. Der regelmäßig in Bayreuth singende Koreaner debütiert an der Oper Frankfurt mit einem zu breiten Flackern seines unausgeglichen klingenden Basses. Dass dieser "Don Carlo" nicht vollends in seinen Bildern erstarrt, ist vor allem dem Dirigenten Carlo Franci zu verdanken. Seit über 30 Jahren gastiert der beim Museumsorchester hoch beliebte Italiener regelmäßig an der Oper Frankfurt, und es gelingt ihm, das Drama wenigstens musikalisch unter die Haut gehen zu lassen. Auch plakative Mittel, etwa kräftig zupackende Einwürfe der Blechbläser, sind ihm dabei recht, aber er versteht es eben auch prächtig, die Solisten pointiert und farbenreich zu begleiten und große Ensemble-Szenen trotz einzelner verwackelter Chor-Einsätze eindrucksvoll zu formen - bereits nach der Pause wird er vom Publikum so stark gefeiert wie am Ende manche Sänger. Annalisa Raspagliosi hat das für ihre tadellose, auch in den lyrischen Momenten bewegende Elisabeth uneingeschränkt verdient, auch Yonghoon Lee empfiehlt sich trotz einer gewissen Enge seines Tenors in der Titelpartie. Als Marquis von Posa steht ihm der eher robuste Bariton von George Petean zur Seite, während Michaela Schuster die Prinzessin Eboli eher spröde klingend und ohne die letzte vokale Beweglichkeit gibt. Doch insgesamt lässt sich dieses Don-Carlos-Oratorium mit Kulissen und Kostümen zumindest gut hören. AXEL ZIBULSKI |
|
Sonntagsbraten mit Ketzern Verdis "Don Carlo" eröffnet Frankfurts Opern-Saison opulent Von Volker Milch
FRANKFURT Wunderbar. Ganz originalgetreue, bluttriefende Ketzer auf der Bühne, der Chor in historischen Kostümen aus dem düsteren Spanien der Inquisition - und im Hintergrund sogar echtes Feuer, das an einem gigantischen Kreuz emporzüngelt. Keine Frage: Frankfurts Opernpublikum wird mit dem von David McVicar zur Saison-Eröffnung inszenierten "Don Carlo" ein Sonntagsbraten der besonders üppigen Art serviert. Das fängt schon mit der Fassung an: Statt der abgespeckten vieraktigen Version gibt es in Frankfurt auch den die Vorgeschichte erzählenden Fontainebleau-Akt. Dieser Einstieg ist musikalisch vielleicht weniger suggestiv, macht aber die Handlung, bekanntlich sehr frei nach Schiller, plausibler. Altmeister Carlo Franci, der für original-italienischen Verdi steht und seit über 30 Jahren gern gehörter Gast in Frankfurt ist, dirigiert die Modena-Fassung des Werks aus dem Jahr 1886. Bereits im Vorfeld gab sich Frankfurts Oper vollmundig: Man habe keine Kosten gescheut, war vom Intendanten Bernd Loebe zu hören, und ein Bericht im Opern-Magazin widmet sich stolz den über zwei Kilometern Stoff, die nach Brigitte Reiffenstuels Entwürfen zu 200 Kostümen wurden. Wow! Zu amerikanisch anmutenden Superlativen passt, dass der schottische Regisseur für sich in Anspruch nimmt, als Konzept eben Verdi pur zu haben. Nun ja. Im Kontext eines spannenden Spielplans an einem ambitionierten Opernhaus, dem man keine Fantasielosigkeit vorwerfen kann, hat es ja durchaus seinen Reiz, auch einmal die Opulenz zum Programm zu erheben. Und die Konvention alter Schule wird da, wo eher konzeptorientiertes Musiktheater die Regel ist, fast wieder zur schelmischen Provokation. Könnte man meinen. Aber im ersten Akt sehen David McVicars Original-Verdi-Opernposen leider ziemlich zum Davonlaufen aus: Händeringendes Pathos, das auch musikalisch nicht immer beglückt. Yonghoon Lee gibt zunächst einen kraftvollen, aber unausgeglichenen und im Pianobereich unterbelichteten Don Carlo, zwischen Bühne und Graben kommt es zu Wackelkontakten. Die vorwiegend textile Prachtentfaltung in der monumentalen Sakralarchitektur des Bühnenbildes von Robert Jones wird vom Publikum bis zur Pause übrigens verhalten aufgenommen. Die musiktheatralische Überzeugungskraft steigert sich indes im weiteren Verlauf. Yonghoon Lees Don Carlo gewinnt an Sicherheit und Nuancierung, und auch im Chor und in der übrigen Besetzung zeigt sich Frankfurt wieder einmal als Hort vokaler Hochkultur: Kwangchul Youn gibt König Philipp grimmige Autorität und lässt im Monolog eindrucksvoll die Einsamkeit der Macht spüren, Annalisa Raspagliosi ist eine glänzend gestaltende Elisabeth, George Petean adelt als Rodrigo die freundschaftlichen Gefühle mit warm timbriertem Bariton, Michaela Schuster ist eine zum Lied vom Schleier gar anmutig und bestimmt stilecht das Tanzbein schwingende Eboli. Die Sänger und Dirigent Carlo Franci, der die Temperatur mit einem feurigen Verdi spürbar steigen lässt, werden vom Publikum ausdauernd gefeiert, während das Regieteam auch ein paar Buhrufe einstecken muss. Man darf gespannt sein, mit welchen Produktionen Frankfurts Oper nach diesem Sonntagsbraten wieder auf Diät gesetzt wird. |
|
OPER: Der Schotte David McVicar wird in Frankfurt für seine "Don Carlo"-Inszenierung gefeiert Von unserem Mitarbeiter Gerd DöringKein Autodafé in Frankfurt, kein Scheiterhaufen auf der Bühne. Dafür züngeln die Flammen an einem Kreuz empor, das im Bühnenhintergrund aufragt. David McVicar ist kein Mann vordergründiger Effekte. Der Schotte inszeniert Verdis "Don Carlo" mit viel Reduktion, arbeitet mit starken Symbolen, aber nicht mit krassen Bildern. Gewalt ist zwar allgegenwärtig in dieser Oper, aber die Opfer des achtzigjährigen Krieges in Flandern, die Greuel der Inquisition bleiben im Hintergrund. McVicar lenkt den Blick auf die Handelnden. Den Akteuren hat Robert Jones eine monumentale Arena aufgebaut, eine Trutzburg aus Stein, die sich mal zum Himmel öffnet, dann wieder zum Kircheninnern schließt. Ein Königshof, der frösteln macht. Die historischen Realitäten hat sich Verdi, wie schon Schiller in der Vorlage, passend zurechtgebogen. Das Drama um die beiden Frei(heits)geister Don Carlo und Rodrigo ist durchwoben mit den Intrigen um die unerfüllte Liebe zwischen Don Carlo und seiner Stiefmutter Elisabeth. Wie ein Trauerrand umkleidet die historische Kostümierung (Brigitte Reifenstuehl) das Stück: Man trägt schwarz und grau im katholischen Spanien, einzig die Entourage Elisabeths, die es aus Frankreich in den Königspalast verschlagen hat, glänzt mit leichten Farben und koketter Mode. Zwischen kalter Ratio und heißer Emotion bewegen sich die Handelnden in Verdis Freiheitsdrama. In Rodrigo, dem Marquis von Posa, findet König Phillipp II. jemanden, den er schätzt. Dessen unbeugsame Art beeindruckt ihn, seinem Sohn dagegen misstraut er - zu Recht. Ergreift der doch die Partei der Aufrührer in Flandern und liebt zudem seine Stiefmutter Elisabeth. Phillipp wiederum ist längst nicht mehr Herr über seine Handlungen. Die Macht aus dem Händen genommen hat ihm die mächtige Inquisition, die in der Person des Großinquisitors herrscht. Den Kirchenfürst lässt Gregory Frank seine strengen Glaubenssätze betörend schön verkünden. Kwangchul Youns Philipp ist ein grauer Hagestolz mit mächtigem, sonorem Bass, der durch seinen Palast stolziert. Ein solides Gegengewicht zu dem Heißsporn Don Carlo, den Yonghoon Lee mit nicht immer stabilem, aber feurigem Tenor singt, und dem alerten Rodrigo, den George Petean perfekt verkörpert. Beeindruckend auch die Kontrahentinnen am Königshof. Michaela Schuster ist eine kokette, stimmgewaltige Prinzessin Eboli, Annalisa Raspaglioso eine stolze Königin mit Stärken vor allem in den lyrischen Passagen, deren Sopran warm und innig klingen kann und die auch darstellerisch zu überzeugen vermag. Beifall und Bravos gibt es in Frankfurt schon zu Beginn des zweiten Teils für den Dirigenten. Carlo Franci ist ein Verdi-Dompteur alter Schule, der es allerdings seinen Sängern nicht gerade leicht macht. Der quicke Grandseigneur mit Hang zum Pathos hängt ein wenig zu sehr am schönen Klang und verwechselt zuweilen Emotion im Orchestergraben mit Lautstärke. McVicars Inszenierung wird in Frankfurt bejubelt, völlig zu Recht besonders gefeiert werden Sänger und Chor. |
|
'Don Carlo' aufwendig klassisch inszeniert Kritik von Midou Grossmann Der berühmte Funke wollte am ganzen Abend nicht überspringen, in der Frankfurter Oper. Zwar hatte man – laut Intendant Bernd Loebe - keine Kosten und Mühen gescheut, um auf Wunsch des Regisseurs David McVicar eine Inszenierung mit klassischer Ausprägung auf die Bühne zu bringen, weil McVicar denkt, dass man nur so dem Werk gerecht werden kann. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, doch bleibt die Inszenierung in Frankfurt allzu oft in der Welt der schönen Bilder gefangen. Die ersten drei Akte wirken steif und ohne dramatischen Tiefgang, das Geschehen auf der Bühne rettet sich quasi von Arie zu Arie. Auch wirkt das bombastische Bühnenbild von Robert Jones auf Dauer ermüdend. Alle fünf Akte, gespielt wird die italienische Fassung, sind in kalten grauen Wänden angesiedelt, die wohl für ein Mausoleum stehen. Die Klinkerwände erinnern an den Klosterbau El Escorial. Philipp II erbaute den Komplex, lebte und arbeitete darin. Hier spann er das Spinnenetz, mit dem er sein Weltreich zusammenzuhalten versuchte. Die Kostüme von Brigitte Reiffenstuel wurden nach historischen Vorlagen konzipiert. Das kann durchaus spannend wirken, doch was der Inszenierung fehlt, ist eine ausgefeilte Personenregie, zu oft wird an der Rampe gesungen. Auch das kann man noch gelten lassen, wenn die Sänger mit einer ausdrucksstarken Persönlichkeit agieren. Wie ein gespannter Bogen sollte der Pfeil des Gesangs abgeschossen werden, um es einmal bildlich auszudrücken. In Frankfurt trifft dies allerdings nicht zu, das Geschehen auf der Bühne hat keine Tiefe. Vielleicht wäre es an der Zeit - neben dem Regisseur - auch einen Bewegungscoach in die Inszenierungen einzubinden, welcher den Protagonisten das Agieren auf der Bühne, auch mit minimalsten Mitteln, beibringen könnte. Am Besten gelingt dies am Premierenabend noch George Petean als Rodrigo, Marquis von Posa, der diese Rolle auch lebt. Gesanglich kann er ebenfalls mit seinem schönen Timbre und den perfekten Phrasierungen überzeugen, die Stimme ist zudem flexibel und ausdrucksstark. Auch Annalisa Raspagliosi gelingt es zumeist als unglückliche Elisabeth von Valois glaubhaft zu wirken, stimmlich ist sie der Partie mit ihrem klaren und höhensicheren Sopran gewachsen. Kwangchul Youn singt einen hervorragenden Philipp, zeichnet stimmlich gut die gespaltene Persönlichkeit und doch bleibt die darstellerische Komponente etwas blass, was man auch von Michaela Schuster in der Rolle der Prinzessin Eboli sagen kann. Das italienische Timbre gelingt ihr nicht ganz, auch ist sie keine intrigante, vielschichtige und doch elegante Prinzessin Eboli. Und nun zum Sänger der Titelrolle, Yonghoon Lee. Für Andrew Richards einige Wochen vor der Premiere neu besetzt, gibt er in Frankfurt sein Europadebüt. Lee besitzt ein gutes Stimmpotential, doch hat er am Premierenabend noch Schwierigkeiten eine durchgehend gute Leistung abzuliefern. Wenn er sich frei singen kann, schwingt sich seine Stimme zu einer klaren Höhe hinauf, doch gibt es auch wieder Momente, in denen er sich nicht gegen das Orchester behaupten kann, ein Bühnencharisma fehlt ihm noch gänzlich. Die Szene des Großinquisitors wird von der Regie verschenkt, es kommt nur ein gebrochener alter Mann auf die Bühne, den man nicht als geheimen Herrscher erkennen kann. Auch stimmlich wirkt Gregory Frank eher gebrochen. Arlene Rolph als Tebaldo darf als einzige ein farbiges Kostüm tragen und hat von der Hilfe des choreografischen Mitarbeiters profitiert, gesungen hat sie zudem noch gut. Dirigent des Abends ist der vom Orchester hoch geschätzte Carlo Franci, trotzdem vermisst man den nach dieser Spielzeit scheidende GMD Paolo Carignani. Vielleicht wäre es ihm geglückt mehr Feuer ins Spiel zu bringen. Denn Carlo Franci hält sich mit dem Museumsorchester etwas zu sehr im Hintergrund, er begleitet mehr, als dass er gestaltet. Auch einige Wackler sind anfangs noch zu bemerken, zudem wirkt die Klangsprache allzu oft breit und behaglich. Der Chor leistet wieder gute Arbeit unter der Leitung von Alessandro Zuppardo. Diese Inszenierung sollte vom Regisseur noch einmal überarbeitet werden, dramatisch pointierter und weniger plakativ angelegt werden, dann könnte sie sich sicherlich im Repertoire langfristig erfolgreich behaupten. |
|
Frankfurt: Grandioser „Don Carlo" Regisseur David McVicar hatte schon vor der Aufnahme der Proben öffentlich angekündigt, dass dieses wohl bedeutendste Oeuvre von Giuseppe Verdi, hier in der fünfaktigen Fassung von Modena, in historischen Kostümen spielen wird, in den originalen Hofkostümen aus König Philipps Zeiten. Monatelang hatte die Bühnenschneiderei harte - und teure - Handarbeit erbracht, um die kostbaren Stoffe zu verarbeiten, die Knöpfe mit Edelsteinen zu fixieren, die Halskrausen in allen gebrauchten Weiten zuzuschneiden und zu bügeln. Diese höfische Kleidung, in ästhetisch gedeckten Farben, auch die Uniformen, Helme, Schwerter wurden in den dreieinhalben Stunden der Aufführung dann auch konsequenterweise nicht mehr abgelegt. Selbst in tiefer Nacht, in Philipps Schlafzimmer, als dieser sein trauriges Schicksal klagend – und bewunderungswürdig schön - besang, waren König und Königin, Prinzessin sowie Marquis Posa und jeder sonst Durchreisende vorschriftsmäßig gekleidet. Eine einzige Ausnahme war zugelassen: der wilde Infant Carlo, bei Schiller „Dom Karlos", machte sich hin und wieder in offenem schlotternden Hemd Luft. Sogar bei dem ersten Wiedertreffen mit der Königin, seiner ehemaligen Verlobten und jetzigen Stiefmutter, wo er ja aristokratischen Eindruck machen müsste, zeigte sein offenes Hemd viel Brust und Schulter. Ein Zeichen der heißen Liebes-Leidenschaft, des Frustes, der wütenden Verzweiflung? - Nur aufmerksame Zuschauer werden bemerkt haben, dass das Hemd Blutflecken aufwies, dass sein Rücken blutige Striemen trug, dass seine Schulter Verletzungen aufwies. Ein Flagellant, der sich seine grenzenlose Liebe, seine große Hoffnung vorsorglich selbst aus dem Leibe geprügelt hatte. Oder? - Allein diese rote Kleinigkeit machte klar, dass hier keine traditionsgebundene Kostümschlacht stattfinden sollte. David McVicar und sein genialer Bildner Robert Jones brauchten die sich bewegenden, dunklen und dekorativen Gewänder, um den Kontrast zu verschärfen zu den wuchtigen, grausam-kalten und festen Gefängnismauern, die den Herrscherhof, ganz Spanien, ja vielleicht die ganze Welt umgeben. An den Bühnenrändern hochgezogen, in die Höhe reichend, die Tiefen begrenzend, verstärkt durch mächtige eckige Pfeiler, wurde ihr abweisender Effekt betont durch die grauen, hässlichen, wohl nicht ganz sauberen Klinker, die dem Auge kein Halt mehr geben, keinerlei Schmückung, kein Bild, kein Fenster aufweisen. Glatte hygienische Fliesen, die nötigenfalls Blut, das ja in Mengen fließt, zurückweisen können, abwaschbar wie im Schlachthof. - Dieses Einheitsbild, mit hoher Abstraktion und Symbolkraft, konnte aber, dank der fortschrittlichen Frankfurter Bühnentechnik, doch zum Leben bewegt werden. Wenn der Wald von Fontaineblau zu Beginn angedeutet wird, fährt eine Mauer lautlos hoch und lässt den Blick ins Dunkle, in die Freiheit, in die weite Welt frei. Will man das Kloster, den Palast zeigen, heben sich Stufen, Sockel, Kuben - ebenfalls gefliest. Flüssige Wandlungen der Szenen und Lokalisierungen der Räume ergeben sich; die Kontinuität des Handlungsablaufes wird gewahrt, Arbeitstische, Altäre, Betten, Bänke werden überflüssig. - Die hier erzählte Geschichte weicht kaum ab vom Libretto, vom Notwendigen oder Gewohnten. Der Akzent wird aber entscheidend verschoben: Das Liebesdrama oder die -Dramen stehen nicht im Vordergrund, sondern die Unabänderlichkeiten, die Zwänge in einem Herrscherhaus, im Reiche Spanien, in der großen Gesellschaft und Politik. Gefühle werden ausgedrückt, müssen aber weichen. Der Staatsräson muss man sich nicht nur unterordnen, sondern sie wirkt so übermächtig, dass sich die Unterordnung von selbst ergibt. Dies beginnt schon im französischen Wald, wo Carlo seine Braut Elisabeth trifft, wo sich die beiden lieben lernen, ohne von ihrem Brautstand zu wissen. Hier macht McVicar wenige Striche; die Liebesfreuden werden minimiert; urplötzlich wird Elisabeth, durch Boten aus dem nahen Schloss informiert, zur Königin von Spanien gemacht, nicht Carlo, sondern sein Vater Philipp ist der Ehemann. Die Braut hat keine Überlegungszeit, stimmt ohne Zögern zu, der übermächtige Zwang bedingt ihr Umschwenken. Politik, Krieg oder Frieden haben Vorrang. - Auch Posa, die Eboli, der König, der Großinquisitor, ja jedermann wird auf seine Bahn gepresst. Nur dem Infanten Carlo fehlt zunächst die Einsicht, will ausbrechen; er holt sich ständig blutige Nasen. Am Ende, in dem herrlichen Gesang mit der Königin, hat sich der Verstand, die weise, lähmende Einsicht durchgesetzt. Er lässt sich dann auch, und dies ist gleichfalls eine Innovation, widerstandslos von den Schergen der Macht erdolchen, im Beisein von Großinquisitor und vom König. Der König wirft sich noch in Vaterliebe auf den Toten - Gleichfalls dieses Bild zeigt die stringente, schlüssige Sicht der Regiearbeit und Dramaturgie. Die eigentlich unlösbaren Problemen des Schluss der Oper lösen sich auf, weil Carlo nicht in ein Kloster, in ein Versteck gezogen werden muss, wo sein Großvater Karl V. auf ihn wartet. Der überflüssige Karl wird gestrichen. Auch er beugt sich der Staatsräson. - Gesungen wird auf höchstem Niveau und mit Trauerflor auf den Stimmbändern, dagegen sind gesangliche und mimische Ekstasen nicht angesagt. Alles an Stimmkultur stimmt sich in die Balance ein, die das Regiekonzept erfordert. Dies bedingt mitunter, dass der oft mächtige Chorgesang in den Hintergrund oder ins Niemandsland verschoben wird. - Titelpatron Carlo wird von Yonghoon Lee gesungen, mit einer noch etwas unausgegorenen Stimme, aber schönen Ausbrüchen und verhaltenen Piani, expressiv oder depressiv. Annalisa Rapagliosi bewährt sich wieder einmal in einer Hauptrolle am hiesigen Haus, strahlt Königinwürde aus, singt beherrscht, tonschön, intonationssicher mit großem Atem. Michaela Schuster hat keine Mühe, die Intrigen, Phobien und Verstrickungen der Prinzessin Eboli zu demonstrieren; ihr Mezzo weist nur selten kleinste Schärfen auf. George Petean, aus Rumänien, hat noch nicht die große Ausdrucksskala, die man für den Menschenfreund Posa braucht, macht aber äußerlich seine Sache gut und wiegt sich im Tonschutz der schönsten Melodien. Der Großinquisitor, in der Maske des uralten weisen Machtmenschen, findet in Simon Bailey einen glaubwürdigen Repräsentanten mit gewaltiger Stimme. Eine solche Tonkultur verkörpert auch Kwangschul Youn, der mit schönsten dunklen Farben den großen Herrscher in allen Facetten geben kann. Dass hier ein zweiter Koreaner eine Hauptrolle im Stück übernimmt, zeigt den globalen Aspekt dieser herrlichen Oper. - Großartig, nicht genug zu loben, die Leistung von Carlo Franci am Dirigentenpult, der das bestens eingespielte Museumsorchester zu gewaltigen Eruptionen, zu sensibelsten Pianissimo motivieren kann, zu feinen klangvollen, kräftigen Tönen und großer Expressivität, zu einem stets passenden, wechselnden Rhythmus, zu sprechender Begleitmusik, die auch dem Gesang zu gute kommt. Wie immer auf höchstem Niveau, mit allen verlangten Variationen eines Kollektives, der Chor und Extrachor der Oper (Alessandro Zuppardo). Zu bewundern wieder einmal die Ausgeglichenheit der gesamten Crew auf und hinter der Bühne sowie im Graben und in der Höh, bei den Lichtwerfern, die Stilreinheit von Bild und Ort, von Regie, Choreographie (Andrew George) und Ausstattung. Ein ganz großer Abend! Ulrich Springsguth |