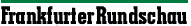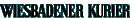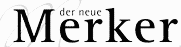|
Alte Oper Frankfurt VON HANS-JÜRGEN LINKE Am Anfang war, wie gesagt, das Wort, und zusammen mit anderen Worten formte es sich zu der Frage: Warum ist der Himmel stumm und der Raum unergründlich? Das ist, etwas unrhythmisch übersetzt, die Anfangs- und Endfrage in Matthias Pintschers vieraktiger Oper "L'espace dernier" über das Sterben des Dichters Arthur Rimbaud. Nicht über das Leben also, sondern über den Aufbruch, der am Anfang und Ende jedes Versuches steht, den stummen Himmel zum Klingen zu bringen und den unergründlichen Raum zu erfahren. Die deutsche Erstaufführung in der Frankfurter Alten Oper in einer Koproduktion mit den Opernhäusern in Frankfurt und Köln - die Uraufführung fand vor vier Jahren in Paris statt - ist konzertant, aber es fehlt ihr dennoch nichts Wesentliches. Pintscher hat alles in die Musik geholt, und die ist so reich an Ausdruck, dass man auf szenische Zutaten leicht verzichten kann. Das Orchester ist unter anderem um etliche Perkussionsinstrumente erweitert und in der Partitur in drei Gruppen aufgeteilt; räumlich erscheint die Aufteilung allerdings als Vierteilung, mit der zentralen Klangkörpermasse samt Solisten und Sängerensemble auf der Bühne; auf den Bühnen-Emporen links, rechts und hinten befindet sich je eine kleine Instrumentalistengruppe und ein elektronischer Klangbearbeitungs-Stützpunkt in der Raummitte. Diese Anordnung löst die klassische Konzert-Konstellation, in der Orchester und Publikum sich gegenüber sitzen und der Dirigent dazwischen im Schnittpunkt aller Blickachsen steht, nicht auf in ein Surround-Konzept. "L'espace dernier" ist keine dramatische Musik, eher eine Musik der sich ständig verändernden Zustände, der Raum-Erfahrung, mit nur einem möglichen Ende: dem endgültigen Aufbruch in den oder aus dem letzten Raum. Musik und Text weisen immer wieder aus dem empirischen hinaus in einen transzendenten Raum. Es ist weniger eine Oper als ein Requiem, in dem nicht der Wunsch nach Ruhe in Frieden, sondern nach permanentem, sozusagen endgültigem Aufbruch den Horizont markiert. Paolo Carignani, der die Aufführung leitet, hat eine komplizierte Arbeit zu verrichten: Koordination eines großen, mehrteilig angelegten Apparates nach einer äußerst komplexen und detailreichen Partitur, zahlreiche schroffe Wechsel der Tempi, scharfe dynamische Schnitte, heftige Accelerandi und Crescendi und so fort. Pintschers äußerst präzise Notierung - unverzichtbare Voraussetzung alles Jenseitigen in der Musik - fordert große Gewissenhaftigkeit und Geistesgegenwart von allen beteiligten Musikern. Carignani konzentriert sich darauf, wie ein Fels in der brandenden Vielfalt den Takt zu geben. Das hellwache Frankfurter Museumsorchester sucht sich seinen Weg durch das Stück mit großer Verlässlichkeit, und die vokale Gestaltung des sechzehnköpfigen (in der Partitur "Gesangssolisten" genannten) SWR Vokalensembles und der sechs Solistinnen und Solisten lässt in Dramatik, Präsenz, Präzision und Textverständlichkeit keine Wünsche offen. Nur Christoph Waltz in der Rolle des männlichen Sprechers findet keinen rechten Kontakt zu seinem französischen Text. Insgesamt scheint immer wieder eine gewisse Vorsicht durch. Carignani tendiert manchmal dazu, dynamische Details oder Artikulations-Feinheiten zu vernachlässigen. Vieles, was bei Pintscher extrem gezeichnet ist, drängt wie ängstlich in die Mitte. Es gibt kein Ausschwingen, kaum ein an den Rand des Hörbaren führendes Pianissimo, eruptive Stellen werden ordentlich erledigt. Oft fehlt ein gewisses Etwas, das man vielleicht einen feinstofflich orientierten Klangsinn nennen könnte. Dies ist ein subtiles und zugleich extremes Werk, dem man eine intensive Rezeption wünschen möchte; die hat mit dieser Aufführung gerade begonnen. Ihre inneren Spielräume haben sicher noch nicht ihre letzte Gestalt erreicht. [ document info ] Dokument erstellt am 18.05.2008 um 19:08:01 Uhr Letzte Änderung am 19.05.2008 um 09:45:59 Uhr Erscheinungsdatum 19.05.2008 |
|
Alte Oper: Pintschers "L´espace dernier" Von Axel Zibulski FRANKFURT. Bei der Pariser Uraufführung 2004 war der "letzte Raum" eine leere, von schwarz-weißen Kontrasten und beweglichen Gittern geprägte Bühne. Jetzt, bei der deutschen Erstaufführung von Matthias Pintschers Musiktheater "L´espace dernier", verzichtete die Oper Frankfurt gleich ganz auf das Gegenständliche einer Inszenierung: Konzertant erklang das Stück in der Alten Oper und tags darauf in der Kölner Philharmonie. Eine plausible Lösung, weil "L´espace dernier" zwar anderthalb Stunden um den französischen Dichter Arthur Rimbaud (1854-1891) kreist. Erzählstränge aber gibt es nicht, die Partien der vier Sängerinnen und zwei Sänger bleiben ohne Namen, denn dieser "letzte Raum" ist keine zur Oper gewordene Biografie, sondern speist sich als eine Art Hörtheater aus Texten Rimbauds, aus Gedichten etwa und Briefen. Seit seiner Jugend ist der heute 38 Jahre alte Komponist Pintscher von dem rastlos lebenden und früh verstorbenen Dichter Rimbaud fasziniert. In den vier Teilen von "L´espace dernier" stellt er die Texte in einen kühlen Klangraum, in dem die weitgehend getragene, auch spröde Musik vielfach aufgefächert ist: Das in drei Gruppen aufgeteilte Museumsorchester, auf Seiten- und Choremporen von drei einzelnen Violoncello- und Schlagwerks-Spielern flankiert, aber auch die Live-Elektronik ließen die Aufführung wie eine Klanginszenierung ohne Bühne wirken, dabei prägnant von Frankfurts scheidendem Generalmusikdirektor Paolo Carignani koordiniert. Und der mit 16 Frauenstimmen des SWR Vokalensembles Stuttgart besetzte Chor leistete vor allem im zweiten, um das Gedicht "Départ" kreisenden Teil vokal so Großartiges wie die sechs Solisten: Erst einige Tage vor der Aufführung war die Sopranistin Anu Komsi eingesprungen, zusammen mit dem bis in extreme Höhen forcierten Spinto-Tenor von Peter Marsh, dem spannungsvoll dunklen Bassbariton Ashley Holland sowie mit Barbara Zechmeister, Alexandra Lubchansky und Claudia Mahnke ein exzellentes Solisten-Sextett. Das Ende als Auflösung Ganz ohne biografische Verankerung bleibt "L´espace dernier" dank zweier Sprechrollen aber doch nicht: Eher berichtend als interpretierend: Isabelle Menke (La Femme) und Christoph Walz (L´Homme), sie aus Tagebucheinträgen von Rimbauds beiden Schwestern rezitierend, er einem Begleiter und Beobachter Rimbauds auf dessen Afrika-Reisen angenähert. Zum Schluss hin werden die Pausen länger und häufiger. Die Musik verlischt leise nach den Worten. Das Ende als Zustand völliger Auflösung. |
|
Aus dem Klang entstehen Räume Von Gabriele Nicol Pintscher (geboren 1971) gilt als die große, junge, vielprämierte und eloquente Komponistenbegabung. Er pflegt in jeder Hinsicht sein kultiviertes Bild, und die Leute rennen hin, auch wenn sie vielleicht nicht alles verstehen. So dürfte es mit dem „musiktheatralischen Werk" „L’espace dernier" (Der letzte Raum) gewesen sein, hinter dem sich eine zwölf Jahre andauernde Beschäftigung mit den Gedichten und auch dem Leben Arthur Rimbauds verbirgt. Es scheint, als sei Pintscher ein wahrer Rimbaud-Fan. Dieses Werk hat er uns – freilich ohne Szenenbild (was das Verständnis vielleicht vereinfacht hätte) – vorführen lassen und dazu noch in französischer Sprache. Man ist ja äußerst weltgewandt und hat in Paris gelebt. Dort ist 2004 das vierteilige Opus uraufgeführt worden, gewissermaßen als Summa aus dem Umgang mit dem unglückseligen Dichter. Wie wir von Pintscher wissen, weil er nicht gerade selten in Frankfurt ist, geht er höchst virtuos mit allen natürlichen und elektronischen Klangmitteln um (er braucht dazu auch den entsprechend üppigen Instrumenten-Apparat). Und er sucht stets nach neuen Formen, selbst wenn es wie in diesem Werk scheinbar die Formlosigkeit ist – „keine Erzählung, kein lineares System", vielmehr das Experiment, aus dem Klang Räume entstehen zu lassen, Bilder ohne ein Ziel. Anregung war das Wort, aber es wird nicht als Erzählung verwendet, obwohl Sprechgesang vorkommt. Musikalisch gibt es eine Menge höchst aparter Klangbilder. Gelegentlich fühlt man sich in einen klingenden Tropenwald versetzt. Rimbauds wechselvolles Leben gestattet diese Assoziation. Doch der Hauptstrang, der Melancholie beinhaltet, ist das Gedicht „Aufbruch": „Assez vu ... Assez eu ... Assez connu" (dies die Anfangsworte: Genug gesehn. Genug besessen. Genug er-kannt.) Pintscher kann sich freuen. Carignani hat die Aufführung sensibel, aber auch effektsicher geleitet; die acht Solosänger und das SWR-Vokalensemble haben kundig mitgewirkt. |
|
Frankfurt am Main Alte Oper:Matthias Pintscher L’espace dernier Mit seinen 36 Jahren zählt Matthias Pintscher bereits zu den Großen seiner jungen Komponistengeneration. Seine Rimbaud -Oper L´espace dernier, die 2004 in Paris szenisch uraufgeführt wurde, hatte nun in der Alten Oper Frankfurt ihre konzertante deutsche Erstaufführung. Und sicher hat dieses Werk mehr Konzert- als Bühnencharakter. Es collagiert aus dem lyrischen Werk des Dichters Gefühlszustände, Impressionen und Momente zusammen. Mit sehr eigenwillig suggestiven Klangfarben gelingt es Pintscher, die Atmosphäre des Textes zu überhöhen. Gerade in der zweiten Hälfte gewinnt das Werk an dramatischem Zug und lässt manche Längen des Anfangs vergessen. Ein riesiger Orchesterapparat, viele Vokalsolisten und ein Frauenchor wird -teilweise im Raum verteilt- aufgeboten. In bestechender Form profiliert sich in der mörderisch hohen Tenorpartie Peter Marsh. Seine strahlenden Höhen bis ins Falsett ziehend hat er auch Mut zur individuellen Farbgebung. Claudia Mahnkes warmer Mezzosopran hat ebenfalls Raum, eigenen Charakter zu entfalten. Die Frauenstimmen dominieren stark in der Quantität dieses Werkes. So wetteifern in eisigen Höhen die drei Sopranistinnen Alexandra Lubschansky, Barbara Zechmeister und Anu Komsi stentorhaft um Dominanz. Einzig Ashley Hollands Bass kommt nicht recht zur Geltung, was auch an der starken Instrumentierung seines Solos liegen kann. Eindrücklich und auf höchstem Niveau modellieren die Frauenstimmen des SWR Vokalensembles Ihre Klangwolken. Christoph Waltz und Isabelle Menke sprechen konzentriert und farbenreich ihre Passagen. Das Frankfurter Museumsorchester leistet Außerordentliches. Paolo Carignani beweist seine Vielseitigkeit und hat das überbordende, auch teilweise elektronisch verstärkte Instrumentarium energisch im Griff. Eine gelungene Aufführung, die am nächsten Tag in der Kölner Philharmonie zu hören sein wird. Damian Kern |