|
Mit Fidelio ins Finale VON STEFAN SCHICKHAUS Wer fremd ist in der Stadt oder wer fremd der Kunstmusik gegenüber steht, der hat manchmal Schwierigkeiten: Die Oper von der Alten Oper zu unterscheiden, ist dem Namen nach nicht ganz leicht. Jetzt könnte ein kleiner Zusatz dem Erkennen auf die Sprünge helfen. Denn was die Alte Oper seit etlichen Jahren mit dem "Auftakt" macht, bekommt die Oper Frankfurt nun mit dem "Finale" neu hinzu. Die einen warten mit einer Programmkonzentration zum Saisonbeginn auf, die anderen zum Saisonende. "Auftakt" und "Finale", A und O nicht jeder Musik, aber doch gut einprägsame Schlüsselbegriffe für einen gelungenen musikalischen Bogen. Die neue Veranstaltungsreihe der Oper Frankfurt soll künftig am Ende jeder Spielzeit stehen. Doch bei ihrem jetzigen Debüt beendet sie nicht nur eine Spielzeit, sondern gleich etwas Größeres. Denn mit Beethovens "Fidelio", dessen Premiere das Finale am 1. Juni einläutet, nimmt sich der Frankfurter Generalmusikdirektor, kurz: GMD, Paolo Carignani seine letzte hiesige Produktion vor. Nach neun Jahren verlässt Carignani das Haus - neun Jahren, in denen sich mancher an diesem temperamentvollen, manchmal hitzigen, nie bloß pauschalem Mailänder so sehr rieb in der Führungsetage des Opernhauses, dass diese Zeitspanne nun doch länger erscheint als vielleicht erwartet. Auch Christoph von Dohnányi war in den siebziger Jahren neun Jahre lang Opern-GMD in Frankfurt, Michael Gielen brachte es in den 80ern auf zehn Jahre. Für den 47-jährigen Carignani war Frankfurt die erste feste Position, und etwas Festes schließt sich nun nicht unmittelbar an. An der Oper Zürich hat er einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, auch in München wird er regelmäßig im Orchestergraben stehen. Beethovens "Fidelio", die "Befreiungs-Oper", ist also kein schlechtes Finale für einen Dirigenten, der sich in Frankfurt mitunter mehr Freiheiten nahm, als es der Intendanz lieb sein konnte. "Beethoven hat bei Carignani seinen Verdi gehört und kommt also weniger insistierend als dramatisch daher, dazu farbsatt, voller dynamischer Feinarbeit und elastischer Rhythmik. Und mit soviel Schwung, Beweglichkeit und Druck, dass man mit dem Hören kaum mitkam" - so stand es in der FR nach einem Beethoven-Konzert im Jahr 2001, als man den Opern-GMD noch gern in die Italiener-Schublade steckte, in der er sich selbst nie sah. Elf Veranstaltungen vom 1. bis 29. Juni Beethoven wird auch Thema des ersten "Finales" sein, genauer: ein Satz aus der Feder des Komponisten, den die Oper Frankfurt als Maxime dem "Final"-Monat voranstellte: "Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Wem sich meine Musik auftut, der muss frei werden von all dem Elend, womit sich die anderen Menschen schleppen." Elf Veranstaltungen zwischen 1. und 29. Juni nehmen sich dieser Maxime an. Bereits zwei Stunden vor der Premiere von "Fidelio" wird um 18 Uhr das "Finale" eröffnet mit dem Runden Tisch "Beethoven und der revolutionäre Gedanke - Komponisten im Gespräch über Beethoven", moderiert von FR-Feuilletonist Hans-Klaus Jungheinrich. Finale des "Finales" ist Beethovens Sinfonie Nr. 9 in der Alten Oper, dirigiert von Paolo Carignani. Danach kann dann nichts mehr kommen. Denn wie es einst Arnold Schönberg über diese Neunte als mystische Grenze raunte: "Wer darüber hinaus will, muss fort." [ document info ] Dokument erstellt am 24.05.2008 um 00:16:02 Uhr Erscheinungsdatum 24.05.2008 | Ausgabe: R2NO | Seite: 13 | |
|
Die Freiheit bricht wie ein Sonnenstrahl herein Von Birgit Popp Gerne wird „Fidelio" als Rettungs- oder Freiheitsoper bezeichnet. Das freiheitliche Ideal ist Beethovens hochgehaltenes Ziel, doch schon der Titel weist auf das zentrale Element der Oper hin. „Fidelio" heißt übersetzt „der Treue", und „Fidelitas" bedeutet Treue, vor allem die eheliche, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Und, so Norbert Abels, Chefdramaturg der Oper Frankfurt: „Es gibt nicht viele Opern, in denen es um ,Gattenliebe‘ geht, und es gibt wenige Inszenierungen, in denen eben dieser Aspekt des Werkes thematisiert wird. Es wird meist und oft recht eindimensional auf den politischen Aspekt gesetzt, auf Totalitarismus und Willkürherrschaft. In unserem Konzept haben wir uns von dieser Tradition ein wenig verabschiedet. Wir sehen Liebe, Verantwortung, Gattenliebe, Treue als genauso wichtig an wie den politischen Aspekt des Werkes, der bei Beethoven ohnehin sehr vage bleibt." Abels weiter: „Es geht darum, dass ein Mensch aus der Gefangenschaft, aus der Isolation befreit werden soll, in diesem Fall von seiner eigenen Frau. Es handelt sich um Menschen, die um ein künftiges Glück kämpfen. Es ist ein Klischeeglück, das wir in unseren Absichten gleichwohl sehr ernst genommen haben." Norbert Abels, der neben seiner Tätigkeit an der Frankfurter Oper eine Professur für Musiktheater-Dramaturgie an der Essener Folkwang-Hochschule wahrnimmt und Autor zahlreicher Bücher ist – so ist sein jüngst im Rowohlt-Verlag erschienenes Buch dem britischen Komponisten Benjamin Britten gewidmet –, sieht den revolutionären Aspekt von „Fidelio" vor allem in der Musik: „Die Hoffnung wird elementar-musikalisch gezeichnet. Die Musikwelten sind tönende Sonneneinbrüche." Erstaunlich ist, dass gerade die letzten Werke Beethovens wie „Fidelio" oder die 9. Sinfonie, mit der Paolo Carignani am 29. Mai sein Abschlusskonzert als GMD geben wird, so viel Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen, zu einem Zeitpunkt komponiert, als Beethoven durch seine mittlerweile fast vollständige Taubheit selbst sehr stark unter Einsamkeit und Isolierung litt. Für Norbert Abels liegt darin aber auch der Grund für die ungewöhnliche Ausdruckskraft seiner Musik, „Seine späten Streichquartette sind so entstiegen, so neu, so ungehört, auch vielen Hörern seiner Zeit ganz unverständlich. Die Radikalität, die Grenzüberschreitung, mit der er diese Musik geschrieben hat, ist wunderbar. Für mich war Beethoven ein so ungeheuerlicher Mensch, der sogar aus dieser Behinderung ein wunderbares Potenzial herauskristallisiert hat. Wäre er nicht so ein einsamer Mensch gewesen, hätte er in seinem Spätwerk vielleicht nicht so radikal mit Traditionen gebrochen." Die Vorbereitungen für Fidelio haben rund ein Jahr in Anspruch genommen, „wobei für uns immer feststand, dass wir den Privatwunsch nach Freiheit und nach erfüllter Lebensgemeinschaft sehr ernst nehmen würden, und, dass wir uns für dieses Bild eines zukünftigen Glücks nicht schämen. Ich finde es schön, dass dieses junge Regieteam mit der Regisseurin Christina Paulhofer – sie konnte wegen der Folgen einer Erkrankung nur zu Beginn der Probenzeit inszenatorisch wirksam werden – und dem Bühnenbildner und verantwortlichem Regisseur Alex Harb dies heute wieder etwas anders sieht". Die „Fidelio"-Premiere am 1. Juni ist Auftakt für das „Finale", in dem von dieser Spielzeit die letzten vier Wochen einer Saison unter einem Programmschwerpunkt gestellt werden. Neben den vielfältigen musikalischen Aktivitäten rund um das Gesamtwerk Beethovens, die zum Teil von Moderationen, Spielszenen und Diskussionen begleitet werden, liegt Norbert Abels besonders „Ein Tag für die Freiheit" am 15. Juni in Zusammenarbeit mit Amnesty international am Herzen. Am 16. Juni wird er in der Reihe „Oper Spielzeit" unter anderem mit Filmausschnitten Einblicke zur Arbeit an der Neuinszenierung von „Fidelio" bieten. Zudem wird es in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche am 8. Juni in der Katharinenkirche einen Gottesdienst und am 10. Juni einen Vortrag zu „Fidelio" des Kirchenpräsidenten Peter Steinacker geben. | |
|
Interview "Sie können sie nicht singen, ohne bis zum Rand angefüllt zu sein mit Begeisterung", sagt die schwedische Sopranistin über ihre Rolle der Leonore in Beethovens "Fidelio".
Entschuldigen Sie bitte, ich bin völlig verschwitzt. Oh ich auch. Es ist ja hier wie in New York. Das freut uns zu hören: Frankfurt ist wie New York! Mainhattan! Das ist nicht Ihre erste Leonore? Nein, nein. Meine dritte. Die erste war in Milwaukee. Eine typisch amerikanische Produktion. 14 Tage Proben für alles. Also: hupp, hupp, los! Aber was macht das? Fidelio ist einfach eine großartige Oper. Vielleicht nicht die allerbeste Oper-Oper, aber fantastisch. Lieben Sie die Rolle, die Sie spielen oder lieben Sie die Rolle, die Sie singen? Beides. Ich liebe die Musik und ich liebe die Reise, auf die sich Leonore begibt. Sie beginnt als eine ganz durchschnittliche Frau in einer außergewöhnlichen Situation. Dann entwickelt sie sich. Das gefällt mir. Würden Sie für Ihren Ehemann ins Gefängnis gehen? Das haben Menschen immer gemacht. Das werden sie immer machen. Im September werde ich in Jonas Forssells neuer Oper "Der Tod und das Mädchen" singen. Eine Welturaufführung in Malmö. Ariel Dorfman hat selbst das Libretto geschrieben. Darin geht es um Frauen in der Pinochet-Diktatur, Leonores unserer Zeit. An Fidelio ist so einzigartig, dass es - so ernst es ist - nicht hinunterzieht in die Depression, sondern zugleich eine Geschichte "O namenloser Freude" ist. Es ist so viel Energie und Lebensbejahung darin ... Jetzt klingen Sie sehr amerikanisch, dabei sind Sie vor 42 Jahren in Stockholm geboren. Oh, das Bergman-Gen habe ich auch. Der Freudenausbruch am Ende von Fidelio ist nicht naiv. Er kommt nach dem bittersten Realismus. Er hat zu tun mit Erfahrung und mit dem Wissen darum, dass mit Niedergeschlagenheit niemandem geholfen ist. Da ist einer durch den Schmerz durchgegangen und weiß doch, dass das Leben auch voller Freude sein kann. Freuen Sie sich, wenn Sie die Leonore singen? Ja, ja, ja! Sie können sie nicht singen, ohne bis zum Rand angefüllt zu sein von Begeisterung. Wenn Sie nicht abheben, ist gar nichts. Leonore ist vorbehaltlos offen. In beidem: im Leid und in der Freude. Ich liebe das. Ich liebe Menschen, die so sind. Das ist doch das Schöne am Theater, dass wir das ausleben können. Das ist Ihr Privileg. Für uns Zuschauer heißt es: Fasten your seatbelts! Wir dürfen nicht aufspringen, wir dürfen nicht mitsingen. Dennoch ist das Theater für Menschen, die in Büros sitzen und dort ihre Arbeit machen, eine Gelegenheit, einmal auszuflippen aus ihrer Rolle. Es ist eine Gelegenheit, Gefühle auszudrücken, offen auszutragen, was sonst zurückgehalten werden muss. Wann entschieden Sie sich, Sängerin zu werden? Sich auf die Bühne zu stellen und die großen Gefühle auszuleben? Musik machte ich schon immer. Meine Eltern waren Musiker. Aber ich machte Kirchen- und Kammermusik. Selbst als ich - ich war 21 - Sängerin werden wollte, dachte ich nicht an die große Bühne, das große Orchester, das große Drama. Es dauerte, bis ich begriff, dass man Opern singen muss, um seinen Lebensunterhalt bezahlen zu können. Ich hatte aber damals noch keine Ahnung davon, wie sehr mir das passte, wie sehr ich gerade das Große, das Überwältigende daran lieben würde. Das begann ich erst mit Anfang dreißig zu begreifen. Ich brauche lange. Was wollten Sie denn zunächst werden? Als Teenager wollte ich Tänzerin werden. Nicht Ballett, sondern Modern Dance, Martha Graham. Am Freitag zeigt Pina Bausch in Wuppertal ihre neue Produktion. Wunderbar. Kann ich da hin? Ich bewundere sie. Wir sehen, was wir machen können. Sie wollten also keine Opernsängerin werden? Meine Stimme war auch nicht die einer großen dramatischen Sängerin. Ich hatte einen sehr klaren, reinen, schlanken Sopran. Es dauerte lange, bis meine Stimme größer wurde. Darum fing ich ja erst so spät an. Ich war 38 Jahre alt - da hatte ich mein Debüt. Als mit Ende zwanzig meine Stimme wuchs, hatte ich niemanden, der mir zeigte, was ich mit diesem neuen Instrument anfangen konnte, wie ich es behandeln musste. Was ist so speziell an großen Stimmen? Es ist wie mit einem Rennwagen. Sie haben plötzlich so viel Kraft, dass jeder kleine Fehler sofort riesige Auswirkungen hat. Jeder - auch der vollkommene Laie - hört, hört bei einer großen Stimme fast schmerzhaft, wenn sie danebenliegt. Alles hat eine solche Wucht. Eine große Stimme führt sich auf wie ein wilder Stier im Porzellanladen. Sie müssen lernen, diese Stimme zu beherrschen. Sonst büchst sie Ihnen aus. Sie brauchen dazu den ganzen Körper. Sie müssen eine Technik entwickeln, jeden Ton zu beherrschen und ihn doch frei zu lassen. Es muss Ihre Technik sein. Eine Technik für Ihre Stimme. Die Technik Ihrer Stimme. Das dauert. Die Risiken sind größer trotz aller Technik. Große Stimmen sind gefährliche und gefährdete Stimmen. Aber genau das macht sie so reizvoll. Haben Sie Lampenfieber? Ich bin nervös. Aber Angst habe ich keine. Ich habe keine Angst, einen Fehler zu machen. Ich habe keine Angst, als Trottel dazustehen. Fehler habe ich schon jede Menge gemacht, den Trottel in meinem Leben oft genug gegeben. Was kann schon passieren? Wenn ich nicht gut bin, bin ich nicht gut. Das ist alles. Ich werde nicht daran sterben, die Welt wird nicht zusammenbrechen. Es ist ja nur Theater, was wir machen. Es passiert so viel Entsetzliches in der wirklichen Welt, da wäre es nicht richtig, ich ließe mich vor einem Theaterauftritt von Angst überwältigen. Sonntag, 18 Uhr. Oper Frankfurt, Fidelio. Was ist der Moment, dem Sie besonders entgegenfiebern? Was muss klappen? Das Quartett im ersten Akt. Das "Mir ist so wunderbar". Alle warten darauf, es zu hören. Es ist so empfindsam, so ruhig. Sie dürfen da nichts erzwingen wollen. Es muss ruhig fließen und stark sein dabei. Ein perfektes Stück Musik. Mit neunzehn verließen Sie Stockholm und gingen nach New York. Um Tänzerin zu werden. Aber das ging nicht. Ich war nicht gut genug. Ich hatte zu spät angefangen. Ich nahm Gesangsunterricht. Aber auch das kam nicht wirklich voran. Ich sang im Chor. Ich konnte Lieder und Oratorien singen. Als dann meine Stimme kräftiger wurde, wusste ich mir gar nicht mehr zu helfen, und mit 31 ging ich zurück nach Stockholm und nahm Gesangsunterricht - bei meiner Mutter! Ich war weggelaufen vor meinem Zuhause, und jetzt war ich wieder da, und ausgerechnet meine Mutter war meine Lehrerin. Aber es ging. Ich kam voran. Nicht nur stimmlich. Diese großen dramatischen Rollen verlangen nicht nur erwachsene Stimmen, sondern erwachsene Frauen. Die derzeitige Schwärmerei für 22-jährige Superstimmen ist Blödsinn. Eine Salome muss beides sein: sehr jung und sehr, sehr erfahren. Das ist nicht nur eine Frage der Gesangsausbildung. Das ist auch eine Frage der Lebensklugheit. Man muss sich sehr gut unter Kontrolle haben, um so aus der Kontrolle geraten zu können, wie es diese Rollen verlangen. Wenn Sie dann auch noch eine schöne, eine italienische Stimme dabei haben wollen, wird alles sehr, sehr kompliziert und verlangt noch einmal eine Extraportion Technik. Das zu erlernen, braucht viel Zeit. Ihre Eltern waren Musiker. Haben Sie Kinder? Nein. Ich bin auch nicht verheiratet. Dann stirbt diese Musikerfamilie mit Ihnen aus? Nein, nein. Mein Bruder Thomas ist Heldentenor, und seine Frau Katarina Dalayman ist auch eine bekannte Sängerin. Und die Kinder lassen einiges erwarten. Das Gen wird weitergereicht. Da mache ich mir keine Sorgen. Wie bereiten Sie sich auf die Leonore vor? Ich bin vor allem damit beschäftigt, mich physisch fit dafür zu machen. Ich übe, ich jogge den Main rauf und runter, ich mache Yoga, ich trainiere. Hier in Frankfurt haben wir sechs Wochen Proben. Das ist viel. Unter uns: eher zu viel. "Fidelio" ist eine kurze Oper und - um die Wahrheit zu sagen - es passiert ja nicht gar zu viel. Action gibt es keine. Es spielt sich doch alles in den Köpfen ab. Das muss in der Musik gezeigt werden. Ich glaube, am wichtigsten ist es, sich einzugestehen, dass es keine Action-Oper ist. Das ist es doch, was "Fidelio" so schwierig macht. Es spielt auf der Bühne, aber es spielt nicht. Es geht um inneres Erleben. Das eines jeden Einzelnen. Und um die Empfindungen, die die Einzelnen in ihrem Innern für einander haben. Das ist nicht zu spielen. Das muss gesungen werden. Wie politisch ist "Fidelio"? Sehr, sehr. Aber "Fidelio" ist nicht nur eine politische Oper. Es handelt vom Kampf gegen die Tyrannei und von der Liebe. Von beidem und von beidem gleich intensiv. Es gibt diesen großartigen Moment im zweiten Akt, als Leonore hinunter in den Kerker geht, dort einen Gefangenen sieht und hofft, dass es ihr Mann ist. Aber es ist zu dunkel. Sie kann ihn nicht erkennen. Das ist der Wendepunkt ihrer Entwicklung. Sie sagt: "Wer Du auch seiest, ich will Dich retten". Das ist ein großer Augenblick. Da wird ihr, da wird mir, da wird den Zuschauern klar, der Mensch kann hinaustreten aus dem engen Kreis seiner eigenen Interessen und sich für andere einsetzen - ganz unabhängig davon, ob es Freunde sind oder nicht. Der Mensch mag ein Raubtier sein, aber er hat auch den Impuls, dem, der in Not ist, zu helfen. Ich stelle mir vor, dass Sie manchmal beim Joggen lachen und denken: Toll, was ich für ein Leben habe! Aber sicher. Wie sollte ich nicht. Ich habe fünfzehn Jahre lang gekellnert, in einer Bank gearbeitet, übersetzt. Ich wusste manchmal nicht, ob ich dem Vermieter oder dem Gesangslehrer das Geld schuldig bleiben sollte. Natürlich freue ich mich, dass ich jetzt all diese großen Rollen singen darf. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Manchmal bekomme ich eine Gänsehaut bei dem Gedanken, was für ein Glück ich hatte. Manchmal werde ich gefragt, ob ich nicht bedaure, all die Jahre nicht gesungen, nicht auf der Bühne gestanden zu haben. Das ist Unsinn. Meine Lebenserfahrung bringe ich jetzt mit in meine Rollen. Es ist nicht gut, wenn Sänger nichts getan haben als singen. Ich bin dafür, dass Oper, Theater subventioniert werden. Aber ich glaube nicht daran, dass ein Talent, einfach weil es ein Talent ist, durchgefüttert werden sollte. Es schadet uns nichts, das Leben kennen zu lernen. So wie unser Publikum es kennt. Sie müssen hart sein für diesen Beruf wie für wenige andere. Und auf der Bühne müssen Sie empfindsam sein wie wenige andere. Diese Schizophrenie hätte ich mit Mitte zwanzig nicht bewältigen können. Ich wäre zu empfindlich gewesen. Ich wäre kaputt gegangen. Das Kellnerinnen-Leben hat mich gerettet. Sie müssen hart sein? Es muss mir gleichgültig sein, was die Leute über mich denken. Ich darf mir aus Ablehnung nichts machen. Wenn man jung ist, will man geliebt werden. Oder gefürchtet. Jedenfalls ist man abhängig vom Urteil der anderen. Das ist man in meinem Beruf so sehr sowieso, dass man es sich nicht leisten kann, auch noch innerlich abhängig davon zu sein. Ein Satz hat mir sehr geholfen, mir klar über die Realität zu werden: "Sie wären nicht so besorgt über das, was die Leute über Sie denken, wenn Ihnen klar wäre, wie selten sie es tun." Ich bin froh, dass ich das begriffen hatte, schon bevor meine Karriere begann. Als ich an der Met einsprang für Karita Mattila machten mir die 4000 Leute im Saal und die elf Millionen Radiohörer nicht viel aus. Allenfalls dachte ich an den Chor, den strengsten Kritiker des Planeten. Fünfzehn Jahre lang haben Sie als Kellnerin gearbeitet. Jetzt singen Sie an den wichtigsten Opernhäusern der Welt. Das ist doch ein Filmstoff. Hat sich bei Ihnen noch kein Produzent gemeldet? Doch, einer war schon da. Aber er stellte sich etwas vor - das hatte nichts mit mir zu tun. Eine Kellnerin in der Bronx, die nach einem Kerl ausschaut. Nein, dachte ich: Wer zum Teufel soll das sein? Mich fasziniert an der Geschichte die Erfahrung, dass das Leben immer offen ist. Ich arbeitete als Kellnerin und vierzehn Tage später sang ich in Malmö die Turandot. Ich hatte zuvor nie auf einer Bühne gestanden, nie mit einem großen Orchester gearbeitet. Es war ein Wunder. So ist das Leben. Das gefällt mir. Interview: Arno Widmann [ document info ] | |
|
Mehr zu hören VON HANS-JÜRGEN LINKE
Und dann geschieht endlich, was der Off-Kommentar geradezu herbeigeredet hat: Carignani sagt beim Abendessen zwei böse Sätze über seinen Intendanten. Er sagt: "Diesen Opportunismus, diese Heuchelei konnte ich einfach nicht mehr ertragen. Ich kann den Mann einfach nicht mehr ertragen, ich konnte mir nicht vorstellen, mit so einem Typen noch drei weitere Jahre meines Lebens zu teilen." Und damit hat Frankfurt seinen kleinen Opernskandal zum Saisonende. Die Frage ist, wie schwer diese Sätze wiegen. Sie wiegen schwer am Ende einer langen und nach außen hin anfangs vertrauensvollen, später immerhin produktiven Zusammenarbeit, die begonnen hatte, lange bevor Bernd Loebe in Frankfurt Intendant war. Sie wiegen schwerer durch die Vorwürfe Carignanis, Loebes Entscheidungen über die letzte Premiere der Spielzeit und die Regie seien leichtsinnig. Sie wiegen schwer im Kontrast zu dem professionellen Schweigen, das sonst über all das gebreitet wird, was hinter den Kulissen geschieht und "Interna" genannt wird: Endlich hört man mal etwas über banale Wahrheiten, nicht immer nur über große Kunst! Da haben also zwei Männer in leitenden Positionen miteinander gearbeitet, ohne sich zu mögen! Aber gibt es etwas Alltäglicheres im Arbeitsleben? Wie viele uninteressante Geschichten könnte man erzählen, wenn einem nur jemand zuhörte! Carignani hatte das Pech, dass ihm nicht nur jemand zugehört, sondern ihn auch dazu gebracht hat, vor der Kamera zu plaudern, als wäre keine da. So etwas machen auch in der Nationalmannschaft nicht berücksichtigte Fußballer. Carignani aber ist aufgestellt. Er dirigiert morgen Beethovens "Fidelio", seine (vorerst) letzte Frankfurter Premiere. Es besteht die Gefahr, dass sein Verhalten - angesichts des fortgesetzten professionellen Schweigens, zu dem sich die Intendanz in dieser Angelegenheit entschlossen hat - auf ihn selbst zurückfällt. Er steht jetzt da als jemand, der zum Abschied schmutzige Wäsche auf den Boulevard wirft, der sich vorab für ein mögliches Scheitern seiner letzten Premiere entschuldigt und die Verantwortung pauschal abwälzt. Als jemand, der, wenn ihm jemand lange genug zuhört, leichthin über Interna plaudert. Natürlich sind Interna von ganz oben äußerst interessant, wir sind schließlich neugierig und haben genügend niedere Instinkte. Entscheidend aber ist, wie jeder Fußballer weiß, auf dem Platz. Man wird morgen bei der "Fidelio"-Premiere mehr zu hören und zu reden haben als sonst. [ document info ] Dokument erstellt am 30.05.2008 um 16:40:02 Uhr Erscheinungsdatum 31.05.2008 | |
|
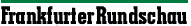


 Ein Chef muss sagen, was er denkt", findet Paolo Carignani, der scheidende GMD der Oper Frankfurt, in einem kleinen Abschiedsporträt, das der Hessische Rundfunk jetzt zeigte. Launisch aber sei er nicht, sagt Carignani, das sei das falsche Wort, "spontan" sei das richtige. Bei all dem wirkt er geschmeidig und lächelt gewinnend, man muss es einfach schade finden, dass er Frankfurt verlässt, sinnend und gut gelaunt geht er durch die Stadt, und die Stimme im Off kommentiert: "Carignani ist sauer, bleibt aber immer noch höflich." Und ein bisschen später: "Carignani fühlt sich allein gelassen."
Ein Chef muss sagen, was er denkt", findet Paolo Carignani, der scheidende GMD der Oper Frankfurt, in einem kleinen Abschiedsporträt, das der Hessische Rundfunk jetzt zeigte. Launisch aber sei er nicht, sagt Carignani, das sei das falsche Wort, "spontan" sei das richtige. Bei all dem wirkt er geschmeidig und lächelt gewinnend, man muss es einfach schade finden, dass er Frankfurt verlässt, sinnend und gut gelaunt geht er durch die Stadt, und die Stimme im Off kommentiert: "Carignani ist sauer, bleibt aber immer noch höflich." Und ein bisschen später: "Carignani fühlt sich allein gelassen."