| |
|

17. März 2008, Nr. 65 / Seite 36
OPER
Selbstzerstörung in Roulettenburg

Aberwitz und Selbsttäuschung: Prokofjews Spieler im Rausch von Spiel und Sekt
© David Baltzer/ZENIT
Alles an dieser Oper ist Tempo, dramatische Sogkraft, Eskalation. Einem einzigen Rausch scheint sie schon ihre Entstehung zu verdanken. Atemlose fünfeinhalb Monate komponierte der sechsundzwanzigjährige Sergej Prokofjew an seiner Dostojewski-Adaption „Der Spieler". Und schenkt man den Prahlereien seiner „Erinnerungen" Glauben, so führte er auch die Instrumentation in einem aberwitzigen Tempo aus: Bis zu achtzehn Partiturseiten am Tag seien während des Sommers 1917 im finnischen Knikkala fertig geworden, kann man dort lesen.
Ein ruhelos vorantreibender Grundduktus prägt denn auch das musikalische Bild dieser radikal antilyrischen, an den Idealen des revolutionären Theaters von Wsewolod Meyerhold und Alexander Dargomychkijs Tradition einer rezitativischen Wort-für-Wort-Vertonung orientierten Oper, deren Libretto sich Prokofjew aus Dostojewskis Dialogen größtenteils selbst zusammenstellte. Auf die Frage, ob man denn - nach dem Uraufführungsskandal der „Skythischen Suite", Prokofjews „Sacre" sozusagen - in seiner Oper keine Extravaganzen zu erwarten habe, stapelte der Komponist in einem Zeitungsinterview tief und antwortete: „Gar keine. Ich strebe nur nach Einfachheit." Wie viel Koketterie in dieser Äußerung mitschwingt, war jetzt in der Berliner Staatsoper Unter den Linden zu erleben.
Spieler unter Strom
Daniel Barenboim setzte das musikalische Kaleidoskop dieser arienlosen Oper, die ihr ganzes Leben allein aus der plastischen Charakterisierung durch knappe, deklamatorische Motive schöpft, so unter Strom, dass an ihrer Exzentrik, ihrem Aberwitz, ihren fieberkurvenartigen Delirien kein Zweifel mehr bestehen konnte. Den musikologisch vielbeschworenen Begriff einer antipsychologischen Objektivität entlarvte der Premierenabend so einmal mehr als ein akademisches Klischee, mit dem der neuen Musiksprache des „Spielers" nicht beizukommen ist. In der artistisch geschliffenen Gestik von Prokofjews Orchester - das war elektrisierend zu hören - steckt eine unbestechlich physiognomische, drastische Charakterisierungskunst. Mit Objektivität hat sie ungefähr so viel zu tun wie herausspringende Federn mit der Definition einer Matratze.
Das erkannt zu haben und ungemein pointenreiche szenische Konsequenzen daraus zu ziehen ist das Verdienst des jungen russischen Regisseurs Dmitri Tscherniakov, der in dieser Koproduktion mit dem Mailänder Teatro alla Scala zugleich als sein eigener Bühnen- und Kostümbildner agiert. Dem Beziehungslabyrinth der in sich vielfältig verstrickten Spielergesellschaft im imaginären „Roulettenburg" entspricht auf der Bühne die nicht minder verschachtelte und ebenso undurchsichtige Architektur eines modernen, scheußlich kobaltblau gestrichenen Hotelkastens: gläserne Drehtüre, Lobby, zellenartige Zimmer mit metallenen Fensterrahmen. Hier ist niemand, was er vorgibt zu sein, mehr noch: Hier weiß niemand mehr, wer er überhaupt ist. Der Marquis ist ein Betrüger, der General ein in Selbstmitleid schwimmender, hochverschuldeter Spieler. Seine Tochter Polina ist dem Marquis auf den Leim gegangen, während sie den Hauslehrer Alexej, den Protagonisten der Oper wie in Dostojewskis Roman, demütigt und vorführt. Blanche ist ein Flittchen, die ihr hübsches Näschen stets dorthin hält, wo sie am meisten Geld riecht.
König der Spieltische
Und Alexej verliert sich auf der verzweifelten Suche nach Identität in den verschiedensten Masken: in der Rolle eines besessenen Liebhabers, der von Polina getäuscht und abgewiesen wird, und in jener eines allmächtigen Königs über Spieltische und Kasinobank, dessen Glückssträhne nie abreißt. Selbst die zunächst so solide wirkende Babulen'ka, auf deren Erbe alle warten, die jedoch, statt zu sterben, die Unverfrorenheit hat, mitsamt einem Leib und Leben bewachenden Potapytsch und zwei kofferschleppenden Fjodors anzureisen und mit ihrem Stock im Hotelfoyer herumzufuchteln - sogar diese so unendlich bodenständig sich gerierende russische Großmutter verliert in Roulettenburg die Haltung und ihr komplettes Vermögen am Roulettetisch.
Dem Prozess eines Außer-sich-Geratens, den Prokofjews Musik vom ersten bis zum letzten Takt so planvoll wie zunächst unmerklich aufbaut, folgt Tscherniakovs Personenregie virtuos bis in die letzte Geste hinein. Das bewegliche Bühnenbild gewährt immer wieder simultane Einblicke in verschiedene, nebeneinander liegende Zimmer und wechselt filmschnittartig die Perspektiven. Man sieht die Figuren in Momenten, da sie sich unbeobachtet glauben, in ihren bisweilen verzweifelten, mitunter skurrilen Selbstfindungsritualen: den General etwa, wie er zirkusreif mit zwei Handspiegeln und einem Kamm jonglierend mit seiner Halbglatze hadert oder versucht, seinen Bauch unter einem Korsett zu verstecken.
Trefflich besetzte Partien
Darstellerisch und sängerisch lässt die Produktion kaum Wünsche offen - bis auf den, Barenboim möge seine sprühende Interpretation vielleicht dynamisch eine Spur zurücknehmen, um den fabelhaft klar artikulierenden Sängern mehr Raum zu lassen. Kristine Opolais spielt die Polina als kühle Blondine in schwarzem Trenchcoat und trifft mit ihrem klaren Sopran alle Nuancen der Partie zwischen Arroganz, Sehnsucht und Hysterie auf das genaueste. Misha Didyk gibt mit kräftiger und beweglicher Tenorstimme einen mitreißend durchgeknallten Alexej. Vladimir Ognovenko charakterisiert den General mit warmer Bassfülle.
Auch die weiteren Partien sind trefflich besetzt mit Stefania Toczyska als Babulen'ka, Stephan Rügamer als Marquis, Silvia de la Muela als Blanche und Viktor Rud als Mr. Astley. Ungemein pointenreich und kurzweilig fliegt dieser Abend an einem vorbei, und bleibt doch nachhaltig haften: ein Wurf, ganz so wie Prokofjews Oper. Dass man die Produktion an der Lindenoper mit nur zwei Vorstellungen angesetzt hat, ist zu schade.
JULIA SPINOLA |
| |
|
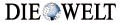
17. März 2008
Prokofieffs "Der Spieler" in der Berliner Staatsoper
Daniel Barenboim entfesselt den hitzigen Sog der Sucht
Von Kai Luehrs Kaiser
Das schnelle Geld. In Russland dachte man, wenn man mondäne Goldgruben beschreiben wollte, im 19. Jahrhundert an Deutschland und seine Kurorte. Dostojewski, in Baden-Baden der Spielleidenschaft verfallen, portraitierte in seinem Roman "Der Spieler" in Gestalt des fiktiven "Roulettenburg" ein deutsches Zocker-Dorado. Wenn heute ein russischer Regisseur Prokofieffs "Spieler"-Oper in Deutschland inszeniert, bieten deutsche Lande jedoch hierfür keine Bilder mehr. Man muss sie nach Russland transferieren.
Die reiche Großtante Babulenka, auf deren Tod alles wartet, verschleudert in der poolblauen Hotel-Lobby von Dmitri Tscherniakovs Bühne ihr Vermögen so reißerisch, dass die Lustige Witwe wie eine knauserige Pensionatsvorsteherin daneben verblassen würde. Merkwürdig, dass diese Oper mit dem Bild eines dekadenten Deutschland nirgendwo großen Anklang fand. Die Berliner Staatsoper verzeichnet seit dem Tod des Komponisten (1953, am selben Tag wie Stalin) nur ein gutes Dutzend internationaler Aufführungen. In Berlin getraut sich Daniel Barenboim gerade mal zwei (!) Aufführungen. Danach wandert die Neuinszenierung an die Mailänder Scala. Ein Jammer - und ein Skandal dazu.
Dabei entfesselt Barenboim, der sich das Stück wünschte und mit ihm debütiert, besonders im 3. und 4. Akt einen hitzigen Sog der Spielsucht. Er, der gerne mit dem Pfefferstreuer dirigiert, entdeckt im gewürzten Klangbild den sozialen Puls eines industrialisierten und technisierten Untergangs. Die entzündeten Rhythmen, in denen der General (Erz-Bass: Vladimir Ognovenko) zuckend Geld verspielt, das er nicht hat, offenbaren musikalischen Verfolgungswahn. Ihm schafft die Berliner Staatskapelle virtuos lärmenden Aplomb. Die Grenze zum Krach wird konsequent überschritten.
Das Publikum der Berliner Festtage quittiert das Dauerforte am Ende jubelnd. Auch wohl, weil man trotz fehlender Stars eine vokal idiomatische Aufführung erlebt hatte. Stefania Toczyska als hell-russische Röhre, Kristine Opolais und Stephan Rügamer bilden ein Pandämonium verlorener Seelen. Die Titelrolle des Alexej kräht Misha Didyk als eine Art Gottesnarr des 20. Jahrhunderts.
Faszinieren darf dieser Abend, weil sich die Wundheit hier rhythmisch panzert und der Luxus umso melancholischer stimmt, je musikalisch packender er uns in die Glieder fährt. Es sind Stimmungen, für welche die Oper überhaupt gemacht wurde - auch wenn Regisseur Dmitri Tscherniakov hier alles wie hinter Glas spielen lässt. Für die schwierige Vorlage findet er kaum mehr als eine geschmackvolle Fassade. Mit der Dramtik von Schaufensterpuppen offenbaren die Sänger, dass hier wenig konzipiert, aber noch weniger inszeniert wurde. Für den Musikdramatiker Serge Prokofieff, dessen Repertoire heute fast auf "Peter und der Wolf", "Cinderella" und die "Klassische Symphonie" zusammengeschnurrt ist, bildet der Abend ein Hoffnungszeichen. Außer der scheinbar burlesken Märchenoper "Die Liebe zu den drei Orangen" und gelegentlichen Kraftanstrengungen mit "Krieg und Frieden" steht es traurig um seine Opern. Der wunderbaren "Verlobung im Kloster" konnte nicht mal die CD-Besetzung mit Anna Netrebko nützen. Der "Feurige Engel", trotz großartiger Aufführungen mit Anja Silja, hat sich nie durchgesetzt. Da potente Zeitzeugen wie Swjatoslav Richter, Oistrach und Rostropowitsch nicht mehr für Prokofieffs Musik werben können, scheitert dieser immer häufiger am Klischee, seine Musik habe etwas Fingiertes und Aufgesetztes. Dabei zeigt Barenboim in Berlin rasend eindrucksvoll, dass Prokofieff den Maschinenduktus einer entfesselten Moderne musikalisch genau traf. |
| |
|
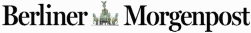
17. März 2008
KULTUR
Barenboim lässt den Rubel rollen
Triumph an der Lindenoper mit Prokofieffs selten gespielter Oper "Der Spieler"
Von Klaus Geitel
"Der Spieler" schien ein für allemal sein Spiel verloren zu haben. Prokofieff, brodelnd vor Erfindungslust und Draufgängertum, war erst 26, als er seine Oper (nach Dostojewskis Roman) niederschrieb. Zehn Jahre später revidierte er sie. Passte sie einigermaßen der herkömmlichen Aufführungspraxis an. Doch noch immer schien ihre Zeit nicht gekommen. Erst jetzt, bei ihrer Aufführung in der Staatsoper, erweist sie sich von Grund auf als Meisterwerk der Originalität, der musikalischen und inszenatorischen Tatkraft und erspielt sich rundum einen Sensationserfolg.
Die einzige bittere Pille: Einstweilen ist nur eine einzige Wiederholungsaufführung (am Ostersonntag) vorgesehen. Dann wandert dies neue Glanzlicht des Berliner Repertoires an die Mailänder Scala ab. Sie ist schließlich Koproduzentin der Aufführung. Außerdem hat auch in ihrem Hause Daniel Barenboim das große musikalische Sagen. Der neue Slogan "Be Berlin" ist offenbar noch nicht an sein Ohr gedrungen.
Alle sind hinter dem Rubel her
Prokofieffs "Der Spieler" ist eine musikdramatische Tollkühnheit in vier Akten. Das Stück schlängelt sich, anfangs ziemlich undurchschaubar, an sich selbst heran. Was will, was soll es eigentlich werden? Sarkasmus nach Noten? Konversationsstück für Musik? Geißelung des Bourgeoisen? Liebestragödie? Es ist immer alles zugleich. Das irritiert zunächst, wenn auch auf immer wieder aufwühlende Weise. 31 Darsteller werden bemüht. Es hagelt Rollen und Röllchen, auch klitzekleine. Die Schauplätze wechseln, nicht gerade am laufenden, doch am still sich dahin schiebenden Band. Dmitri Tscherniakov, der Regisseur, gleichzeitig sein genialischer Bühnenbildner, hat es erfunden und setzt es mit höchst bildhafter Beredsamkeit ein.
"Der Spieler" ist ein Salonstück. In der eleganten Hotelhalle mit ihren schier eisern herumsitzenden, schweigsamen Gästen, sind sie alle daheim, die wie wild hinter den Rubeln, die sie noch nicht besitzen oder gerade verloren haben, her sind: eine Clique der Schleimer und Schleicher, der Liebes- und der Geldgierigen, der feinen Pinkel und der weiblichen Schickeria, einander belauernd, benutzend, ausbeutend. Eine Luxushorde. Beigegeben ist ihr ein Orchester von fantastischem Klangreichtum. Es setzt Herausforderungen nach Noten, und sie alle werden von der Staatskapelle unter dem inzwischen wahrhaft einzigartigen Daniel Barenboim mit Hochglanz, Bravour, schier Ohren sprengenden Ausbrüchen erfüllt. Das Orchester singt sich bei Prokofieff tief in die menschlichen Schicksale ein, und Barenboim deckt sie spürsinnig auf.
Er hat dafür ein glänzendes Ensemble zur Verfügung. Held des Abends ist zweifellos Misha Didyk, ein junger Tenor von schier verzweifeltem Stehvermögen, der alle Lebenslagen, so penetrant sie ihn auch anfallen, mit denkbar stabiler Stimme durchsingt. Mit ihr allein schon hätte er die Bank der Spielhölle sprengen können. Kaum weniger eindrucksvoll die Wiederkehr im Nerz der unvergessenen Stefania Toczyska, der Babulen'ka des Stücks, der alten Dame mit dem Millionenerbe, nach dem alle gieren, die es aber wie zum Trotz im Handumdrehen verspielt. In einem eindringlich stummen Prozess entledigt sie sich nachdrücklich ihrer Brillanten, Ringe, ihres Schmucks, selbst des Pelzes. Nichts bleibt ihr mehr (außer ein paar Dörfern und Häusern, von der Moskauer Wohnung zu schweigen).
Am Ende fliegen die Fetzen
Der Mann, der sie zu allermeist ausschlachten will, ist General Vladimir Ognovenko, ein hochrangiger Soldat in feinstem Zivil mit regierender Stimme, der gleichzeitig hinter dem Geld der Alten wie dem Charme der süßen blonden Silvia de la Muela her ist: beides vergeblich, wie das gnadenlose Leben so spielt. Und da ist auch noch Polina, die Kristine Opolais bewunderungswert singt, ein Rätselwesen aus der Welt Dostojewskis. Stephan Rügamer ist vom Scheitel bis zur Sohle, der flatterhafte Liebes-Marquis; Viktor Rud ein anderer Herr der fragwürdigen Gesellschaft, in der am Ende die Fetzen fliegen. Nichts egalisiert im Handumdrehen derart nachdrücklich wie der Spielverlust. Ihm hat Prokofieff mit seinem "Spieler" ein durchaus einzigartiges musikalisches Monument gesetzt.
Staatsoper, Der Spieler
Bewertung 4 |
| |
|
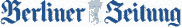
17.03.2008
Panisches Diesseits
Kalt, schlüssig, stark und fies: Sergej Prokofjews "Der Spieler" an der Staatsoper
Von Jan Brachmann
Moralische Appelle sind doch lächerlich. Wie will man sie denn noch erreichen, diese Gehirne aus Vollgummi und diese Seelen aus Bugattiblech: verzinkt, gewichst, lackiert, gewachst?! Da steht der durchgeknallte Hauslehrer Alexej in der Lobby des Hotels und brüllt heraus, wie ihn das alles ankotzt - dieser abgefeimte Erwerbsrationalismus, diese Biografien, die sich streng synchron zum Kontostand verhalten. Und die Umsitzenden befällt die große Gähnsucht - Endstation jenes Zynismus, der auch das Wort "moralinsauer" erfunden hat, um Appelle wie diesen lächerlich zu machen. Mit diesem Zynismus sind die Figuren imprägniert in Dmitrij Tschernjakows Inszenierung von Sergej Prokofjews 1917 vollendeter Oper "Der Spieler", die am Sonnabend an der Staatsoper ihre gefeierte Premiere erlebte.
Die Oper folgt dem gleichnamigen Roman von Fjodor Dostojewskij aus dem Jahr 1866: Eine russische Adelsfamilie ist im deutschen Kurort Roulettenburg gestrandet (als Vorbild gilt Wiesbaden, wo Dostojewskij selbst hohe Summen verspielte). Ein verarmter, alter General wartet auf ein Telegramm, das ihm den Tod seiner reichen Erbtante verkündet. Sein Lebensstil ist kostspielig, da er die junge Französin Blanche aushält. Ein Marquis hilft mit seinem Geld aus und macht sich Hoffnungen, die Stieftochter des Generals, Polina, zu heiraten. In die aber ist der Hauslehrer Alexej verliebt. Doch statt des Telegramms trifft die Alte leibhaftig ein - die Zobel-Oma verspielt das Familienvermögen beim Roulette. Nach dem Bankrott schickt Polina den ihr verfallenen Alexej ins Casino. Er gewinnt Unsummen. Doch zerrüttet von der Käuflichkeit ihres bisherigen gesellschaftlichen Lebens verlässt Polina den Lehrer, der nun der Spielsucht nicht mehr entkommt.
Die ganzen völkerpsychologischen Exkurse Dostojewskijs über deutsche Kapitalbesessenheit und russische Selbstzerstörungsdynamik hat Prokofjew aus seiner eigenen Textbearbeitung verbannt. Und auch Tschernjakow legt auf das Russische des Sujets keinen gesteigerten Wert. Die Architektur, die er auf seiner Bühne entwirft, ist ortlos: ein globalisiertes Niemandsland des Luxus von Hotels, Parfümerien und Duty-Free-Shops, wie es Martin Hecht in seinem Essay "Das Verschwinden der Heimat" vor acht Jahren beschrieben hat. Wenn bei den Figuren die Erinnerung an Russland auftaucht, hört man Geigen und Harfen im Orchester, alte Paradiessymbole. Aber in dieser Inszenierung stehen sie weniger für Russland als überhaupt für die Sehnsucht nach dem unverwechselbaren Ort. "Ich bin in der Fremde, ohne festen Platz, ohne Hoffnung" singt der überwältigende, kraftvolle, spielstarke Tenor Mischa Didyk als Alexej. Und damit ist die Welt um ihn herum zugleich als polierte Hoffnungslosigkeit beschrieben, die vom Morgen nichts, vom Jetzt aber alles erwartet.
Nicht von Ungefähr enthält Tschernjakows Bühne in kleinen Details auch Anklänge an eine Klinik oder einen Knast, folgt aber ansonsten mit ihren blauen Wänden, mit Beton, Glas und Stahl jener geschleckten Geometrie des international style, die das Gegenwartsambiente eines globalisierten Geschäftsnomadentums umreißt. Man sitzt auf sandfarbenen Designersofas und liest die Postillen einer panischen Diesseitigkeit: Vogue, Time Magazine, Vanity Fair, FAZ.
Daniel Barenboim erzeugt dazu mit der Staatskapelle ein verblüffendes, fein ausgetüfteltes und absolut treffendes Pendant: einen Stahlklang, hell, poliert und kühl, der jenen gewerbsmäßigen Luxus der beschriebenen Welt spiegelt, ohne aber Faszination dafür zu zeigen. Es ist eine orchestrale Polemik ohne Schaum vorm Mund, ein nüchtern-kalter Ton, dessen Schärfe in der Präzision, nicht in der Lautstärke liegt. Dass die Distanz am Ende doch fällt und man sich mit der Spielsucht Alexejs infiziert, rührt von der perfiden Suggestionskraft der Musik her: Der silbrige Quirl der Flöten gibt das Kullern der Roulettekugel über die Ziffernkammern wieder, und Prokofjew zoomt mit einer virtuosen Kameratechnik des Orchesters - die Barenboim gekonnt umsetzt - stets wechselnde Vorgänge aus dem Getümmel an den Casino-Tischen heraus.
Eigentlich erfährt man nichts Neues über unsere Gegenwart, aber sie wird mit einer Treffsicherheit und inneren Schlüssigkeit beschrieben, dass einem doch grausige Genugtuung unters Hemd kriecht. Die bewundernswert genaue Arbeit an den Kostümen grenzt an Fiesheit. Stephan Rügamer als Marquis singt nicht nur mit einer (für die Rolle perfekten) schleimigen Coolness, er sieht auch aus wie ein hipper Marktschreier des Neoliberalismus: Jeans, weißes Hemd und ferkelfarbener Kaschmirpulli. Kristina Opolais als Polina legt geschmeidig-kalte Langeweile in den Abwärtssprung ihrer Stimme, wenn sie Alexej verhöhnt und kann sogar den nicht vorhandenen Qualm jener Zigarette spielen, die sie einsam auf dem Hotelzimmer raucht.
Und da hat sich Tschernjakow etwas Starkes einfallen lassen: Weil die Hebebühne und der Schnürboden der Staatsoper kaum noch benutzbar sind, arbeitet er mit einer reinen Horizontalverschiebung der Kulissen. So kann er, wie in einer filmischen Parallelmontage, mehrere Szenen gleichzeitig und nebeneinander zeigen. Während sich die seelisch erloschene Polina mit Mister Astley im Séparée trifft, schreit der General (Wladimir Ognowjenko spielt das mit respektablem Mut zur Selbstentblößung) eine Wand weiter seine Verzweiflung heraus. Im Nachbarzimmer legt gleichzeitig die alte Tante ihren Pelz und ihren Schmuck vor dem offenen Fenster ab - eine fesselnde Szene, weil sie den finanziellen Bankrott mit dem Tod des gesellschaftlichen Körpers dieser Figur verbindet. Alles wird stumm erzählt, so dass auch die Sängerin ohne Stimme auf ihren Körper zurückgeworfen wird, was Stefania Toczynska bewältigt, als hätte sie jahrzehntelange Kino-Erfahrung.
Das Glück über diese ausgesprochen gelungene Produktion war nicht nur der Begeisterung des Publikums, sondern auch den Mitwirkenden auf der Bühne anzumerken. Barenboim und Tschernjakow herzten sich lebhaft beim lauten Schlussapplaus. Und noch hinterm geschlossenen Vorhang hörte man die ausgelassene Freude der Sänger. Schade nur, dass "Der Spieler" am Ostersonntag schon zum letzten Mal läuft und dann nach Mailand an die Scala zieht, bevor er erst im Herbst nach Berlin zurückkommt. |
| |
|

17.03.2008
OPER
Roulette sich, wer kann
Die Staatsopern-Festtage starten mit Prokofjews furioser Dostojewski-Oper "Der Spieler". Daniel Barenboim fühlt den Puls der Musik - eindringlich, bedrohlich.

Liebe in Zeiten der Coca-Colera - Foto: dpa
VON FREDERIK HANSSEN
So funktioniert seit 1992 die Spielplanpolitik an der Berliner Staatsoper – und zwar mit Erfolg: Worauf Chefdirigent Daniel Barenboim Lust hat, das wird gemacht. Immer wieder Mozart, immer wieder Wagner, aber auch Uraufführungen und Entdeckungen. Barenboim, der Weltkünstler, kann sich das erlauben: Wenn sein Name auf dem Programmzettel auftaucht, ist das Haus voll.
Und manchmal überrascht der Maestro tatsächlich mit einer echten Entdeckung – wie jetzt zum Auftakt der österlichen Festtage Unter den Linden. Eigentlich hatte er sich schon in jungen Jahren an der Musik von Sergej Prokofjew satt gespielt; in den Fünfzigern waren dessen virtuose Werke die Paradestücke des Pianistenwunderkinds Barenboim. Jetzt hat sich sein Interesse für den russischen Komponisten neu entzündet, an der Oper „Der Spieler".
1915 beginnt der 24-jährige Prokofjew mit der Vertonung von Dostojewskis Roman, die Beschreibung einer dem Untergang geweihten, dekadenten Gesellschaft passt zur revolutionären Stimmung, die in der Luft liegt. Tatsächlich wird die Partitur in St. Petersburg zur Uraufführung angenommen – die Straßenkrawalle des Jahres 1917 aber erzwingen einen Abbruch der Proben. Nachdem sich das Sowjet-Regime etabliert hat, versucht Prokofjew, den „Spieler" in Moskau herauszubringen; vergeblich: Weil er in Paris lebt, gilt er den Machthabern als Dissident. Erst 1929 kommt das Werk in Brüssel heraus, in französischer Übersetzung. Seit dem Tod des russischen Komponisten 1953 hat es kaum mehr als ein Dutzend Inszenierungen gegeben.
Barenboims samstägliche Premiere ist eine Berliner Erstaufführung – und, wie gesagt, eine echte Überraschung: Das Sujet wirkt, 140 Jahre, nachdem Dostojewski es formuliert, und 90 Jahre, nachdem Prokofjew es komponiert hat, bestürzend aktuell. In dem deutschen Kurort Roulettenburg hat sich eine seelisch bankrotte Society versammelt, die der modernen Ersatzreligion des Mammonismus verfallen ist. Die Liebesgeschichte zwischen Polina und Alexej scheitert, weil die junge Frau einfach nicht glauben kann, dass es tatsächlich Menschen gibt, die uneigennützig handeln.
Regisseur Dmitri Tcherniakov stellt als sein eigener Bühnenbildner die Handlung in einer heutigen Hotellobby nach, im anonymen Ambiente von globalisiertem Chic: Wuchtige weiße Lederfauteuils, türkis gestrichene Wände, viel blitzender Stahl. Ware gegen Geld, so hat es die Russin Polina im Schnellkurs des Turbokapitalismus nach dem Ende des Ostblocks gelernt. Wes Brot ich ess’, dess’ Lied ich sing. Das Typecasting an der Staatsoper ist perfekt: Kristine Opolais gibt die superblonde Neureiche, die mit ihren Angestellten umspringt wie mit Leibeigenen.
„Hauslehrer" Alexej ist so unsterblich in sie verliebt, dass er auf einen Wink von ihr töten würde? Okay, dann soll er zur Übung schon mal die Baronin Wurmerhelm beleidigen. Misha Didyk, breitschultrig, kugelköpfig, mit starken Wangenknochen, wie sich Dostojewski seinen Tataren Alexej vorgestellt hat, gehorcht. Doch jede Faser dieses Körpers kündet von der Wut des gedemütigten Akademiker-Prekariats: Er hat studiert und findet sich trotzdem ganz unten in der Klassenhierarchie wieder. Doch er weiß sein Aufbegehren nicht anders zu kanalisieren, als selber zum Roulettespieler zu werden: Wenn ich erst so viel Kohle habe wir ihr, werdet ihr mir schon Respekt zollen müssen! Alexej sprengt die Bank, doch nicht das Herz seiner Polina. Als er ihr den Gewinn bringt, fühlt sie sich gekauft, wirft ihm die Scheine ins Gesicht. Vorhang.
Düstere, bedrohliche Musik hat Sergej Prokofjew zu dieser Liebe in Zeiten der Coca-Colera geschrieben, und Daniel Barenboim reizt sie mit der sensationell eindringlich spielenden Staatskapelle voll aus: „Der Spieler" ist eine Literaturoper, die den Prosatext in Parlando, in Sprechgesang überträgt, grundiert von einem atmosphärisch ausdeutenden, oft filmmusikhaften Orchesterkommentar. Prokofjew war stets ein virtuoser Instrumentator, sein Stil ist elegant, großstädtisch, klingendes Art Déco, edle Materialien, streng gefasst, edelmetallschimmernd, aber eben auch ein wenig seelenlos. Ununterbrochen treibt ein starker Puls das Geschehen vorwärts, schnell wechseln die Stimmungen, huschen Schatten vorbei, blitzen Erregungen auf, Erdtöne dominieren, die tiefen Register der Bläser, dunkle Streicherfarben.
Eine herausfordernde, anstrengende Spielart der Kunstform Oper ist das, zumal wenn der Sprachunkundige die Übertitel mitverfolgen will. Doch hat man sich einmal eingehört in diese Partitur, geht von dieser Musik eine Sogwirkung aus, zumal wenn ein Starkstrommusiker wie Barenboim im Graben waltet.
Tcherniakow versucht nicht, noch eins draufzusetzen, die Regie des 37-Jährigen bleibt zweckdienlich, präzise gearbeitet im Stil von Harry Kupfer, mit klar definierten, unzweideutigen Charakteren, wenngleich in der Personenführung noch nicht so routiniert wie beim Altmeister des realistischen Musiktheaters. Die Solisten lassen sich gerne derart leiten, füllen ihre Figuren stimmlich in vorformulierter Weise auf: Stefania Toczyska zeigt die reiche Erbtante als gnadenlose Matriarchin, so dass einem Vladimir Ognovenko, der ohne den rettenden Geldfluss gesellschaftlich vernichtete General, in seinem bassbebenden Elend fast leidtun kann. Stephan Rügamer stattet den falschen Marquis mit tenoraler Hinterhältigkeit aus, Silvia de la Muela ist eine superzickige Edelkurtisane Blanche. Einhelliger Jubel für Barenboim, sein vielköpfiges, hochkarätiges Ensemble und den rührend aufgeregten Tcherniakov.
Eine Inszenierung, die man sich merken muss: Nach nur einer einzigen Wiederholung am Ostersonntag im Rahmen der hochpreisigen Festtage heißt es für diese Spielzeit bereits: Rien ne va plus. Normalsterbliche bekommen den „Spieler" erst in der nächsten Saison zu sehen. |
| |
|

18.3.2008
Im neuen Moskau
Präzision und Klangschönheit: In den nervtötend blauen Kulissen von Dimitri Tcherniakovs Inszenierung entdeckt Daniel Barenboim in Prokofjews "Der Spieler" einen hörbar effektvoll und raffiniert geschliffenen musikalischen Edelstein
VON NIKLAUS HABLÜTZEL
Mag sein, das neue Moskau sieht auf so lieblos billige Art teuer aus wie das Hotel, das Dimitri Tcherniakov auf die Bühne der Staatsoper gestellt hat. Blaue Wände, weiße Klubsessel, eine gläserne Drehtür. Verschiebt sich das Arrangement zur Seite, werden ebenso scheußliche Einzelkammern und Flure sichtbar. Hier also treffen sich die Süchtigen des Roulettes und tragen immer noch Abgründe dostojewskischer Seelen mit sich herum. Zu sehen ist nichts davon. Tcherniakov ist in seiner russischen Heimat ein vielgerühmter Regisseur, doch bei Sergej Prokofjews in Berlin überhaupt zum ersten Mal gespielter Oper "Der Spieler" scheint ihn die szenische Fantasie verlassen zu haben. Drei Akte lang geschieht buchstäblich nichts in den nervtötend blauen Kulissen. Eine Handvoll Menschen jagen einem Glück hinterher, das sie nicht gewinnen können, schlagen sich die Zeit tot mit Liebesaffären, die auch nur eitle Selbsttäuschungen sind.
Anzeige
Erst im vierten, dem letzten Akt gewinnt dieses tiefgefrorene Theater Leben. Alexej, der unglücklich verliebte Hauslehrer im Dienste eines altersgeilen Generals und Erbschleichers, knackt die Spielbank, die jetzt zum ersten Mal auf der Bühne zu sehen ist, auf der nun ein halbes Dutzend Solisten und der Chor ein wild taumelndes Rondo der Geldgier aufführen. Doch der Rausch ist bald vorbei, in Alexejs Kammer kehrt die Langeweile des neuen Russland von Dimitri Tcherniakov zurück. Polina, die Geliebte, möchte sich, beleidigt vom schnöden Geld, mit dem sie der Spieler überhäuft, am liebsten aus dem Fenster stürzen. Aber es geht nicht, weil es sich nicht weit genug öffnen lässt …
Gäbe es nur das zu sehen, möchte man wohl auch die Flucht ergreifen. Doch diese Aufführung ist vor allem die Inszenierung von Daniel Barenboim, seiner Staatskapelle und von Sängern, deren Namen man sich unbedingt merken muss. Allen voran der ukrainische Tenor Misha Dydik in der Rolle des Alexej und seine Partnerin, die junge Lettin Kristina Opolais als Polina, dazu der prachtvolle russische Bass Vladimir Ognovenko als General und die Polin Stefania Toczyska in der Rolle der Alten Babulen'ka, die ihr Vermögen lieber selbst verspielt, als es den Heuchlern dieser feinen Gesellschaft zu vererben.
So bleibt man sitzen und ist manchmal sogar froh darüber, dass auf der Bühne nichts geschieht, was die Konzentration auf die Musik stört. Sie wird unter Barenboim zu einem Ereignis ganz eigener Art. Denn zweifellos ist Prokofjews Werk weder das, was man "große Oper" nennen möchte, noch ein Dokument revolutionärer Moderne. Sie ist ein Kaleidoskop kontrastreicher, leicht fasslicher, plastisch und farbig instrumentierter Motive, deren einziger Zweck es ist, Dostojewskis Text singbar zu machen. Nicht auf das große Gefühl kam es an, sondern auf dramatisch wirkungsvolle Wiedergabe von Dialogen.
Barenboim nimmt diese Werkstatt ganz sachlich unter die Lupe und lässt mit schier unglaublicher Präzision und Klangschönheit all die Einzelteile erklingen, aus denen das Werk zusammengebaut ist, das man eher eine musikalische Skulptur nennen möchte als ein Stück des Musiktheaters: ein überaus effektvoll und raffiniert geschliffener Edelstein, der keine großen Auftritte zulässt, sondern von allen Mitwirkenden gleichermaßen verlangt, immer neue Aspekte des einen Themas zu zeigen, das allem zu Grunde liegt: die Selbsttäuschung des Menschen durch die Illusion seiner Gefühle.
Dankbar für so viel leidenschaftliche Sorgfalt nimmt man zu Kenntnis, dass unter Barenboims Händen ein vollkommen originelles, zu Unrecht aus den Spielplänen beinahe verschwundenes Meisterwerk wieder ins Bewusstsein geholt wird. Originell deswegen, weil ist es offenbar gerade nicht die notorische, psychologische Tiefe der literarischen Vorlage ist, die Prokofjew angeregt hat. Vielmehr scheint ihn ihre syntaktische Struktur fasziniert zu haben. Sie erzeugt in seiner Übersetzung des Romans in musikalische Deklamation eine seltsam kühle Distanz zu den menschlichen Tragödien, von denen sie handelt. Seine Musik lässt sie uns nicht mitfühlen, sondern auf unterhaltsame, gelegentlich komödiantische Art verstehen.
Mag sogar sein, dass Dimitri Tcherniakov in der Zusammenarbeit mit Barenboim gespürt hat, dass er dieses bei aller lautstarken Farbigkeit subtile Wunderwerk nicht durch allzu viel Theater stören sollte. Weil es so sein könnte, nimmt man ihm am Ende sein blaues Elend auf der Bühne nicht mehr übel. Es mag ein immerhin plausibler Reflex auf Prokofjews Reduktion des Gefühls auf musikalische Grammatik sein. Dass der verdiente, langanhaltende Applaus für Barenboim kaum nachließ, als auch der Regisseur an die Rampe trat, lässt immer darauf schließen, dass das Premierenpublikum es so sehen wollte. |
| |
|

18. März 2008
"Der Spieler"
Das Prinzip Überwältigung
VON JÜRGEN OTTEN

Das Sein ist das Nichts: Kristine Opolais als Polina, Misha Didyk als Alexej und Stephan Rügamer (l).
(dpa)
Mit den Opern Sergej Prokofjews verhält es sich, nimmt man "Die Liebe zu den drei Orangen" als Teil des Kanons heraus, wie mit einer fernen Geliebten. Man kennt sie wohl, weiß um ihre hochmögenden Eigenschaften, aber man sieht sie nur selten und verliert sie deswegen irgendwann aus dem Sinn. Der wesentliche Grund hierfür liegt im Falle von Prokofjew in der mangelnden Fairness der Rezeption, die ein Werk, ist es einmal in der Versenkung verschwunden, kaum mehr hervorzuholen sich wagt. Hinzu kommt, dass es an Sängern fehlt, die imstande wären, die zum Teil haarsträubend schwierigen Partien zu bewältigen.
Allein deswegen muss man im Fall der Oper "Der Spieler", die zum Auftakt der Festtage an der Berliner Staatsoper Unter den Linden in der revidierten Fassung aus den Jahren 1927/28 Premiere feierte, von einer glücklichen Wiederbegegnung sprechen. Ein Werk steht hier vor uns, das ist wie der Titel einer anderen Oper Prokofjews, "Der feurige Engel": ein Fiebertraum in Tönen und Akkorden, der nur eine Richtung kennt - hin zum Fegefeuer, hin zum Abgrund, zur Hölle. Immer rasender, furienhafter wird diese Musik, immer obsessiver, wahnsinniger, bis sie am Ende in einer Art Explosion alles, was da ist an Hoffnung, hinwegfegt.
Daniel Barenboim kennt diesbezüglich keine Gnade. Er arbeitet mit der Staatskapelle Berlin auf dieses apokalyptische Ende hin. Von Beginn an haben die Klänge aus dem Orchestergraben etwas metallisch Kaltes, Unruhiges, Drängendes, Unheilvolles. Die Streicher wollen sich selbst in den singbaren Legatolinien nicht dazu entschließen, "schön" zu spielen, die Bläser, zumal das Blech, setzt sogleich auf Schroffheit, Aufgerautheit, auf bruitistische Tendenz. Als genüge ihm das nicht, verwendet Barenboim statt der sanften deutschen die weit schärferen amerikanischen Trompeten. Was er damit bezweckt, liegt auf der Hand: Diese Oper, deren erste Version Prokofjew zwischen 1915 und 1917 komponierte, zur Zeit der "Skythischen Suite", soll in der Moderne verortet sein: eine Art russischer "Wozzeck".
Die Parallelen beider Werke sind - nicht auf den ersten Blick - evident. Auch was die Personen angeht. Dort ist es Hauptmann Wozzeck, der alleine ist. Hier ist es Alexeij, die Titelfigur. Ein Mensch, der Qualen erleidet, trifft er auf die Gesellschaft. Sein Selbst ist gebrochen, und nur eines hilft ihm aus diesem fragilen Zustand hinaus: Er gibt den Clown, den Spieler, den Aufrührer, den neurasthenischen Harlekin. Prokofjew hat die Partie für einen Tenor komponiert, und als wolle er ihm das gesamte Gewicht der Welt auf die Schultern legen, hat er diese Partie mit mörderischen Schwierigkeiten gespickt. Misha Didyk bewältigt die Anforderungen in einer so ungeheuer souveränen Art und Weise, dass man beinahe von einer Sensation sprechen muss. Nicht nur zeigt er sich in der Höhenluft unangestrengt, auch gestaltet er die weit gefassten Linien des Alexej mit einer farblichen Variabilität, Intensität und vor allem Kontinuität (will sagen: Ausdauer), die schlicht betört.
Nichts ist wie es scheint
Regisseur Dmitri Tcherniakov, der auch für Bühnenbild und Kostüme verantwortlich zeichnet, hat ihm den Stoff des Alltäglichen zugemutet: beige Cordhose, schwarzweiße Turnschuhe, graues Hemd. Nicht unbedingt Kleider, die einer trägt, der die Welt im Handstreich erobern möchte. Wie ein Tourist sieht Alexej aus, damit wie ein Fremdkörper in der Lounge des Hotels, das Tcherniakov als Spiel(er)ort ersonnen hat.
Man trägt hier vorwiegend feinen Zwirn (die Herren), elegant geschnittene Kleider (die Damen), und man trägt eine Nonchalance zur Schau, die ihresgleichen sucht. Jeder flirtet mit jedem, manche etwas deutlicher als andere, aber irgendwie gehört man doch einem Club der Auserwählten an, der sich in Roulettenburg, dieser von Dostojewski imaginierten Stadt, trifft, um der Muße und dem Hedonismus zu frönen; die großformatigen weißen Möbel passen dazu. Doch schon die Farbe der Lounge lässt tiefer blicken: ein penetrantes Blau, ins giftig Grüne changierend. Gerahmt wird dieser Käfig von kalt schimmernden Stahlsäulen und Glaswänden, eine Drehtür führt nach draußen. An den Seiten befinden sich jeweils die Hotelzimmer in identischer Ausstattung. Die Idee: Während die Lounge als Ort des Außen figuriert, suchen die Personen in den zellenartigen Zimmern nach ihrem Innern, sie entblößen sich dort, und dies meist mit erschreckendem Ergebnis.
Denn nichts ist, wie es scheint, das ist spätestens seit dem Erscheinen der Babulen'ka (Stefania Toczyska mit eindrücklichem Mezzo) virulent. Und keiner, wie er vorgibt, zu sein. Das Sein ist das Nichts. Und dieses Nichts tritt mit jedem Takt konturierter, unerbittlicher hervor. Darin liegt die Überzeugungskraft dieser Inszenierung, damit wird jene fiebrige Stimmung erzeugt, die den Zuschauer überkommt, schließlich überwältigt: Je stärker der Biss der Musik, je zudringlicher der Wahn wird, umso mehr flippen auch die Menschen auf der Bühne aus, nicht nur Alexej. Am deutlichsten zeigt sich das beim General, den Vladimir Ognovenko herausragend spielt und ebenso singt.
Ganz der Galan der alten Schule, hat er anfangs charmiert, wo es nur ging und erlaubt war. Nun, da die Wahrheit ans Licht gekommen ist, ist er nicht mehr als ein menschliches Wrack. Und ebenso Polina (phantastisch: Kristine Opolais). Aus der coolen Blondine in High Heels und schwarzen Designerkleidern ist jetzt, da sie zwischen dem Marquis (Stephan Rügamer) und Alexej zerrieben wurde, ein Häufchen Elend geworden.
Da nützt es auch nichts, dass Alexej im Spielsalon, aufgepeitscht von den Kombattanten der Sucht (ein hervorragend geführter Chor der Lindenoper), in den Rausch sich hinein siegt, die Katastrophe ist unausweichlich. Immer wieder setzt Alexej, weil er liebt, auf die gleiche Farbe, auf die eine Farbe Rot, er will mit diesem Rot die Liebe erzwingen. Einen Augenblick besteht sogar die Möglichkeit dazu. Alexej und Polina kommen noch einmal zusammen, vereinigen sich. Aber genau das ist der Moment, wo alles auseinander fliegt: die Lust, die Liebe, vielleicht sogar das Leben.
Sei dem so, mit der Oper "Der Spieler" ist eine faszinierende Wiederentdeckung gelungen, die ferne Geliebte erobert.
Staatsoper Berlin: nächste Aufführung am 23. März.
[ document info ]
Copyright © FR-online.de 2008
Dokument erstellt am 17.03.2008 um 17:12:02 Uhr
Letzte Änderung am 17.03.2008 um 17:52:08 Uhr
Erscheinungsdatum 18.03.2008 |
| |
|

16.3.2008
Anti-Oper in Berlin
Dmitri Tcherniakow inszeniert Prokofjews Oper "Der Spieler"
Von Georg-Friedrich Kühn
Der russische Regisseur Dmitri Tcherniakow hatte im Winter 2005 an der Staatsoper Unter den Linden eine viel beachtete Inszenierung von Mussorgskis Boris Godunow abgeliefert. Nun hat er sich an ein schwieriges, selten gespieltes musiktheatralisches Werk gewagt: Sergej Prokofjews Oper "Der Spieler", nach dem autobiographisch inspirierten Roman von Fjodor Dostojewski. Prokofjew hat eine Art "Anti-Oper" daraus gemacht.
Alles wartet: auf die Nachricht vom Ableben einer vermögenden Alten. Es gilt zu erben, Schulden zu tilgen. Eine verschworene Gesellschaft von Spielern, Spekulanten sitzt da auf der Bühne in dicken Fauteuils in einem blauen, verspiegelten Salon mit Bar-Tresen: Der General, der schon sein ganzes Geld verspielt hat und mit jungen Frauen flirtet. Sein Freund, der Marquis, der ihm immer mal wieder ausgeholfen hat und von seiner Stieftochter Polina umschwärmt wird. Alexej, der Hauslehrer, der in Polinas Auftrag eine Summe am Spieltisch verzockt hat, und in sie verliebt ist.
Sergej Prokofjew komponierte seine "Spieler"-Oper nach dem Roman von Dostojewski zwischen 1915 und 1917. Obwohl mit dem Studium fertig, hatte er sich noch mal am Petersburger Konservatorium eingeschrieben, um dem Militär zu entkommen. Die Pläne für eine Uraufführung seiner ersten großen Oper mit Wsewolod Meyerhold als Regisseur zerschlugen sich durch die Revolution. Das Mariinski-Theater kam unter künstlerische Selbstverwaltung; und die strich das sperrige Stück vom Plan.
Prokofjew versucht in dieser Partitur einen an Mussorgski orientierten, harmonisch geschärften Deklamationsstil. Er verzichtet weitgehend auf melodische Strukturen, konstruiert ein musikalisches Feld aus Klangfarben und rhythmischen Mustern. Und die Leuchtkraft dieser Partitur plastisch zu vergegenwärtigen gelingt Daniel Barenboim am Pult mit der Staatskapelle Berlin und der großen Zahl von Solisten mustergültig. Überragend Misha Didyk mit einem kraftvoll strahlenden Tenor als Alexej und Kristine Opolais als Generalstochter Polina.
Der junge russische Regisseur und Ausstatter Dmitri Tcherniakow akzentuiert in seiner szenischen Einrichtung das filmische Moment in Prokofjews Partitur. Auf einen Bühnenwagen hat er ein wie ein Filmstreifen verschiebbares Bühnenbild bauen lassen mit einer großen Halle in der Mitte und kleineren Räumen an beiden Seiten. Beschränkt Tcherniakow sich in seiner Personenregie in den beiden ersten Akten auf zweidimensionale Bewegungsmuster entlang der Rampe, kommt mit dem Auftritt der von ihrer Krankheit genesenen Alten, der Babulen'ka, auch die dritte Dimension mehr ins Spiel.
Die Alte entdeckt nun auch ihre Lust am Roulette, verspielt ihr ganzes Vermögen. Den großen Katzenjammer nutzt Alexej. Tollkühn mit neuem Einsatz sprengt er die Bank, um mit dem gewonnen Geld Polina endlich für sich zu gewinnen.
Man sitzt lange etwas ratlos vor dieser Oper, die über weite Strecken als endloses Konversationsstück daher kommt und am Ende eine Moral präsentiert, die so neu nicht ist: die Frage, wie viel Macht der Mensch hat über sein Schicksal. Regisseur Tcherniakow beantwortet sie mit seiner Dolmetscherin so: Eigentlich - der Mensch hat keine Macht über sein Schicksal. Überhaupt nicht. Wir kennen uns nicht, wir wissen nicht, welche Abgründe in uns sind.
Die Oster-Festtage der Berliner Staatsoper hatten mit dieser Prokofjew-Premiere zwar einen höchst eindrucksvollen, vom Publikum heftig akklamierten Auftakt. Ob der "Spieler" fürs Repertoire heute zurückgewonnen werden kann, steht dahin. Zum einen ist es ein sehr personenreiches Stück, das einen aufwendigen Apparat erfordert. Zum anderen werden große Vermögen heute nicht mehr am Roulette-Tisch sondern in Hinterzimmern von Banken und an Computern verzockt. Sehr viel unauffälliger, unsichtbarer, wenn auch nicht weniger schmerzhaft.
© 2008 Deutschlandradio
|
| |

17 marzo 2008
La scommessa vinta di un Prokof'ev raro
La Staatsoper di Berlino ripropone il raro "Giocatore" di Sergej Prokof'ev. Convince il moderno ed asciutto allestimento del russo Tcherniakov coprodotto con la Scala di Milano, dove lo spettacolo arriverà in giugno. Splendida la direzione di Daniel Barenboim che ottiene prove superlative dalla sua Staatskapelle Berlin e dai numerosi interpreti. Accoglienza trionfale del pubblico.

Misha Didyk Alexej e i giocatori (atto 4)
Foto: Monika Ritterhaus
Scommessa vinta quella della Staatsoper che ripropone il raro "Giocatore" di Prokof'ev, opera di giovanile vitalità e tuttavia non priva di qualche lungaggine. Il regista Dmitri Tcherniakov, anche autore di scene e costumi, cancella sfarzi termali tardo-ottocententeschi dell'originale Roulettenburg dostoevskiana e porta l'azione nell'anonima e asettica contemporaneità della hall di un business hotel, dove bivacca un'umanità che assiste inerte alle progressive tappe dell'annichilimento dei protagonisti ed alle loro catastrofi. Tcherniakov opta per una direzione asciutta ed analitica non priva di una ironia leggera, dal taglio decisamente cinematografico, evidente negli scivolamenti laterali "a carrello" della scena che svela le stanze vuote, metafora del vuoto esistenziale di individui per i quali il denaro è l'unica misura del mondo. Dalla buca, Daniel Barenboim tiene le fila del complesso discorso musicale e contribuisce in maniera determinante a costruire una drammaturgia implacabile, appassionante, che trova il suo culmine nella vorticosa ed inesorabile scena della roulette del quarto atto. Barenboim impone pulizia e rigore e li ottiene in primo luogo dalla perfetta Staatskapelle Berlin, flessibile, precisa, capace di agogiche da vertigine. Non sono da meno i numerosissimi protagonisti, che sarebbe impossibile citare singolarmente, e dallo Staatsopernchor. Non è possibile però non elogiare l'Alexej di Misha Didyk per la smagliante prova non solo vocale, la nevrotica Polina di Kristina Opolais capace di rendere con profondità il ruolo forse più complesso dell'opera, l'elegante Marquis di Stephan Rügamer, il Generale di Vladimir Ognovenko e la Babulen'ka di Stefania Toczyska, ammirevoli per l'equilibrio fra leggerezza e malinconie crepuscolari. Accoglienza trionfale.
Stefano Nardelli |
| |