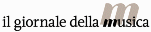|
OHNE NEUE OPER Zur Uraufführung von "La grande magia" am 10. Mai 2008 Die Geschichte Wie schnell kann es gehen, dass einer Liebesheirat Enttäuschung und Vereinsamung folgen. Calogero ist es nicht gelungen, aus der Sängerin Marta eine glückliche, bürgerliche Ehefrau zu machen. Jeder ersehnt sich vom anderen, was der nicht geben kann. Während einer inszenierten Zaubervorstellung verschwindet Marta. Das bringt den Zauberer Otto Marvuglio in Nöten. Getreu seiner Lebensweisheit "Hinaus aus dem grauen Alltag, hinein in die geheimsten Wünsche der Seele und das Glück erkennen" hat er Marta durch einen Zaubertrick den Argusaugen ihres Ehemanns Calogero entzogen. Nur für einen Augenblick sollte der sie allein treffen wollende Mariano seine Chance bekommen. Doch Marta kehrt nicht zurück. Während sie an Lebenserfahrung gewinnt, lebt Calogero in einer Illusionswelt. Otto hat für ihn die Theorie der nicht vergehenden Zeit und der nicht verschwundenen Marta entwickelt. Diese soll sich verzaubert in einer Schatulle befi nden, von der sich Calogero nicht mehr trennt. Nur, wenn er sie mit wahrem Glauben an Liebe und Treue öffnet, würde er Marta darin fi nden – sagt Otto. Calogero hält die Schatulle verschlossen und ist mit dem Sinnbild seiner idealen Liebe glücklich. Als Marta leibhaftig zurückkehrt, scheut er vor der Realität zurück. Was ist der große Zauber? MANFRED TROJAHN: Am Ende wohl ein fauler Zauber! (Ich freu mich schon jetzt auf den Kritiker, der diesen Satz als Zitat benutzt)CHRISTIAN MARTIN FUCHS: Am Ende sind die Hände des Zauberers leer. Was der Zauber gewesen sein mag, weiß man erst, wenn alles vorbei ist.JONATHAN DARLINGTON: Das zauberhafteste Ereignis muss die Empfängnis und Geburt eines Kindessein. ALBERT LANG: Eine Oper über Wirklichkeit und Illusion – sicher. Aber auch eine Oper über die Wirklichkeit der Illusion, ohne die ihr die unbedingte, verführerische Kraft fehlen würde. Und nach welchem Maß können wir Illusion und Wirklichkeit scheiden? Zauber überall? Zauber in der metaphorischen Kraft einer Verblendung? Eine Suche ohne Ende!ROSALIE: Fantasie im Kopf / Merlin, Fantasie, Alchemie / im "Zauberberg".Wie halten Sie’s mit der Magie? MANFRED TROJAHN: Ich bin an allem Magischen völlig uninteressiert.CHRISTIAN MARTIN FUCHS: Die Frage ist aporetisch: Wäre ich Magier, verriete ich es nicht; glaubte ich daran, ebenso wenig; negierte ich die Magie, würde ich sie damit erst recht anerkennen; deshalb ist bloß eine negative Antwort möglich und infolgedessen auch nicht aussagekräftig. Vergleichbar der Frage: Glauben Sie an Wunder.JONATHAN DARLINGTON: Wenn man bereit ist, die Welt durch Kinderaugen zu sehen, umgibt uns überall Magie.ALBERT LANG: .... Was Magie sein kann – ja, eine schwere Frage für ein wissenschaftliches Zeitalter.Vielleicht das, was zwischen einem Gedanken und seiner Erscheinung anhebt – man denke an die plastische Kunst, die Form, der Gedanke, isoliert genügen sie nicht, man denke an einen musikalischen Gedanken und seinen Ausdruck, dazwischen hebt das Unerklärliche an – Magie in der Kunst. Magie als fester Bestandteil jeden Lebens. ROSALIE: Magie verzaubert = Illusion, in die man sich manchmal (selbst) hinein wünscht / Magie kann jemand "besitzen" – vielleicht (auch nicht) / Wie Dr. Faustus mit der Religion – durch Mahlers Achte dividiert.Was ist italienisch am Stück außer dem Titel? MANFRED TROJAHN: Die Namen einiger Protagonisten ... und natürlich Aspekte der Musik.CHRISTIAN MARTIN FUCHS: Die Familie in ihrer unentrinnbaren, kleinbürgerlichen, geschwätzigen und schicksalshaften Dämonie. Die Weltgeschichte ist, wie die Italiener besser als wir wissen, stets Familiengeschichte und von diesem Standpunkt aus unendlich komisch.JONATHAN DARLINGTON: Die Di Spelta-Familie könnte problemlos eine Mafi afamilie mit einer italienischen Mutterfi gur schlechthin sein.ALBERT LANG: Italien – ein weites Land – mancher war nie da und hat es in sich. Warten wir es ab.ROSALIE: Alles nach Pirandello / Namen, Ambiente, Flair, Dekadenz / fast alles wie "Cantata dei giorni dispari".Wird aus Lügen, Träumen, Zauberei und Einsamkeit schließlich Größenwahn? MANFRED TROJAHN: So etwas mag es geben, bei den Figuren in meinem Stück kann ich das nicht entdecken.CHRISTIAN MARTIN FUCHS: Sie haben die Liebe vergessen!JONATHAN DARLINGTON: Man muss sich heutzutage nur bestimmte politische Daten ansehen um zu begreifen, dass "Größenwahn" – wie es die englische Übersetzung besagt – teilweise auf Lügen, Täuschung (und dabei meine ich die Illusion von Täuschung, wie es beispielsweise von Otto praktiziert wird), Einsamkeit, falschen Träumen… all den Grundbestandteilen für menschliches Elend basiert.ALBERT LANG: Die Scheidewand zwischen Größe und Größenwahn wurde zu Zwecken der Abgrenzung meistens nach einschneidenden Ereignissen gezogen – sie zeichnet sich eher als Setzung denn als "Erkenntnis" aus. Die Suche nach Größe um jeden Preis darf sich vielleicht vom liebenden Erforschen des eigentlichen Inhalts einfach nicht trennen.ROSALIE: Im Auge des Betrachters vielleicht?! / Lüge ist nicht mit den anderen Stichworten zu verbinden. Alles andere könnte im großen Wahnsinn enden. / Die Frage wird zum zeternden Mosaik einer anderen Frage-Figur als Antwort: Was ist es, dass der Mensch nichts als stiehlt, hurt und mordet ... &? (G. Büchner)
"VIELLEICHT HABE ICH ERREICHT, WAS ICH WOLLTE." ILSEDORE REINSBERG: Wie viel Jahre vergehen in der Regel zwischen der Lust auf ein neues Musiktheaterwerk und der Uraufführung?MANFRED TROJAHN: "La grande magia" hat mich viele Jahre beschäftigt. Ich habe 1999 einen Librettoentwurf für einen ersten Akt geschrieben, noch nahe am Schauspiel orientiert und vornehmlich, um einmal zu sehen, wie ich die große Textmenge bewege, die das Orginalstück braucht. Bevor ich mit Christian Martin Fuchs an dem Stück gearbeitet habe, komponierte ich die "Limonen aus Sizilien", einen Zyklus von drei Kammeropern und die Rezitativtexte zu Mozarts "La clemenza di Tito". Wir haben dann seit 2003 sehr intensiv an dem Libretto gearbeitet und 2006 habe ich mit der Komposition begonnen. Erfahrungsgemäß gibt es einen sehr zögernden Arbeitsbeginn bei meinen Opern, eine erste Szene kann ein Jahr brauchen und die letzte, die vielleicht genauso lang ist, braucht drei Wochen...ILSEDORE REINSBERG: Sie hat mit dem Schauspiel von Filippo ein Stoff gereizt, der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden ist. Wie erklärt sich aus Ihrer Erfahrung, dass die Libretti für zeitgenössische Opern häufi g nicht auf einen aktuellen Stoff bzw. Gegenwärtigen Autor zurückgreifen, sondern die zeitliche Distanz bzw. den größeren geschichtlichen Abstand bevorzugen.MANFRED TROJAHN: Eine wichtige Voraussetzung für mich ist es, dass ein Stoff wirklich nach den Bedürfnissen der Oper eingerichtet werden kann. Zeitgenössische Autoren, die sich diesen Bedingungen unterwerfen wollen, gibt es nicht an jeder Ecke. So ist Christian Martin Fuchs der erste Schriftsteller, mit dem ich eine Oper habe entwickeln können. Die anderen Librettisten waren Dramaturgen und die Qualität der Sprache stand nicht so sehr im Vordergrund ihres Interesses. Selbstverständlich nähert man sich einem Stoff immer von einem aktuellen, oder besser zeitgenössischen Standpunkt aus. Ich wüsste nicht, was zum Beispiel meine Oper "Was Ihr wollt" über die Zeit Shakespeares erzählt, sie vertritt einen ganz heutigen Blick auf die Verwirrungen. Dazu muss ein Stück nicht unbedingt im Großraumbüro oder im Asylantenheim spielen. Was mir wesentlich scheint ist eine Ent-zeitlichung eines Stoffes, möglichst bis in die Details hinein. Nur ein entzeitlichter Stoff kann dem heute so wichtigen Bedürfnis nach einem Gegenwartsbezug nachkommen. Die Gegenwart von heute ist ja morgen die Vergangenheit, und wenn man ein Stück immer gegenwärtig deuten will, ohne dass ihm Wesentliches verloren geht, dann sollte es zeitneutral sein. Die zeitliche Bindung durch Utensilien ist immer eine Hypothek für die Interpretation, weil es eben sehr mühsam ist, den Fechtkampf im "Don Giovanni" durch eine Auseinandersetzung mit Schlagringen – wie sie für bestimmte soziale "Milljöhs" heute typischer ist, zu ersetzen ...Generell meine ich, dass es wirklich eher die Accessoires sind und nicht die Psychologie der Personen, die einen Stoff veralten lassen. Daher kann man durch das Neu-Erzählen eines Stoffes eine Aktualität herstellen. Ganz sicher aber nicht durch zeitgemäße Accessoires, denn dadurch wären wir ja in fünf Jahren wieder in der gleichen Falle. Wir sehen das, wenn wir in Theatern mit langlebigem Repertoire die aktualisierenden Inszenierungen von vor 15 Jahren bewundern dürfen und uns dabei schlagartig die Vergänglichkeit von Modischem deutlich wird. ILSEDORE REINSBERG: Wie ist Ihr Verhältnis zum Text? Nehmen Sie während des Komponierens Veränderungen am Text – mit oder ohne Rücksprache mit dem Librettisten – vor?MANFRED TROJAHN: Meine Art, Opern zu komponieren, fordert der Musik eine große Nähe zur Sprache ab. Ich bin daher oftmals genötigt, Sprache so zu formen, dass der musikalische Fluss trotzdem seine Eigenart behaupten kann. Das geht zuweilen über Striche oder Umstellungen weit hinaus in eigenständiges Formulieren. Ich kann das unmöglich im Detail mit jemandem diskutieren, auch wenn mir dessen Arbeit außerordentlich wertvoll ist. Der Librettist muss daher in der Lage sein, seine Arbeit als Angebot anmich zu begreifen, mit dem ich nach meinen Bedürfnissen sensibel umgehe. Ich versuche dafür zu sorgen, dass die Qualität der Sprache in meinen Stücken ein wesentlicher Faktor ist und dass diese Qualität auch wahrgenommen werden kann. Die Besetzung des Orchesters und die Faktur der Musik zu "La grande magia", die gewisse Verbindungsstränge zur "Ariadne auf Naxos" von Strauss nicht verleugnen, sind gewählt, einen großen Teil der Sprache des Stückes verständlich zu halten. Hoffen wir, dass es gelingt ... ILSEDORE REINSBERG: Wie läuft Ihr Arbeitsprozess an einer Komposition ab? Ziehen Sie sich von allen zurück in eine Welt, in der es nur Platz für Sie und Ihr neues Stück gibt?MANFRED TROJAHN: Ja und nein. Wenn die erste Szene, die außerordentlich mühsam entsteht, fertig ist, liegt das Stück erst einmal. Irgendwann steht mir die verbleibende Zeit vor Augen, um halbwegs pünktlich zu liefern. Je näher ich dieser Tatsache komme, desto ausschließlicher wird alles. Seit letztem Sommer gab es für mich kein wie auch immer geartetes anderes Leben.Durch "La grande magia" stellte ich eine große Veränderung beim Opernschreiben fest. Früher ging das folgendermaßen: Ich komponierte von morgens 7 Uhr bis mittags 13 oder 14 Uhr. Dann habe ich ein bisschen geschlafen und danach das vormittags Komponierte abgeschrieben. Das war notwendig, weil man mit Bleistift auf Papier komponiert und für eine gute Kopie musste das Stück mit Architekturfüller auf Transparentpapier übertragen werden. Mittlerweile schreibt kaum noch jemand eine Transparentpartitur. Entweder wird das mit Bleistift Geschriebene direkt kopiert, was eine grafi sche Sorgfalt im Moment des Kompositionsprozesses erfordert und außerordentlich schwer einzuhalten ist; oder der Komponist bzw. eine andere Person setzt das Komponierte in den Computer. Ich habe für diese Arbeit den Pianisten Martin Zehn gefunden, einen phänomenalen Musiker und einen wirklichen Profi für die Notenschrift. Damit bin ich ab 14 Uhr beschäftigungslos. Damals, als ich Transparentpartituren schrieb, habe ich dabei Opern gehört. Und wenn ich an eine Stelle kam, die ich noch einmal speziell überprüfen musste, stellte ich die Musik ab. Eigentlich konnte ich die Partitur mechanisch abschreiben und war sehr glücklich dabei, Opern kennen zu lernen wie die von Britten. Jetzt geht das nicht mehr. Mein neuer, ganz merkwürdiger Erfahrungshorizont ist: Ich bin ab 14 Uhr eigentlich überfl üssig. In dieser Grunddisposition bin ich auch nicht in der Lage, zum Beispiel die Steuererklärung zu machen. Das geht ebenso wenig wie konzentriert und trotzdem mit Wohlgefallen zu lesen. Ich zappe plötzlich durch die Fernsehprogramme und habe in meinem ganzen Leben nicht Fernsehen gesehen. Das will ich wieder raus haben aus meinem Leben. In Paris, wo wir auch beheimatet sind, passiert mir diese Leere nicht. Aber wenn die Zeit zum Komponieren eng wird, brauche ich optimale Kommunikationsmittel. In Paris gibt es keinen eigenen Computeranschluss, so dass ich zu demjenigen, der mir die Partituren schreibt, nur über den Copyshop Kontakt habe. Das dauert alles zu lange, genau wie die Postlaufzeiten. Also bleibe ich in Düsseldorf und renne mit dem Kopf gegen die Wand. Ich muss jetzt einen Modus fi nden, weil diese Art von totaler Abschottung nicht gut tut. ILSEDORE REINSBERG: Wie sieht es mit kreativem Kochen als Ausgleich aus?MANFRED TROJAHN: Na, es muss ja nicht gleich kreativ sein, ein bisschen kochen genügt doch. Früher habe ich das intensiver betrieben, aber wichtig ist es mir immer noch, vor allem in Verbindung mit einer bestimmten Kultiviertheit des Tisches. Der sollte gedeckt sein, und zwar mit Kerzen und anständigem Besteck. Sonst halte ich das Leben nicht aus.ILSEDORE REINSBERG: Damit ist meine nächste Frage nach den Verschnaufpausen schon im Voraus beantwortet.MANFRED TROJAHN: Etwas kommt noch hinzu. Jetzt habe ich Sehnsucht nach einem Garten, in dem ich am Nachmittag einfach Rosen umtopfe und wegkomme von Otto, Marta und den anderen ...ILSEDORE REINSBERG: Gibt es so etwas wie schöpferische Zufriedenheit, wenn Sie eine Komposition abgeschlossen haben?MANFRED TROJAHN: Ja. Im Allgemeinen bin ich froh, dass das Leben wieder anfängt. Das trifft natürlich viel stärker auf die Arbeit an einer Oper zu als auf die an einem Orchesterstück, bei der das Leben nie aufgehört hat. Die Arbeit daran ist kürzer. Außerdem kommt jeder zum Schluss einer Arbeit an den Punkt, wo er meint, wenn noch eine Woche Zeit wäre, würde die Sache wirklich gut werden. Dann hat man diese Woche und sagt sich, wenn man jetzt noch eine Woche hätte … Bei mir gibt es sowieso keine Selbstzufriedenheit, ich habe viel zu viel Abstand zu mir selbst, stelle mich permanent in Frage. Jetzt bin ich zwei Tage hier, bin auf Proben und erlebe ein Ensemble, das Spaß an der Einstudierung hat. Es wird ernsthaft gearbeitet und ich merke, die Szene funktioniert. Vielleicht habe ich erreicht, was ich wollte. |
|
|
A Dresda la prima de La grande magia, dalla commedia di Eduardo de Filippo Per il compositore Manfred Trojahn, "questo testo imborghesisce le problematiche di Enrico IV". Ma sempre in tono lieve, e con un’armonia quasi tonale STEFANO NARDELLI
N ato nel 1949 presso Braunschweig, nella Bassa Sassonia, Manfred Trojahn è una figura in qualche misura anomala: poco attento alle mode, assiduo e votato al suo lavoro come un artigiano che costruisca poco a poco le tappe del suo lungo percorso creativo. La voce è molto presente nelle sue composizioni ma al teatro arriva relativamente tardi."I compositori delle ultime generazioni sono, con poche eccezioni, molto lontani dal teatro. Tuttavia, le esperienze che ho potuto fare dal 1991 con l’opera sono vaste, non limitate alla sola attività di compositore: ho lavorato come regista, preparatore musicale, ho anche suonato il fl auto nell’orchestra - spiega Trojahn - Le cinque opere che ho finora composto, contando anche i recitativi de La clemenza di Tito, hanno avuto molti allestimenti: sono vicino al teatro come pochi compositori della mia generazione". Per la sua nuova opera La grande magia – su libretto di Christian Martin Fuchs tratto liberamente dalla commedia di Eduardo De Filippo, in prima assoluta alla Semperoper di Dresda il prossimo 10 maggio – Trojahn torna al teatro di Eduardo che, con Luigi Pirandello (da Lumìe di Sicilia ha tratto Limonen aus Sizilien), è un riferimento frequente per le sue opere. "L’opera italiana l’ho sempre sentita più vicina di quella tedesca. Anche le opere di Mozart e Da Ponte le preferisco al Ratto e al Flauto magico. E di Strauss, piuttosto che Elektra, sento più vicine opere come Ariadne o Capriccio, che magari non sono opere italiane, ma hanno un modo di mettere al centro il cantante che deriva dall’opera italiana. Forse è dipeso da queste preferenze il fatto che io abbia cercato i miei soggetti in Italia. Ma è stato un caso che mi ha portato a scegliere Enrico IV come soggetto per la mia prima opera, Enrico", racconta Trojahn. "Fra il 1979 e il 1980 ho vissuto a Roma, e anche se questa esperienza mi ha causato molti problemi, io amo l’Italia – è una cosa molto tedesca costruirsi un universo artistico sull’Italia. Universo che ho ritrovato nei testi di Pirandello ed Eduardo, e a cui appartiene il gioco fra realtà ed illusione teatrale, per me un aspetto fondamentale dell’opera. Quanto a La grande magia di Eduardo, quando l’ho letta mi ha subito affascinato il fatto che, sotto molti aspetti, questa commedia addirittura giochi con l’Enrico IV. In un certo senso questo testo imborghesisce le problematiche di Enrico". Com’è riuscito a tradurre in musica il tono leggero della commedia di Eduardo? "Come già per Enrico, ho composto per un piccolo organico orchestrale ma in questo caso la strumentazione è più leggera, a tratti l’armonia quasi tonale. In questo modo anche il tono malinconico risulta più accentuato che nella commedia. Nell’opera c’è anche un aspetto che in Eduardo non è presente. Marta è una cantante, e non è solo molto bella, ma anche molto ambiziosa: un aspetto che viene esposto con un tono lieve, malinconico, che evita la commedia estrema e per il quale io auspico un tono narrativo che si ispiri all’affettuosa ironia di Fellini." Guardando al futuro, nessun dubbio che vi sia ancora opera e ancora Pirandello nei progetti di Trojahn: "Voglio comporre ancora molte opere. I personaggi della Magia che mi hanno accompagnato per molti anni, mi mancano già – non è piacevole svegliarsi e non trovare Marta, Calogero e Otto ad aspettarmi nel mio studio. E prima o poi farò I giganti della montagna, che ho sempre immaginato come opera della vecchiaia e per la quale spero di avere ancora un po’ di tempo." A Dresda l’opera di Trojahn sarà diretta da Jonathan Darlington a capo della Sächsische Staatskapelle Dresden, l’allestimento sarà curato da Albert Lang per la regia e da rosalie per scene e costumi. Protagonisti Marlis Petersen, Rainer Trost, Urban Malmberg. Prima il 10 maggio, repliche il 13, 16, 18 e il 6 luglio, e ancora il 4 e 7 settembre per una ripresa nella prossima stagione. www.semperoper.de |
|