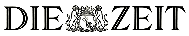|
OLAFUR ELIASSON Olafur Eliasson ist ein Star der Kunstszene. An der Berliner Staatsoper gestaltet der Däne nun sein erstes Bühnenbild. VON CHRISTINA TILMANN
BERLIN - Nein, ein Opernfan ist er nicht unbedingt, der dänische Lichtkünstler Olafur Eliasson. Steht in seinem Atelier in Berlin und lästert über diese Kunstform, die sich so weit von der Wirklichkeit entfernt und in einen elitären Zirkel zurückgezogen habe. Ein unglaubliches Spektakel sei so ein Opernbesuch schon, müsse er zugeben, auch wenn er selbst kein traditioneller Operngänger sei. Aber dann kämen die Leute aus der Aufführung, und mit ihrer Lebenswirklichkeit habe das, was sie erlebt haben, nichts zu tun. Weshalb wir, so der sympathisch entspannte Künstler, der nun für die Staatsoper zum ersten Mal in seinem Leben ein Bühnenbild gestaltet, noch einmal ganz von vorne anfangen müssen. Wie gewinnen wir für die Oper gesellschaftliche Relevanz zurück, war seine Ausgangsfrage. Wie verbinden wir Leben und Kunst? Weiter könnte der Weg in der Tat kaum sein, vom etwas verlotterten Areal an der Heidestraße, hinter dem Hamburger Bahnhof, wo Olafur Eliasson sein Atelier hat, bis zur schicken Mittewelt Unter den Linden, in das Opernschatzkästchen der Staatsoper. Angenehm geerdet ist in Eliassons luftigem Atelier fast alles, vom Bündel Kräuter in der mäßig aufgeräumten Atelierküche bis zum Kinderball, der hinten im überwucherten Gartenareal im Gras liegt. Noch sitzt auch der 40-jährige Künstler entspannt draußen auf der Bierbank, unter jungen Birken, und im Atelier basteln Assistenten Spiegelfolie auf Drahtgestelle. Doch an der Wand hängt schon das Story-Board für Hans-Werner Henzes Konzertoper „Phaedra", die am 6. September an der Staatsoper uraufgeführt wird. Regie: Peter Mussbach. Bühnenbild: Olafur Eliasson. Im Werkstattgespräch jedoch geht es schnell zur Sache: Oper sei ein unglaublich arrogantes Medium, konstatiert Eliasson. Das fange schon mit der Situation im Opernraum an. Da sitzen die Zuschauer, festgebannt auf ihren Sitzen, ohne die Möglichkeit, sich zu bewegen, nach Belieben raus- oder reinzugehen, selbst die Augen blicken alle in die gleiche Richtung: zur Bühne. Kollektive Erwartung stehe im Raum, zusätzlich aufgeheizt durch Musik, ein echtes Gänsehautgefühl, schon unglaublich stark. Und doch eine Art Entmündigung, ein Verharren in der Passivität des rauschhaften Kollektiverlebnisses. In der Kunst, so der Installationskünstler, der bekannt wurde durch seine labyrinthischen Licht- und Spiegelräume, in der Kunst dürfe der Besucher selbst entscheiden, wie lange er bleiben will, wie er sich bewegt, welche Haltung er gegenüber dem Dargebotenen einnimmt. Manchmal, wenn das Werk gar zu überwältigend ausfällt, sei schon hier die Versuchung da, zu still zu werden, zu passiv zu verharren. In der Oper ist das eher der Normalfall. Nun, jedem ist das Kollektiv vertraut, das er kennt, und ob die Kunstwelt mitsamt ihrem derzeit so aufgeheizten Markt und dem internationalen Starzirkus, in dem auch der in Berlin lebende Däne Olafur Eliasson keine unbedeutende Rolle spielt, derzeit so viel offener, lebensnäher und gesellschaftsrelevanter agiert als die Opernszene, ist die Frage. Doch wie einer, der ganz von außen kommt, mit dem Kollektivorganismus Oper umgeht, ist schon ein interessantes Experiment. Vor allem, wenn es jemand wie Olafur Eliasson ist, der etwa mit seiner legendären Installation „The Weather Project" 2003 in der Londoner Tate Modern durchaus faszinierende Kollektiverfahrungen geschaffen hat: mit einer gigantischen gelben Sonne, die in der Turbinenhalle des ehemaligen Umspannwerkes schwebte, unter einer verspiegelten Decke, und die Museumsbesucher legten sich auf den Boden, klein wie Ameisen im großen Lichttheater, und winkten ihrem Spiegelbild an der Decke zu. Spiegel spielen auch in der Staatsoper eine große Rolle, wie nicht anders zu erwarten bei einem Künstler, der regelmäßig mit Kaleidoskopen und ins Unendliche gebrochenen Reflexionen arbeitet. Doch auch zum Inhalt passt diesmal die Form. Phädra, das ist in der Version, die der Komponist Hans-Werner Henze gemeinsam mit dem Lyriker Christian Lehnert geschaffen hat, die Geschichte, das Drama des fragmentierten Menschen. Hippolyt, Stiefsohn der griechischen Königin Phädra, die in einer unseligen Liebe zu ihm entbrannte, wird von seinem entfesselten Pferdegespann zu Tode geschleift – und im zweiten Akt von Henzes den Metamorphosen des Ovid entlehnten Opernversion von der Göttin Artemis auf die Insel Nemi verbracht und dort, als Maschine, als künstlicher Mensch wieder zusammengesetzt. Eliasson, der Meister der Spiegelwelten, hat dafür im zweiten Akt eine bühnenfüllende „Hippolyt-Maschine" entworfen, ein Spiegelkaleidoskop, welches das Bild des in ihm gefangenen Sängers unendlich vervielfacht und gebrochen wiedergibt. Doch nicht nur Hippolyt wird fragmentiert, sondern auch der Zuschauer im Opernraum. Wie die Hippolyt-Maschine auf der Bühne funktioniert letztlich das ganze rotsamten-goldene Gehäuse des Staatsopern-Zuschauerraums als gigantische Reflexionsmaschine, wahlweise in rosa, gelbes oder blaues Licht getaucht. Die Rollen im Raum sind dabei verkehrt. Festgebannt auf dem Sitz hocken, nach vorne blicken, wo auf der Bühne das Operngeschehen abläuft und aus dem Graben die Musik dazu quillt – das verwehrt Eliasson dem Zuschauer konsequent. Er verlegt die Musiker, das 26-köpfige Kammerorchester des Ensemble Modern, nach hinten, auf ein Orchesterpodest im Rücken der Zuschauer. Und füllt den Orchestergraben dafür mit weiteren Sitzreihen auf. Wahrnehmungstheoretisch sei das eine Trennung von Auge und Ohr, erklärt der Künstler, der sich regelmäßig mit Fragen der Phänomenologie beschäftigt. Von hinten, aus dem Dunkel, ertönt die Musik. Und vorn, wo irgendwann eine riesige Spiegelfolie den ganzen Bühnenprospekt füllt, sieht der Zuschauer: sich selbst. Sich selbst als Akteur im Opernzirkus: die im Zuschauerraum versammelte freudige Erwartung als Urstoff, aus dem die Oper ist. Bühnengeschehen dagegen: zweitrangig. Nur folgerichtig, dass Olafur Eliasson der dänischen Nationaloper in Kopenhagen zuletzt sogar vorgeschlagen hat, eine Oper ganz ohne Musik zu inszenieren. Dass jedoch Musik, Klang, jenes physikalische Phänomen der körperlosen Schwingung, die den Lichtwellen, welche Eliassons Farbräume bilden, so ähnlich sind und auch ähnlich starke Emotionen hervorrufen, den Künstler wenig interessiert zu haben scheint, verwundert allerdings doch. Weniger eine Reflexion der Theatersituation und ihrer gesellschaftlichen Implikationen hätte man von Eliasson erwartet als eine psychedelische Lichtinstallation, die das Operngeschehen ganz in Stimmungen aufhebt. Doch für die Inszenierung von Staatsopern-Intendant Peter Mussbach hat sich Eliasson kaum mit Henzes Musik auseinandergesetzt, die er erst im Verlauf der Entwurfsarbeit kennenlernte. Auch Henze, der sich erst Ende vergangenen Jahres von einer schweren Erkrankung erholte und den zweiten Akt fertig komponierte, scheint das Bühnenbild eher als zweitrangig betrachtet zu haben. „Etwas mehr rot", soll er zum Lichtkonzept geäußert haben. Doch wie sich der Effekt von Millionen von Lichtpunkten, die eine Art Diskokugel in den Zuschauerraum wirft, wie sich das abwechselnd verdämmernde und wieder aufstrahlende Licht, ein im unendlichen Weiß auslaufender Bühnenraum oder im Gegenteil die völlige, samtige Schwärze, die zu Beginn nur ein dünner Licht- und Energiefaden durchschneidet, mit seiner Musik verbinden, bleibt die für den Erfolg des Premierenabends doch entscheidende Frage. Auf dass Augen und Ohren des Zuschauers nicht allzu getrennte Wege gehen. OLAFUR ELIASSON, geboren 1967 in Kopenhagen, lebt in Berlin. Seine Kindheit verbrachte er in Island und studierte 1989 bis 1995 an der Königlich Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen. Seit 2006 unterrichtet Eliasson an der Universität der Künste in Berlin.IN SEINER ARBEIT |
|
|
Musik aus Licht: Henzes "Phaedra" wird uraufgeführt Von Esteban Engel
Berlin - Der Meister meldet sich zurück aus Italien: Mit seiner neuen Oper "Phaedra" bringt Hans Werner Henze nach einer langen, schweren Krankheit wieder ein Stück auf die Bühne. Am 6. September wird das Alterswerk des wohl bekanntesten deutschen Komponisten an der Berliner Staatsoper Unter den Linden uraufgeführt. Das Ereignis dürfte schon jetzt zu den Höhepunkten der Musiksaison zählen. Der 81-Jährige, der mehr als 130 Werke schrieb, wird aus Italien anreisen und an der Uraufführung in Berlin teilnehmen. Für die Inszenierung des Auftragswerks hat die Staatsoper den Lichtkünstler Olafur Eliasson engagiert, Regie führt Intendant Peter Mussbach. Der Däne Eliasson, der mit seiner Installation "The Weather Project" 2003 in der Londoner Tate Modern international bekannt wurde, schafft für seine erste Arbeit an der Oper ein Bühnenbild aus Licht, Spiegeln und durchsichtigen Membranen. Dazwischen sollen sich Publikum und Darsteller bis ins Unendliche reflektieren, sich selber durch das Drama hindurch betrachten. "Mich interessiert weniger die Handlung als die Wirkung des Raumes und die Haltung der Zuschauer", sagte Eliasson am Donnerstag in seiner Werkstatt in Berlin. Durch den Opernsaal hat Eliasson einen Laufsteg ziehen lassen, der die Bühne mit dem hinter dem Publikum spielenden Musikern des Ensemble Modern (Leitung Michael Boder) verbindet. Wie sein Landsmann, der Regisseur Lars von Trier ("Dancer in the Dark") ist Eliasson ist ein Minimalist. "Ich habe schon viele Requisiten gestrichen", berichtete er über seine Bühnenentrümpelung für die laufende Produktion. Sein Vorschlag, in Kopenhagen eine Oper ohne Musik aufzuführen, "nur mit Bühnenbild und stummen Darstellern", ging allerdings ins Leere. Mit dem griechischen Mythos der Königen Phaedra, die in Liebe zu ihrem Stiefsohn Hippolyt verfällt und damit eine ausweglose Katastrophe auslöst, kehrt Henze mit dem Librettisten Christian Lehnert zu einem klassischen Stoff zurück. "Der Westfale, der in die Welt zog", wie ihn ein Kritiker einmal nannte, hat sich immer wieder mit Mythen beschäftigt - vom Che Guevara, dem Kommunismus bis zu "Venus", "L'Upupa" und "Phaedra". Seit mehr als 50 Jahren lebt Henze in seinem Traumland Italien, in den Albaner Bergen vor den Toren Roms, mitten in Olivenhainen. Seiner "Sehnsucht nach dem vollen, wilden Wohlklang" wird Henze, der einmal als "Einzelgänger der Moderne" genannt wurde, wohl auch in seiner neuen Produktion nachgehen. Doch seine Phaedra" greift über den griechischen Mythos weit hinaus. Im ersten Teil wird zwar das Drama skizziert, wie er von Euripides über Racine bis zu Sarah Kane behandelt wurde. © 2007 dpa - Deutsche Presse-Agentur |
|
|
Musik aus Licht Berlin - Der Meister meldet sich zurück aus Italien: Mit seiner neuen Oper "Phaedra" bringt Hans Werner Henze nach einer langen, schweren Krankheit wieder ein Stück auf die Bühne.
Am 6. September wird das Alterswerk des wohl bekanntesten deutschen Komponisten an der Berliner Staatsoper Unter den Linden uraufgeführt - ein Ereignis, das schon jetzt zu den Höhepunkten der Musiksaison zählen dürfte. Der 81-Jährige, der mehr als 130 Werke schrieb, wird aus Italien anreisen und an der Uraufführung in Berlin teilnehmen. Für die Inszenierung des Auftragswerks hat die Staatsoper den Lichtkünstler Olafur Eliasson engagiert, Regie führt Intendant Peter Mussbach. Der Däne Eliasson, der mit seiner Installation "The Weather Project" 2003 in der Londoner Tate Modern international bekannt wurde, schafft für seine erste Arbeit an der Oper ein Bühnenbild aus Licht, Spiegeln und durchsichtigen Membranen. Dazwischen sollen sich Publikum und Darsteller bis ins Unendliche reflektieren, sich selber durch das Drama hindurch betrachten. "Mich interessiert weniger die Handlung als die Wirkung des Raumes und die Haltung der Zuschauer", sagte Eliasson am Donnerstag in seiner Werkstatt in Berlin. Durch den Opernsaal hat Eliasson einen Laufsteg ziehen lassen, der die Bühne mit dem hinter dem Publikum spielenden Musikern des Ensemble Modern (Leitung Michael Boder) verbindet. Wie sein Landsmann, der Regisseur Lars von Trier ("Dancer in the Dark") ist Eliasson ist ein Minimalist. "Ich habe schon viele Requisiten gestrichen", berichtete er über seine Bühnenentrümpelung für die laufende Produktion. Sein Vorschlag, in Kopenhagen eine Oper ohne Musik aufzuführen, "nur mit Bühnenbild und stummen Darstellern", ging allerdings ins Leere. Mit dem griechischen Mythos der Königen Phaedra, die in Liebe zu ihrem Stiefsohn Hippolyt verfällt und damit eine ausweglose Katastrophe auslöst, kehrt Henze mit dem Librettisten Christian Lehnert zu einem klassischen Stoff zurück. "Der Westfale, der in die Welt zog", wie ihn ein Kritiker einmal nannte, hat sich immer wieder mit Mythen beschäftigt - vom Che Guevara, dem Kommunismus bis zu "Venus", "L'Upupa" und "Phaedra". Seit mehr als 50 Jahren lebt Henze in seinem Traumland Italien, in den Albaner Bergen vor den Toren Roms, mitten in Olivenhainen. Seiner "Sehnsucht nach dem vollen, wilden Wohlklang" wird Henze, der einmal als "Einzelgänger der Moderne" genannt wurde, wohl auch in seiner neuen Produktion nachgehen. Doch seine Phaedra" greift über den griechischen Mythos weit hinaus. Im ersten Teil wird zwar das Drama skizziert, wie er von Euripides über Racine bis zu Sarah Kane behandelt wurde. Im zweiten Teil greift Librettist Lehnert dann auf Ovids "Metamorphosen" zurück: Der zu Tode verwundete Hippolyt wird von der Göttin Artemis auf der Insel Nemi wieder zusammengesetzt, um unter dem Namen Virbius ein neues Dasein zu erleben. Auf der Bühne soll ein gigantisches Kaleidoskop die Gestalt auseinander nehmen und wieder zusammensetzen. "Henze interessierten vor allem die Grundlagen des Theaters", sagte Mussbach während einer Probe. Musik und Szene sollen über die Brücke verbunden werden, an der am 6. September auch Henze sitzen wird - "der Wiedergeborene", wie Musbbach ihn nennt. Quelle: Esteban Engel, dpa |
|
|
BÜHNENBILDNER Irene Bazinger
Die Oper ist eine tolle Sache", sagt Olafur Eliasson. "Nur schade, dass sie sich so weit vom Leben entfernt hat, das ihre Zuschauer führen, nachdem sie den Saal verlassen haben." Nun meint er damit keineswegs zwischen den Zeilen, dass die Oper eine reaktionäre Kunstform aus vergangenen Zeiten sei, die heute abgeschafft gehörte. Im Gegenteil, der in Berlin ansässige, in Island aufgewachsene Däne begreift die Konstellation zwischen Realität und Fiktion als Herausforderung der eigenen Kreativität und als fantastische Möglichkeit, die klassischen Seh- und Hörgewohnheiten zu erweitern. Wenn also diesen Donnerstag in der Staatsoper Unter den Linden die Uraufführung von Hans Werner Henzes Konzertoper "Phaedra" beginnt, wird das Publikum, wie gehabt, nach vorne zur Bühne blicken. Die Musik allerdings wird in seinem Rücken gespielt, wo das fast dreißigköpfige Kammerorchester des Ensembles befrackt auf einem Podest im hinteren Bereich des Parkettes sitzt. Eliasson erhofft sich durch die Trennung eine qualitative Erneuerung der Wahrnehmungspotenziale von Auge und Ohr. Welche Folgen diese optisch und auch akustisch ungewohnte Raumsituation haben wird, bleibt freilich abzuwarten. Er benutzt seit Jahren als konstituierendes Element seiner Arbeiten oft Spiegel, die im konkreten wie im übertragenen Sinne wirksam werden: Denn es geht ihm neben der ästhetischen Wirkung der Installationen stets auch darum, dass sich der Betrachter als Bestandteil der Kunstwerke empfinden kann und dass er auf sinnlich-elegante Weise aufgefordert ist, über sich und sein Handeln zu reflektieren. An diesen "aktiven Zuschauer" appelliert Eliasson. Die Bereitschaft des Publikums zur Interaktion ist ihm wesentlich - ob in der Bühnenkunst oder bei Performances in Galerien, Museen oder unter freiem Himmel. Deshalb war es einfach konsequent, dass ihn der Intendant Peter Mussbach, der die "Phaedra" inszeniert, einlud, das Bühnenbild dafür zu entwerfen. In der Staatsoper wird es nun - ganz im Kanon von Eliassons beredten Ausdrucksmitteln - auf der Bühne transparente Spiegelfolien geben, in denen sich die Besucher erkennen können. So werden sie mit ihrer kollektiven Erwartung sichtbar konfrontiert: "Man schaut durch sich selbst, um das Stück zu sehen", erklärte Eliasson in seinem Atelier neben dem Hamburger Bahnhof. Basierend auf dieser lebendigen Interaktion, die auf eine Annäherung von Künstlern und Publikum abzielt, will er zugleich Kunst und Gesellschaft wieder in eine produktive Kommunikation bringen. Den Begriff des autonomen Kunstwerks hält Eliasson, demnächst auch Professor an der UdK, für völlig obsolet. Heute gälte es dagegen, die Sphäre der abgehobenen Repräsentationskultur, in der sich die Oper oft und gern bewegt, mit gesellschaftlicher Verantwortung aufzuladen, in der, anders als bisher, alles mit allem zu tun hat, und nicht nichts mit nichts. Premiere am 6. September, 20 Uhr, in der Staatsoper Unter den Linden. |
|
|
Die Schrecken der Liebe Von Klaus Geitel
Morgen wird in der Staatsoper "Phaedra", die Konzertoper Hans Werner Henzes uraufgeführt: Zeichen einer doppelten Anhänglichkeit, der Henzes an Berlin und Berlins an Henze. In diesem Jahr ist er 81 geworden, er war 26 als er seinen ersten Triumph in Berlin kassierte: die Uraufführung seines Balletts "Der Idiot" in der Choreographie von Tatjana Gsovsky mit dem unvergessenen Klaus Kinski in der Titelrolle. Später schrieb Ingeborg Bachmann zu Henzes Ballett ihre Wunderverse. Immer, wenn Henze kam, war was los. Als "Maratona" 1957 in Luchino Viscontis Regie im Theater des Westens in Szene ging, mit dem großen Jean Babilée in der Hauptrolle, fiel prompt das Publikum wieder über Henze her, das seit dem Vorjahr darin schon geübt war. Es hatte bei der Uraufführung des "König Hirsch" einen der heftigsten Theaterskandale entfacht, die das Nachkriegs-Berlin bis dahin gesehen hatte. Annähernd zehn Jahre mussten bis zum Friedensschluss vergehen, als man die Uraufführung des "Jungen Lord" ebenso nach Kräften feierte wie man bislang seinem Werk mit Vorliebe die kalte Schulter gezeigt hatte. Henze ließ es sich nicht verdrießen. Sein Werk gehörte nun mal nach Berlin. Die Uraufführungen seiner vierten, siebten, neunten Sinfonie gaben im Verlauf der Zeiten einander sozusagen die philharmonische Klinke in die Hand. Karajan, nicht gerade als Freund des Neuen verschrien, dirigierte 1962 Henzes "Antifone". Berlin richtete in Salzburg die Uraufführung der "Bassariden" aus, bevor es das Werk in den heimischen Hallen empfing. "Das verratene Meer", Henzes musikdramatische Japonaiserie nach Mishima, die inzwischen auch auf den Namen "Gogo No Eiko" hört, schäumte zu allererst mörderisch an die Berliner Rampe. Die ganze Vielfalt seines Schaffens blätterte Henze offenbar mit einer gewissen Vorliebe zu allererst in Berlin hin. Die musikalischen, die kulturpolitischen Führungsspitzen der Stadt spielten es immer wieder als Trumpfkarte aus. Sie belohnten damit sich selbst, die Stadt, die Musikwelt und natürlich Henze. Mit größerem Recht als selbst Präsident Kennedy hätte er rufen können: "Ich bin ein Berliner." Dabei war er, kläglich genug, als junger Mann, dreiundzwanzigjährig, in Berlin untergekrochen. Tatjana Gsovsky hatte ihm, wie so vielen zuvor und danach, in den Räumen ihrer Ballettschule Unterschlupf gewährt. Er befreundete sich nachhaltig mit Paul Dessau und dessen Frau Ruth Berghaus. Zu den großen Opernpremieren seines Freundes Paul kam Henze bis zu Dessaus Tod regelmäßig nach Berlin. Treue um Treue. Henze war ein Mann ausdauernder Freundschaften. Ausdauernder Feindschaften allerdings auch. Sein grimmigster Hass aber galt von Kleinauf dem Nazi-Regime, dem sein Vater sich einst verschrieben hatte. Henze sah sich früh schon als einen "Fachmann für Angst und Leiden". So jedenfalls ist es nachzulesen in seinem Werkbuch "Phaedra", das zur Premiere seines jüngsten Werkes im Berliner Wagenbach-Verlag erschienen ist. Christian Lehnert, der Lyriker, hat für "Phaedra" das Libretto geschrieben.
Diese Wälder aber liegen bei Henze, ansässig in Marino bei Rom, beinahe vor der Haustür. Sein Zugriff auf den "Phädra"-Stoff wird allein dadurch bereits verständlich. Die Leidenschaft spielt überdies bei Racine verlässlich den Henker. Psychologische Überlegungen machen sich bei ihm ziemlich rar. Nichts als Leidenschaft dominiert bei Racine von Beginn an die Handlung. Wenn der Vorhang sich hebt, ist alles bereits längst zu spät. "Das Theater Racines gleicht einer explodierenden Bombe", heißt es - und dies selbst ganz ohne Musik. |
|
|
37/2007 "Der Sarg war schon bestellt" Seine 14. Oper "Phaedra" hat Hans Werner Henze fast das Leben gekostet. Endlich wird sie nun in Berlin uraufgeführt. Ein Hausbesuch bei dem 81-jährigen Komponisten Von Volker Hagedorn
Er sitzt im Schatten der Terrasse, auf Olivenbäume blickend. Er wirkt kleiner als erwartet, wie das oft ist, wenn man zuerst die Werke kennt. Kleiner auch als der Mann, den man nach Uraufführungen sah, wo er jederzeit der Bestgekleidete war, mit bronzenem Teint auffallend vital wirkend zwischen bleichen Musikern und geschminkten Sängern. Hans Werner Henze ist jetzt 81 Jahre alt. Mit einiger Mühe steht er auf, doch er funkelt amüsiert, als er die Herkunft des Besuchers erfährt, Niedersachsen. "Darf ich was sagen? Sie sehen aus wie ein Hannoveraner. Meine Großmutter war auch aus Hannover…" Henze sieht jedenfalls nicht aus wie ein gebürtiger Westfale in seinen leichten weißen Sommersachen, mit dem Aristokratenprofil und den hellen mittelmeerischen Augen. Vor mehr als einem halben Jahrhundert ist er nach Italien gezogen. Und hier, auf seinem Gut südlich von Rom, hat er vor fünf Monaten seine jüngste Oper fertiggestellt, Phaedra. Die hat ihn fast das Leben gekostet. Henze erlitt während der Arbeit einen Kollaps, sein Lebensgefährte pflegte ihn gesund. Doch Fausto Moroni selbst starb mit erst 63 Jahren, kaum dass Phaedra fertig war. Henzes "engster, liebster Freund", Gestalter des Wundergartens, der das gelbe Haus umgibt, "byzantinisches Fürstenkind, Kleinbauer und Seefahrer von beispielloser Begabung für die Kunst des Lebens". Fausto, der ihm vier Jahrzehnte zuvor in Rom erklärt hatte, er könne mit seiner Musik so gut wie gar nichts anfangen, dann die Ruine auf dem Landsitz sah, den Henze gerade erworben hatte, und beschloss, doch nicht nach Amerika auszuwandern, sondern sich um die Baustelle zu kümmern. Jetzt spürt man hier die Trauer. Am 6. September ist Uraufführung. Das Libretto hat ein Pfarrer gedichtet Seine 14. Oper ist Henze in mehrfacher Hinsicht nahegegangen. Der zweite Akt von Phaedra spielt hier in der Nähe, am Saum der Berge. Die Gegend ist von vorchristlicher Geschichte durchtränkt wie keine andere, das reicht tiefer zurück als in der Ewigen Stadt, die man vom Garten aus im Tibertal liegen sieht. "Rom ist für die Leute hier Kinderkram", sagt Henzes Assistent Michael Kerstan. "Es gibt hier eine Autowerkstatt, in der man an der Wand ein Fresko des Mitras-Kults sehen kann. Das war noch vor Diana." Also noch bevor die hellenische Artemis zur lateinischen Diana wurde und hier in der Nähe ihr Heiligtum bekam, als Folge des Dramas um Phaedra… Am 6. September wird Phaedra in der Staatsoper Berlin uraufgeführt, die 14. Oper von Henze, der nach seiner 13. gesagt hatte: "Es langt, denke ich." Peter Mussbach inszeniert, Olafur Eliasson gestaltet den Raum, Michael Boder leitet das Ensemble Modern. Als der junge sächsische Lyriker Christian Lehnert erfuhr, Henze wünsche ihn als Librettisten, wusste er wohl kaum, wie ihm geschah. Es ist "in gewisser Weise so, als würde man für Brahms arbeiten. Oder für Beethoven… er hatte das Gefühl, daß sein Blut abrupt die Blutgefäße hinunterstürzte, so daß er für einen Moment schwankte und sich eine Sitzgelegenheit suchte." So schreibt es nicht Lehnert, sondern ein früherer Librettist. Hans-Ulrich Treichel machte aus seinen Erfahrungen mit Henze den Roman Tristanakkord, in dem es allerdings um eine Hymne und nicht um eine Oper geht, schließlich hat auch Brahms nie eine geschrieben. Es empfiehlt sich nicht, Henze auf den Roman anzusprechen. "Er hat es nie gelesen", sagt sein Assistent, "er hat sich davon erzählen lassen und war empört." Schade, es ist ein witziges, schönes Buch. Diesmal entstand ein Buch schon vor der Oper, es vereint Tagebucheinträge von Henze und Notizen von Lehnert, der im Mai 2004 das Berliner Hotel Adlon betrat, mit zerschlissenem Rucksack. Mit der Musikwelt hatte er kaum zu tun. Lehnert, von Beruf Pfarrer in Müglitztal bei Dresden, hatte bis dahin nur Lyrik geschrieben. Die aber entdeckte Henze in einer Zeitung, danach entschied er sich für den jungen Sachsen. Man wollte den im Hotel zuerst gar nicht vorlassen zum Komponisten. Dann saßen sie im luxuriösen Appartement, aßen "Sandwiches von der Größe eines Kronkorkens" und besprachen die neue Oper. Lehnert zweifelte, ob er der Richtige sei. "Hans insistierte in einer für ihn typischen Mischung aus Komplimenten, Ironie und Starrsinn." Der neue Text sollte neben Euripides, Racine und Schillers Übersetzung bestehen. "Schiller ist grauenvoll, finden Sie nicht auch? Vielleicht sollten wir einige seiner Verse aufnehmen." So ging das los. Phaedra ist die Geschichte einer unerwiderten Liebe. Phaedra, Frau des Theseus auf Kreta, hat sich in ihren Stiefsohn Hippolyt verliebt. Den lässt das kalt. Gedemütigt verleumdet sie ihn bei ihrem Mann, dem Bezwinger des Minotauros: Hippolyt habe sie zur Liebe gezwungen. Dann erhängt sie sich. Theseus glaubt ihr. Er ruft den Meeresgott an, der einen gewaltigen Stier aus den Fluten steigen lässt, als Hippolyt seinen Wagen am Ufer entlangsteuert. Die Pferde gehen durch, die Räder brechen, der Jüngling wird zu Tode geschleift. Doch die Göttin Artemis bringt ihn in einer Wolke nach Italien und erweckt ihn zu neuem Leben – am See Nemi, zwölf Kilometer von hier. Da gibt es noch die Tempelreste, müllübersät. Hier wurde nämlich bei den Römern Hippolyt zu Dianas Priester und hieß Virbius, "aber das klingt ja wie eine Schlaftablette, Virbiol oder so", meint der Komponist. Seine Gestalten bleiben griechisch. Es singen Aphrodite, Artemis, Minotaurus, Hippolyt und Phaedra. Die verfolgt als Untote und Vogelwesen den Geliebten bis nach Italien. Henze fand sie "zuerst ganz nett, aber dann stellt sich raus, dass es ein ziemlich mieses Weibsstück ist, unedel, habsüchtig, bösartig, intrigant, achtlos, ohne Achtung… I’m sorry!" Sie ist als Mezzosopran besetzt – eine Mezzosopranistin regte Henze zuerst zu diesem Stoff an. Mitunter tauchen mit Phaedra zwei Wagnertuben auf, die hier keineswegs nach Drachenhöhle klingen, sondern zum Beispiel sanft das Erwachen der Liebe begleiten: "Dein Blick traf mich einst im Tempel beim Erheben des Opfers ins Feuer…" Endlos sitzt Henze auf der Terrasse, allein mit seinem Olivenhain Die Besetzung des kleinen Orchesters ist gewagt, ausgerichtet am Ensemble Modern, das die Uraufführung realisiert. Von 23 Instrumentalsolisten sind gerade mal vier Streicher: Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass. Zwei Perkussionisten bearbeiten dagegen 28 verschiedene Felle, Hölzer und Metalle, es kommen Klavier und Celesta dazu, und zu den 15 Bläsern gehören die beiden Wagnertuben. Wenn sie überhaupt nach Wagner klingen, dann wie einer, der auch dem späten Nietzsche gefallen hätte: mozartisch, südlich, melodisch. So wirkt es zumindest bei der ersten Durchspielprobe ohne Sänger in Frankfurt. "Wie ist es mit der Balance?", fragt Henze, der nicht dabei sein konnte. Das Ganze ist so durchsichtig, ja lichtdurchlässig, dass es keine Probleme gibt. "Ich kann eben einfach gut instrumentieren!" Er lacht, als hätte er das bezweifelt. Bei der Uraufführung in Berlin, schreibt er im Tagebuch, "werde ich mehr über mich erfahren können, über mich als Fachmann für Angst und Leiden". Nicht nur, weil in Phaedra die Liebe mehrfach zum Tod führt, sondern weil der Tod auch Henze selbst bedrohte. Nach dem ersten Akt, im Herbst 2005, verließen Henze die Kräfte. "Ich hörte auf zu reden und schlief immerzu", sagt er. Im Oktober brach er zusammen und wurde nach Rom ins Krankenhaus gebracht. Dann pflegten ihn sein Lebensgefährte Fausto Moroni und Assistent Michael Kerstan zu Hause sechs Wochen lang. Es stand schlecht um ihn. "Der Sarg war schon bestellt, die Traueranzeige gedruckt", sagt er, ohne eine Miene zu verziehen. Und doch ging es gut. Anfang 2006 begann er mit der Arbeit am zweiten Akt, passenderweise der Reanimation des zerschmetterten Hippolyt am Nemisee. Die Arbeit ging langsam vonstatten. "Er kann endlos auf seiner Terrasse sitzen, allein mit seinem Olivenhain", schreibt der Librettist. "Er scheint den Lebensrhythmus der Bäume anzunehmen. Schon die Hühner, die zwischen den Stämmen picken, empfindet er als unakzeptable Störung. Noch schlimmer sind die Flugzeuge, die von Ciampino starten, oder die Hubschrauber, die über seinen Garten zur Sommerresidenz des Papstes fliegen." Indessen genügt Henze, wenn er so da sitzt, mitunter schon der Blick auf fünf Telegrafendrähte hinter der alten Mauer, um in diesen luftigen Notenlinien eine Zwölftonreihe zu imaginieren. "Immer mehr habe ich ein Es gesehen, ein F, ein Cis…" Und manche komplexe mehrstimmige Passage, sagt er, "brauche ich nicht nachzuprüfen am Klavier, es stimmt einfach, das kommt in den letzten Jahren öfter vor". "Mit dem Tod ist alles aus. Das zu wissen, macht das Leben intensiver" Aber die Arbeit und die Schicksalsschläge haben ihn müde gemacht, er hört oft nicht mehr gut, seine linke Hand, mit der er früher schrieb, zittert. Als abends eine Besucherin aus Japan mit Blumen kommt, gibt er den Strauß schnell weiter – der Arm tut rasch weh von dem Gewicht, lieber noch eine "acqua macchiata", Wasser mit Schuss, ehe man sich zum Essen setzt. Es wird zubereitet von dem albanischen Ehepaar, das er und Fausto aufnahmen – Bootsflüchtlinge mit einem dreijährigen Sohn. Eine Tochter kam vor neun Jahren hier zur Welt, auf La Leprara. Nun stehen diese Geschwister vor ihm, Aurora und Aurelian, sanft und schön wie aus einem Märchen, schüchtern lächelnd. "Ich bin nicht der Vater, leider", sagt er. "Es ist meine größte Freude, diese Kinder wachsen zu sehen. Fausto hat alles für sie getan. Jetzt haben sie sogar italienische Pässe." Die Japanerin ist in Nagoya geboren, das bringt uns wieder zu Phaedra. Denn in Nagoya erlebte Henze erstmals das Stück von Racine, vor gut 40 Jahren. Auf Japanisch. Er schlief im Theater ein und schreckte erst hoch, als Phaedra laut "Kokolo!" rief. So hieß damals auch Henzes Hund. Auf Japanisch heißt es aber "Herz". Er fragt sie, wie man es in Japan mit der Religion halte. Die spiele keine große Rolle, erzählt sie. Er schweigt wieder und lauscht dem Gespräch, das über den Papst und dessen Steinway zu dessen Haushälterin gewandert ist. Plötzlich sagt er: "Ich finde es gut, wenn die Leute an nichts glauben. Keine Religion. Mit dem Tod ist finita la commedia. Es macht unser Leben intensiver und klüger, wenn wir das wissen." Vollmond über der Terrasse, ein Flugzeug von Osten blinkt im Sinkflug. Das ist die Route, sagt er, auf der einst die Götter kamen. |
|
|
Al Musikfest Berlin una novità di Henze Intervista al regista Peter Mussbach: "Un’opera a metà tra musica e rappresentazione" Hans-Werner Henze torna al teatro dopo un silenzio che dura dal 2003, cioè dal successo riscosso al Festival di Salisburgo dalla sua opera L’upupa und der Triumph der Sohnesliebe. E dopo la favola araba, torna alla Grecia antica, spesso fonte di ispirazione per i suoi lavori. Phaedra debutterà il 6 settembre al Musikfest Berlin 07. A 81 anni, Henze prosegue instancabile la ricerca stilistica ed approda con questa Phaedra alla "Konzertoper", l’opera-concerto. "È una forma molto interessante, fra il concerto e la rappresentazione teatrale. Pur indossando costumi, i cantanti devono evolvere dalla dimensione del concerto a quella scenica - ci spiega Peter Mussbach, regista della produzione berlinese, che ci riceve nel suo ufficio di sovrintendente della Staatstoper di Berlino a pochi giorni dalla pausa estiva -. Non sarà una rappresentazione semiscenica, ma il risultato di una elaborazione fra musica e rappresentazione ". Con oltre trent’anni di regie operistiche alle spalle nei quali si è misurato sia con il grande repertorio operistico sia con numerose creazioni (Chief Joseph di Hans Zender, The Wall di Miroslav Srnka nel contesto dell’opera collettiva Seven Attempted Escapes from Silence, e Perelá l’homme de fumée e Faustus, The last Night di Pascal Dusapin, per citare solo alcune fra le più recenti) Mussbach riconosce che i caratteri di originalità di Phaedra impongono una riflessione sul linguaggio scenico: "Ho messo in scena parecchie prime rappresentazioni di opere contemporanee, ma questa Phaedra è qualcosa di nuovo. Si impone una percezione diversa. Primo, non si può illustrare con scene e costumi come in uno spettacolo tradizionale. Secondo, i cantanti sono parte di un concerto, ma anche personaggi di una vicenda sulla quale però riflettono. È importante trovare un modo di recitare e di non recitare. Essere qualcuno e parlare del proprio essere. E un aspetto interessante del libretto è la scrittura e la spiegazione della scrittura, che offre prospettive su una scrittura nuova. In alcuni momenti comunque i personaggi si comportano come a teatro, interagendo fra di loro. Non si può parlare quindi nemmeno di concerto, in quanto musica e scena non sono completamente indipendenti". Il libretto del poeta Christian Lehnert si ispira a varie fonti, da Euripide a Racine alla drammaturga inglese Sarah Kane, che in epoche diverse hanno riproposto il mito di Fedra. Il lavoro è diviso in due sezioni: Mattino, in cui si racconta la vicenda di Fedra e del suo impossibile amore per il figliastro Ippolito secondo la tradizione classica, e Sera, ispirata al XV libro delle Metamorfosi di Ovidio, in cui Ippolito, riportato in vita, diviene oggetto di una nuova contesa fra Fedra, creatura dell’Ade, e le dee Afrodite e Artemide. Lo stesso Mussbach interpreta la bipartizione del libretto affermando che: "In un certo senso questo lavoro riprende l’idea del sociologo Richard Sennet, secondo cui l’evoluzione dei fenomeni sociali ha luogo in due momenti: la cerimonia, cioè una fase iniziale in cui tutti sono tenuti insieme dalla ritualità, e una seconda fase descrivibile come la distrazione dalla cerimonia, la rottura delle regole. Phaedra è divisa in due atti: il primo rappresenta la cerimonia in forma rituale, ovvero l’evocazione del vecchio mito di Fedra tramandato da Euripide e Racine. Nel libretto il mito non ha un’evoluzione psicologica o narrativa, procede per salti. In realtà l’intera opera è costruita in questo modo e quindi anche l’amore di Fedra per Ippolito non ha uno sviluppo lineare, ma procede per salti che porteranno alla morte dei protagonisti, non rappresentata sulla scena. Il secondo atto, dopo la morte, non avrà luogo nella grotta di Nemi, bensì in una "nowhere land", in un non luogo, e rappresenta la dissoluzione del mito di Fedra nella nostra epoca. Tutta l’energia - l’amore, il desiderio - è limitata al primo atto. Nel secondo atto, questi elementi ritornano, ma privi di forma, quasi in una situazione di caos. La cerimonia è dissolta". Nell’insistere sull’attualità del mito al centro della sua nuova opera, nel "giornale della musica" dello scorso gennaio Henze spiegava: "Ippolito, Fedra, i loro desideri le loro passioni... Probabilmente oggi i loro sentimenti rivivono con la stessa intensità". Mussbach si spinge oltre: "La riapparizione del Minotauro - ucciso da Teseo prima che l’opera cominci - alla fine dell’opera stessa spiega un po’ il senso di Phaedra: dopo che tutto è morto, èecco apparire il Minotauro, incrocio fra essere umano e natura, di cui è metafora. Nel primo atto il Minotauro è stato ucciso: gli esseri umani sono separati dalla natura. Nel secondo atto, dopo gli esseri umani, anche le due dee muoiono: è la dissoluzione. Ma alla fine di tutto, dopo la morte dell’uomo, il Minotauro, la natura, ricompare. E anche la musica ritrova in questa fine un nuovo inizio. Il concerto ricomincia, ma la musica è in qualche modo nuova". Per dare corpo alle sue visioni, Mussbach ha voluto accanto a sé Olafur Eliasson, un artista visuale fra i più significativi della scena artistica contemporanea. "Mi interessa come questo artista riflette sulle diverse funzioni della luce e come rielabora il tema della virtualità delle immagini e del funzionamento del cervello davanti alle immagini, cioè come le immagini sono percepite dal cervello umano...". Il gruppo strumentale Ensemble Modern diretto da Michael Boder e i protagonisti vocali - Maria Riccarda Wesseling / Natasha Petrinsky (Phaedra), John Mark Ainsley (Ippolito), Marlis Petersen (Aphrodite) e Axel Köhler (Artemis) – saranno disposti in fondo alla sala, dietro al pubblico, e si potranno solo sentire. Dopo Berlino, la produzione si potrà vedere dal 15 settembre a La Monnaie di Bruxelles, nel maggio 2008 alle Wiener Festwochen e in giugno a Francoforte. La prima italiana si terrà il 5 giugno 2008 al Maggio Musicale Fiorentino. Stefano Nardelli |
|





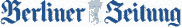

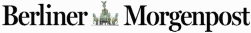

 "Es wird mir immer deutlicher und klarer, dass mein Stil, mein Ton, mein kompositorisches Tun am einfachsten und am besten mit der deutschen Musik, damit meine ich die Musik der Wiener Klassik, bezeichnet, verglichen und bemessen werden kann", schreibt Henze. Das war natürlich lange schon klar. Nicht umsonst hatte Henze immerfort in das Mozart-Orchester der "Entführung aus dem Serail" hineingehorcht, als er den "Jungen Lord" zu schreiben begann. "Kunstwerke zeigen Parameter der Schönheit. Das ist ihre gesellschaftliche Aufgabe." Um meine eigene angemessen zu erfüllen, bin ich erst mal per Leiter die Hänge meiner Haus-Bibliothek hinaufgeturnt, um Racines "Phèdre" herauszufischen und diese "Schrecken der Liebe", die das Werk ausbreitet, mit Staunen, Bewunderung und Entsetzen neu zu erfahren. Henze hat seinen Rahmen noch bedeutend erweitert. Er hat (wie schon Racine) natürlich auf die alten Griechen zurückgegriffen, aber auch deren römische Weiterschriften nicht ausgelassen, die Hippolyt, den bis zur Weißglut geliebten Stiefsohn der Phädra, Grund ihres Selbstmords, als uralten, unkenntlichen Mann unter dem Decknamen Virbius an den Nemi-See führt, wo man ihn mit der Zeit als Gott zum "König der Wälder" verklärt.
"Es wird mir immer deutlicher und klarer, dass mein Stil, mein Ton, mein kompositorisches Tun am einfachsten und am besten mit der deutschen Musik, damit meine ich die Musik der Wiener Klassik, bezeichnet, verglichen und bemessen werden kann", schreibt Henze. Das war natürlich lange schon klar. Nicht umsonst hatte Henze immerfort in das Mozart-Orchester der "Entführung aus dem Serail" hineingehorcht, als er den "Jungen Lord" zu schreiben begann. "Kunstwerke zeigen Parameter der Schönheit. Das ist ihre gesellschaftliche Aufgabe." Um meine eigene angemessen zu erfüllen, bin ich erst mal per Leiter die Hänge meiner Haus-Bibliothek hinaufgeturnt, um Racines "Phèdre" herauszufischen und diese "Schrecken der Liebe", die das Werk ausbreitet, mit Staunen, Bewunderung und Entsetzen neu zu erfahren. Henze hat seinen Rahmen noch bedeutend erweitert. Er hat (wie schon Racine) natürlich auf die alten Griechen zurückgegriffen, aber auch deren römische Weiterschriften nicht ausgelassen, die Hippolyt, den bis zur Weißglut geliebten Stiefsohn der Phädra, Grund ihres Selbstmords, als uralten, unkenntlichen Mann unter dem Decknamen Virbius an den Nemi-See führt, wo man ihn mit der Zeit als Gott zum "König der Wälder" verklärt.