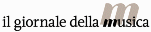| |
|
Achim Freyer und seine "La Traviata"
Maler, Bühnen-, Kostümbildner und Regisseur. Achim Freyer ist ein Multitalent. Wie keinem anderen gelingt es ihm, eine Verbindung zwischen Bühne und bildender Kunst zu schaffen. Mit seinen ungewöhnlichen Inszenierungen und seinen magischen Bühnenbildern zählt der 73-Jährige zu den bedeutendsten Theatermachern der Gegenwart. Am Nationaltheater Mannheim bringt er jetzt Giuseppe Verdis "La Traviata" auf die Bühne. Premiere ist am 8. Dezember 2007. 1934 in Berlin geboren, absolviert Achim Freyer zunächst ein Studium als Grafiker. Durch seine Plakatentwürfe wird Bertold Brecht auf ihn aufmerksam. Er holt den 20-Jährigen als Meisterschüler für Bühnenbild an die Ost-Berliner Akademie der Künste. Achim Freyer arbeitet mit namhaften Regisseuren wie Ruth Berghaus, Adolf Dresen und Benno Besson zusammen. 1972 setzt er sich aus der DDR ab. Schon bald zählt er auch im Westen zu den prägenden Köpfen des Theaters. "Achim Freyers Bühnenbilder tanzen, sie sind Musik fürs Auge. Seine Methode, die Wahrheit zu erfassen und erlebbar zu machen ist die Fantasie", sagt Chefdramaturg Hermann Beil in seiner Laudatio, als Freyer 2007 den Hein-Heckroth-Preis erhält. Im letzten Jahr hat Achim Freyer in Mannheim mit Cherubinis "Médée" ein recht unbekanntes Werk auf die Bühne gebracht. Jetzt kehrt er mit Giuseppe Verdis Klassiker "La Traviata" zurück. Nachtkultur hat dem "Visionär des deutschen Theaters" bei der Arbeit über die Schulter geschaut.
Probenfoto "La Traviata" (Foto: Hans Jörg Michel/Quelle: Nationaltheater Mannheim) | |
| |
|
MUSIKTHEATER: Achim Freyer inszeniert Giuseppe Verdis "La Traviata" am Nationaltheater Mannheim. Müssen wir uns nicht an allen Fronten mit unerforschlichen Ratschlüssen abfinden? Warum nicht auch bei den manchmal recht kryptischen Spielplan-Entscheidungen? So ist auch der öffentliche Aufruhr, warum wir um Himmelswillen in Mannheim schon wieder eine neue "Traviata" brauchen, nachdem die vorige eben erst abgespielt war, mittlerweile verstummt. Wir haben inzwischen erfahren, dass Achim Freyer, der weltweit gefragte Brecht-Jünger, Regisseur und Bühnenbildner, tatsächlich noch nirgends die "Traviata", eines der wirklich unsterblichen Meisterwerke Giuseppe Verdis, inszeniert hat. Und sich nun aus alter Freundschaft zu Operndirektor Kehr anschickt, dies just am Mannheimer Nationaltheater zu tun. Über Einzelheiten der Inszenierung hat sich Achim Freyer auch in einem längeren Interview mit unserer Zeitung ziemlich bedeckt gehalten. Nur, dass es "ein einziger Totentanz" werden soll. Achim Freyer ist übrigens auch für die Bühnenausstattung verantwortlich; die Kostüme hat seine Ehefrau Amanda entworfen. Vergessen wir also die - übrigens nicht sehr geliebte - letzte Mannheimer "Traviata", in deren Mittelpunkt bekanntlich ein riesiges Bett stand, und sehen wir mit Spannung der Freyerschen Sicht der Dinge entgegen. Gründe für gespannte Aufmerksamkeit gibt es genug. Da wird als Dirigent der junge Norweger Rolf Gupta angekündigt, der ab der nächsten Spielzeit die Position des Ersten Kapellmeisters innehaben soll. (Was zwangsläufig die Frage aufwirft, ob uns der allseits beifällig aufgenommene derzeitige Amtsinhaber Alexander Kalajdzic schon wieder verlässt.) Da wird vor allem (in der A-Premiere am 8. Dezember) Mannheims junger Sopran-Star Cornelia Ptassek ihre erste Violetta singen; an ihrer Seite als Alfredo Germont der junge Jean-François Borras, ein in seiner französischen Heimat vielfach gefeierter Lyrischer Tenor (Nemorino, Edgardo, Duca, Romeo), der gerade erst in Aachen als Rodolfo sein viel beachtetes Deutschlanddebüt gefeiert hat. Außerdem singt in der A-Premiere Thomas Berau den Vater Germont; in den wichtigsten Nebenrollen sind Yanyu Guo (Flora), Tobias Haaks (Gastone), Boris Grappe (Baron Douphol) und Katharina Görres (Annina) zu hören. In der B-Premiere am 12. Dezember singen Marina Ivanova (Violetta), Charles Reid (Alfredo), Mikel Dean (Germont), Andrea Szántó (Flora), Christoph Wittmann (Gastone) und Lars Møller (Douphol). WB | |
| |
|
Begegnung : Achim Freyer studiert in Mannheim Verdis "La Traviata" ein"Es ist ein einziger Totentanz" ein Treffen in der Probenpause Von unserem Redaktionsmitglied Stefan M. DettlingerMannheim, irgendwo in der Berliner Straße. Ein leuchtender Spätnovemberhimmel erhellt ein Restaurant ohne Geruch. Menschen kauen. Prosten. Lachen. Ein ganz normaler Tag. Für sie. Wir warten auf Achim Freyer. Das Warten auf Freyer, das ist wie das Warten auf ein lebendes Monument deutscher Bühnenkunst. Man wartet auf Freyer, den Maler, Freyer, den Bühnen- und Kostümbildner, Freyer, den Regisseur, und Freyer, den Brecht-Meisterschüler, der jetzt, für Mannheim, erstmals Verdis "Traviata" auf die Bühne wirft. Wenn sich die Tür öffnet und ein Mann mit Vollbart und elanvollem Seitenscheitel eintritt in diese Welt des Geschirrklapperns, dann erscheinen plötzlich all diese Freyers und sagen einstimmig "Hallo, bleiben Sie doch sitzen". Er habe nicht viel Zeit, sagt diese vielseitige Person gleich, die Texte und Fotos für das Programmheft müssen ausgewählt werden. Um 14 Uhr. Es ist 13 Uhr 30. Trotzdem: Wir überreden ihn zum Essen und bestellen. Er trinke am liebsten Alkohol, sagt er, doch das ginge jetzt nicht, schließlich müsse er noch arbeiten. Er trinkt also: nichts. Er wirkt ruhig und geschäftig zugleich. Wir sprechen über die Inszenierung, die er sich seit langem wünscht. Die "Traviata", meint er, habe er immer machen wollen. Nie hätte es geklappt mit der "Traviata". Alle hätten sie schon eine "Traviata" gehabt. Keine gebraucht. Erst jetzt, Freyer ist immerhin 73, hat es geklappt. In Mannheim. Ein Glück, das beide, er und Mannheim, seiner Freundschaft mit Operndirektor Klaus-Peter Kehr zu verdanken haben. Mannheim könnte einen wie Freyer nicht so einfach anlocken, einen, der weltweit an den Tophäusern inszeniert, in Stuttgart einst die legendäre Glass-Trilogie entwarf und derzeit in Los Angeles einen neuen "Ring" kreiert. Monumentale Überzeugungskraft "Es wird ganz wunderbar", wird er in über einer Stunde, also eigentlich zu spät für das Programmheft, mit einer Überzeugungskraft sagen, die monumental wirkt. Doch das ist erst das Ende des Treffens. Jetzt ist jetzt. Freyer ist überzeugt: Diese "Traviata" wird eine besondere "Traviata", eine "Traviata", die die Nebenfiguren "zu Ende denkt", nicht nur Violetta und Alfredo, sondern auch Flora, Annina, Giorgio, Gastone und wie sie alle heißen. Es sei eine gute Idee gewesen, zu essen, sagt Freyer froh. Kurze Stille. Was ist das Besondere an seiner Sichtweise? Freyers Gedanken sprudeln. Gestern, bei der ersten Bühnen- und Lichtprobe habe es mit dem Licht nicht geklappt. Nun habe er eine Lösung für das Licht gefunden. Ein zyklisches System von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, von Leben und Tod, von Hell und Dunkel mit sämtlichen Nuancen. "Das Licht atmet", sagt Freyer - die ganze Oper hindurch bis zum Tod der Violetta, bis zu ihrem trügerischen "Ah! Ich kehre ins Leben zurück . . . Oh Freude!", mit dem sie stirbt. Überhaupt der Tod. Sie sei ein einziger "Totentanz", die "Traviata", sagt Freyer. So sehe er das. So inszeniere er das. Und dann schwärmt er von der romantischen Vorstellung einer ausschließlichen Erfüllung der Liebe im Tod. Tatsächlich beginnt es so in der Partitur. Gleich die ersten Töne im Vorspiel, die hohe, gläsern-fragile h-Moll-Kantilene, sie lassen uns das unheilvolle, von Schwindsucht ermattete Tragödien-Ende erahnen. Alles, was dazwischen geschieht, ist Lüge, all das Geld, um das es geht, die Liebe, der Schmerz, der Anstand. Suche nach der Lösung Wer Freyers "Medée" gesehen hat, dieses faszinierende statische Kunstwerk, aus der Musik heraus allmählich in Bewegung gesetzt, könnte Angst bekommen, dass die geliebte "Traviata" ebenso werden könnte. Radikal und hart. Aber Freyer wäre nicht Freyer, würde er bei aller Handschrift nicht jedes Mal nach einer neuen Lösung suchen. Zeit für den Espresso. Den trinkt Freyer und erzählt plötzlich über ganz Anderes. Über die kranke Violetta Cornelia Ptassek, über Salzburg und Villazón. Plötzlich: Eine Metamorphose. Aus dem Regisseur wird der Maler und Sammler, der Besitzer von Bildern Sigmar Polkes, Neo Rauchs, Gerhard Richters und anderer, von Bildern, die er, wie er sagt, samt seinem Haus in Lichterfelde-West im Süden Berlins in eine eigene Stiftung einbringen möchte. Es ist spät. Zu spät. 40 Minuten zu spät. Jetzt sagt er diesen Satz: "Es wird ganz wunderbar." Freyer geht. Am 8. Dezember sehen wir ihn wieder. Auf der Bühne nach der Premiere. | |
| |
|
Das Interview: Mannheims Sopranistin Cornelia Ptassek über ihre Traumrolle Violetta Valery, die sie jetzt endlich singen darf - im Mannheimer Nationaltheater"Ich liebe es, an die Grenzen zu gehen" Von unserer Mitarbeiterin Waltraud Brunst
Frau Ptassek, Sie stehen in der ersten Spielzeit-Hälfte in zehn verschiedenen Rollen auf der Bühne des Nationaltheaters. Ist es da nicht unheimlich schwer, sich auf ein Rollendebüt vom Kaliber Violetta zu konzentrieren? Cornelia Ptassek: Es stimmt, dass es immer genügend rundherum um Rollendebüts zu singen gibt. Wie auch jetzt. Aber die Konzentration auf Violetta war insofern nicht schwer, weil ich diese Rolle schon sehr lange Zeit liebe. Den Klavierauszug habe ich zum Beispiel schon seit meinem zwölften Lebensjahr. Es ist also eine Partie, die mich schon lange begeistert, und was man liebt, darauf konzentriert man sich schon fast automatisch. Es gibt ein Frage, die Sängerinnen und Sänger buchstäblich in zwei Parteien spaltet. Vertiefen Sie sich beim Partien-Studium auch in CDs oder Videos wichtiger Rollenvertreterinnen, oder gehen Sie einer solchen mentalen Beeinflussung eher aus dem Weg? Ptassek: Ich glaube, man sollte die Vertreterinnen wichtiger Rollen auf jeden Fall kennen und mit offenem Ohr anhören, damit man weiß, was es überhaupt für Auffassungen gibt. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man etwas nachahmt. Die eigene Auffassung entsteht ja meistens in der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Dirigenten, dem Regisseur, dem Studienleiter und nicht zuletzt durch das intensive Studieren und Üben des Notentextes. Man darf nicht vergessen: Man hat sowieso nur die eigene Stimme, den eigenen Geist und das eigene Herz zur Verfügung. Wenn das alles authentisch ist, kann man niemanden nachahmen. Sie sind dafür bekannt, dass Sie in Ihren Rollenporträts sowohl physisch wie auch emotional durchaus Grenzen ausloten (Donna Anna, Marcia, Giunia). Gab es auch Fälle von "Bis hierher und nicht weiter!"? Und wie reagieren Regisseure dann? Ptassek: Bisher habe ich das zum Glück noch nicht erlebt. Ich bin aber auch gerne zu haben für alles Ungewöhnliche und Besondere. Ich liebe es sehr, bis an die Grenzen zu gehen. Den Regisseur habe ich noch nicht kennengelernt, der noch mehr wollte. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Sagen Sie uns etwas über Ihre ureigene Sicht auf Violetta Valery und auf den Stellenwert dieser wichtigen Partie in Ihrem Rollenspektrum. Ptassek: Für mich ist Violetta eine junge Frau, die in idealer Weise die Liebe verkörpert. Man kann mit ihr alles erleben: Sich das erste Mal wirklich zu verlieben, diese Liebe zu leben, aus vermeintlich höheren Gründen zu handeln, zu verzeihen, sich gegen den Tod immer wieder an das Leben zu halten. Es werden alle Facetten der Liebe erlebt, von ihr und dem Publikum. Deshalb ist "La Traviata" auch immer wieder ein Publikumsmagnet, von dem sich alle berührt fühlen. Für mich persönlich ist diese Partie eine der wichtigsten bisher und ein Meilenstein in meinem künstlerischen Leben. In Rezensionen wird ja neben Ihren ätherischen Pianissimi auch die "Grenzenlosigkeit" Ihres genuin lyrischen Soprans gerühmt. Wagen Sie in der kraftzehrenden "E strano"-Arie den (nicht originalen) finalen Höhenflug auf das dreigestrichene "Es"? Ptassek: Das kann ich Ihnen zum momentanen Zeitpunkt noch nicht abschließend beantworten. Gibt es eine Wunschrolle für Mannheim? Ptassek: Bisher kam in Mannheim mehr, als ich mir wünschen konnte, auf mich zu. Darüber bin ich sehr glücklich. Und ich freue mich jetzt erst mal auf unsere "Traviata"-Premiere. | |
| |
|
Quel sogno dal cuore di fanciulla "Violetta è una donna onesta costretta ad agire in una società che la rifiuta. Per questo vestirà da sposa, tra gli altri personaggi in abiti maschili" Un’altra Traviata? Sì, ma speciale. È la Traviata di Freyer, il cui debutto è previsto al Nationaltheater di Mannheim il prossimo 8 dicembre. Achim Freyer curerà regia e scene, i costumi saranno disegnati da Amanda Freyer, Rolf Gupta dirigerà l’Orchestra del Nationaltheater. Nei ruoli dei protagonisti si alterneranno Marina Ivanova e Cornelia Ptassek come Violetta, Charles Reid e Jean François Borras come Alfredo e ThomasBerau e Mikel Dean come Germont. Chi conosca la cifra stilistica di Achim Freyer - nato a Berlino nel 1934, pittore e uomo di teatro, allievo di Bertolt Brecht e Karl von Appen, scenografo e costumista dalla fine degli anni ’50 di registi quali Ruth Berghaus, Adolf Dresen, Benno Besson e Claus Peymann e dal 1979 regista lui stesso - non potrebbe immaginarsi combinazione più inattesa e intrigante."Fare Traviata era un desiderio che avevo da molto tempo, – ci racconta –, benché i miei amici abbiano provato a scoraggiarmi dicendo che non è un’opera per me". Nelle ultime stagioni Freyer è stato spesso ospite del Nationaltheater di Mannheim, in particolare dopo l’arrivo dell’attuale direttore, il drammaturgo Klaus Peter Kehr, con cui Freyer vanta una collaborazione professionale nata negli anni ’70, periodo in cui Kehr era capo drammaturgo dei Teatri di Colonia. Questa Traviata arriva dopo un raro Zauberflöte für 20 Finger riscritto da Zemlinsky allestito nel 2005 e una bellissima Medée di Cherubini che sarà ripresa in questa stagione. L’idea di lavorare su Traviata, però, è nata altrove. "Prima di Mannheim, avevo avuto contatti con il Bol’šoj di Mosca per una Traviata, poco prima che il teatro chiudesse per restauri. Il mio progetto di regia era probabilmente troppo innovativo e forse avrei avuto problemi. In effetti dopo quello provocato dal mio Zauberflöte alla Novaja Opera di Mosca (il teatro non aveva gradito che la mia regina della notte avesse una falce/mezzaluna come copricapo e Sarastro un martello) al Bol’šoj temevano un nuovo scandalo, malgrado il successo di pubblico. Dicevano che il mio progetto era troppo complicato sul piano tecnico ed hanno rinviato il progetto al 2011, dopo il restauro, però sto ancora aspettando il contratto... Poi quando ero davvero "incinto" di Traviata ho trovato in Kehr qualcuno disposto ad accogliermi e ad offrirmi questa opportunità. Per la mia Traviata qui a Mannheim, comunque, ho sviluppato un progetto diverso da quello di Mosca. Ma la visione radicale è la stessa". Verdi è praticamente assente dalla produzione di Freyer, se si esclude la versione scenica della Messa di Requiem alla Deutsche Oper di Berlino nel 2001. "Per il Requiem di Verdi ho usato forme forti collegate alla musica. Farò lo stesso con la Traviata che non solo è dello stesso autore, ma ha anche affinità evidenti con il Requiem, per esempio la relazione con la morte e la politica. Per me Traviata è una danza di morte. Anche ci sono momenti di humor, è un’opera densa di morte, ma anche con una speranza di vita". Cosa Le piace di Verdi? "Verdi è un compositore esistenzialista e archetipico con i suoi personaggi. E con Traviata riesce ancora a parlare alla nostra epoca: il denaro, i ruoli sociali e chi vi si oppone. Violetta è una donna onesta costretta ad agire in una società che la rifiuta. Per sottolineare la sua diversità, farò indossare a tutti i personaggi abiti maschili compresa Flora. Violetta invece sarà vestita con un abito da sposa dal primo al terzo atto, quando si sposerà con la morte". In costante equilibrio fra sospensioni oniriche e fanciullesca ingenuità, i suoi spettacoli sono caratterizzati da un forte interesse per l’immagine, in cui si intuisce il gusto del pittore prima che del drammaturgo. "Traviata è un’opera costituita di molti elementi che hanno ispirato le mie immagini. Uno è il tempo che diventa un tavolo o un’arena. Poi il denaro, un grande tema, citato in tutti e tre gli atti anche se con funzioni diverse: nel primo è ostentato nel salone di Violetta; nel secondo è speso da Violetta per il suo amante che lo restituisce durante la festa in casa di Flora; e nel terzo, persino in punto di morte Violetta chiede quanti soldi le siano rimasti per vivere ("Quale somma v’ha in quello stipo?" chiede ad Annina). Ci sono inoltre le scarpe, simbolo erotico ed elemento di identificazione sociale. Infine, lo specchio: la mia protagonista guarda attraverso lo specchio e nello specchio vede il suo doppio, il suo alter ego, Annina. Costumi e scena cambieranno colore nel corso dell’opera, a seconda dei sentimenti dei personaggi, di cui sono simbolo". Come sceglie le Sue opere? "Sono essenzialmente un pittore: guardo le forme. Cioè la mia scelta ha a che fare con la possibilità di sviluppare delle forme a partire da un’opera. Ci sono opere che non mi colpiscono: non potrei mai fare: Così fan tutte, per esempio, oppure Shakespeare, Amleto. Sono lavori troppo psicologici che impongono un trattamento psicologico troppo complesso per me". È il motivo per cui l’Ottocento è praticamente assente, mentre il Settecento e il contemporaneo sono una costante nel suo lavoro di regista? Allergia al Romanticismo? "Sono pittore e sono romantico. Da Caspar David Friedrich a Mark Rothko e oltre è tutto lo stesso. Ci sono temi che attraversano le epoche e sono romantici: la maledizione dello sviluppo tecnologico, l’osservazione del mondo per comprenderlo, persino la perversione della menzogna, cioè il kitsch (penso a Jeff Koons e al suo mondo colorato come un arcobaleno: anche lui è romantico!). Questi temi sono già tutti nelle opere cosiddette romantiche. Tutto ciò attraversa il tempo giungendo fino a noi, senza discontinuità". Per un lungo periodo la Traviata di Mannheim sarà l’ultima produzione di Achim Freyer in un teatro europeo. A partire dal prossimo gennaio infatti, Freyer volerà a Los Angeles per iniziare un progetto che lo terrà impegnato per diversi anni: un Anello del Nibelungo. "È tutto pronto: scenografie, costumi. Dobbiamo solo cominciare le prove per la tecnica a gennaio. È un progetto che mi impegnerà fino al 2011". Il pubblico italiano avrà ancora l’occasione di vedere altri suoi spettacoli? "Come regista, ho lavorato in Italia solo in due occasioni, entrambe a Venezia: la Turandot di Busoni e Persèphone [Premio Abbiati nel 1994, NdR], e il Don Giovanni che stavamo provando quando bruciò la Fenice. Dopo l’incendio, avrei voluto fare Don Giovanni nei resti del teatro bruciato, ma non se ne fece nulla. E così montammo in tre giorni lo spettacolo al PalaFenice ancora in costruzione, fra mille difficoltà e con il personale della sicurezza che voleva impedirci di usare i riflettori perché troppo pericolosi. Poi dai teatri italiani non mi hanno offerto più nulla. Non so perché non mi chiamino: ho casa in Italia, dipingo l’Italia… Ma va bene così: ho già abbastanza lavoro!" Altri progetti? "Non durante l’Anello e comunque quando lo finirò avrò 77 anni. Voglio avere il tempo di dipingere, il mio primo lavoro!". Dopo Traviata, la stagione operistica del Nationaltheater di Mannheim, iniziata in settembre con una nuova produzione della rossiniana Scala di seta, prosegue il 12 gennaio con un’Anna Bolena in versione concertante e un nuovo Trittico pucciniano allestito da Gabriele Rech a partire dall’8 marzo. Il 12 aprile il neodirettore musicale del teatro Friedemann Layer dirigerà il Fliegende Holländer, che sostituisce la nuova opera di Salvatore Sciarrino Superflumina rinviata alla prossima stagione. La Jenůfa di Janáček diretta ancora da Layer e messa in scena da Regula Gerber concluderŕ infine le nuove produzioni il prossimo 5 luglio. Completa il cartellone delle nuove produzioni, un’altra riscoperta di opere composte per la corte di Mannheim: l’Alessandro, composto nel 1765 dal napoletano Gian Francesco de Majo, messo in scena da Günter Krämer (debutto il 31 maggio). Info: www.nationaltheater-mannheim.deStefano Nardelli | |
| |



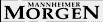
 Schon als 12-jähriges Mädchen träumte Mannheims Sopranistin Cornelia Ptassek davon, die Violetta Valery aus Giuseppe Verdis Oper "La Traviata" zu singen. Nun wird wahr, was sie sich immer wünschte. In der Inszenierung von Achim Freyer wird sie die Edelkokotte ab kommenden Samstag verkörpern und singen. Es ist, nach vielen Mannheimer Partien, bisher der Höhepunkt ihrer Karriere.
Schon als 12-jähriges Mädchen träumte Mannheims Sopranistin Cornelia Ptassek davon, die Violetta Valery aus Giuseppe Verdis Oper "La Traviata" zu singen. Nun wird wahr, was sie sich immer wünschte. In der Inszenierung von Achim Freyer wird sie die Edelkokotte ab kommenden Samstag verkörpern und singen. Es ist, nach vielen Mannheimer Partien, bisher der Höhepunkt ihrer Karriere.