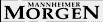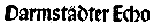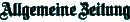|
Wie bei Achim Freyers "Traviata" in Mannheim die Puppen am großen Gefühl vorbeitanzen Fort mit dem Gefühl! Es passt nicht ins bunte Bild. Vor den großen Emotionen der Oper "La Traviata" flüchtet der Altmeister der Bühnen-Stilisierung, Achim Freyer, indem er sie weit von sich fernrückt. VON SUSANNE BENDA Giuseppe Verdis anrührendem Kammerspiel bekommt diese Distanzierung nicht - in der farbenprallen Künstlichkeit der Inszenierung am Nationaltheater Mannheim verkommt es zur poppigen Puppenparade. Gut bekannt ist die Bilderwelt dieses Regisseurs, der immer auch sein eigener Ausstatter ist: Starke Farbakzente prägen Bühne und Kostüme; wo sonst Blicke und Gesten die Personen verbinden, regieren bei ihm motorische, stereotype Bewegungen. Wer ein Stück derart inszeniert, schafft Abstand, eine fast epische Distanz. Das kann bereichernd sein, wenn es um die Bebilderung fremder Kunstwelten geht, also vor allem um alte und um neuere Musik. Zu Barockopern wie auch zu zeitgenössischen Werken des Musiktheaters - zuletzt etwa zur "Alice in Wonderland"-Oper der Koreanerin Unsuk Chin an der Bayerischen Staatsoper - hat Achim Freyer sprechende, symbolträchtige Bildfolgen gefunden. Bei Verdis Oper über Dumas" Kameliendame, die (wirklich an schwerer Krankheit - oder doch eher an zu viel Leben oder gar an ihrer ersten und einzigen großen Liebe?) zugrunde geht, läuft derlei Bühnen-Künstlichkeit ins Leere. Das liegt an der Größe des dargestellten Gefühls ebenso wie an dessen dramaturgischer Bedeutung. Radiert man die Beziehung zwischen Violetta und Alfredo aus, glaubt man nicht an sie, dann verliert das Stück seine Fallhöhe. Es lässt kalt. So sehen wir in Mannheim zwei leuchtende Geraden, die sich im Bühnendunkel hinten rechts treffen. Die untere markiert im Vorspiel eine imaginäre Spiegelwand, die Violetta und ihr Gegenstück Annina voneinander scheidet. Später wird die Gerade zum Laufsteg, auf dem die Figuren langsam schreiten: Alfredo als Harlekin mit rotem Schopf, Vater Germont (wohl am präzisesten getroffen) mit starrem, unbeteiligtem Blick in priesterlichem Violett, außerdem gelbe, grüne und blaue Menschen. Oft sieht das toll aus, manche Bilder - wie etwa das Zusammentreffen von Violetta und Germont - sind treffend erfunden. Doch das wahre Drama der Oper, die Unvereinbarkeit von Liebe und Leben, fasst die Inszenierung nicht. Rolf Gupta am Pult des Nationaltheater-Orchesters ergänzt die prallen Farben der Bühne gelegentlich mit großen dirigentischen Gesten. Oft gelingen ihm präzise Details im Orchester, doch die Koordination mit der Bühne will so recht nicht glücken. Immerhin hört man feinste Kammermusik - im Orchester, vor allem aber auch von den Sängern der Violetta (Cornelia Ptassek) und des Alfredo (Jean-François Borras), die aus dem ansonsten recht mittelmäßig besetzten Ensemble der Sängersolisten deutlich herausragen. Zumal der Sopranistin gelingen wunderschöne, ganz klar angesetzte und präzise geformte Piani. Dass sich ihre Darstellung so recht nicht zur Charakterrolle fügen will - wer möchte beurteilen, ob dieser Eindruck dem szenischen Konzept geschuldet, also ein Diktat des Auges an das Ohr des Zuschauers, ist, oder ob die Sängerin selbst die verordnete Stilisierung in ihre Rolle hineintrug? Bei Achim Freyer sind die Wege zwischen Auge und Ohr oft ziemlich verwinkelt. Am Ende trennen sich Violetta und ihr Spiegelbild Annina: Während Erstere in einen Schacht springt, der sich vorne auf der Bühne unbemerkt auftat, geht Letztere nach hinten ab ins Dunkel. Da lacht er noch einmal, der Bajazzo Achim Freyer, und gibt noch einmal den Theatermagier in einer bunten Bühnen-Gegenwelt. Wir hätten ihn zu gern auch einmal mit uns weinen gesehen. |
|
Musiktheater: Achim Freyer wirft im Nationaltheater Mannheim ein Gegenlicht auf "La Traviata" und geht verrätselt gegen die Bequemlichkeit des Geistes vorAuf dem Koordinatensystem des Todes Von unserem Redaktionsmitglied Stefan M. DettlingerWir rätseln immer noch. Was nur bedeuteten all diese Farben und Formen auf der Bühne, diese Metamorphosen bunten Lichts und psychologischer Stimmungen zwischen Hoffnung und Resignation? Was nur wollten uns die schemen- und schablonenhaften Gebärden sagen, die wir von diesem Regisseur, aber auch vom japanischen No-Theater her kennen? Und worauf schließlich läuft dieses supergekünstelte Wirken menschlicher Archetypen hinaus? Achim Freyers erste Inszenierung von Giuseppe Verdis "La Traviata" bleibt, auch Stunden nach der Mannheimer Premiere, schleierhaft und lässt uns nachdenklich zurück. Eine spontane Begeisterung, wie bei anderen Freyer-Arbeiten, bleibt aus. So ist es am Ende, nach dem Tod Violettas und dem finsteren des-Moll-Donnern des Orchesters, logisch, dass es für den Regisseur und sein Team (Amanda Freyer und Andreas Rehfeld) viele Buh- und Bravorufe gab - was ja immer wieder als positiver Ausschlag auf dem Qualitätsbarometer einer Regie gedeutet wird. Das Knacken der Nüsse Nun, es ist in der Tat nicht das Übelste, wenn wir, jeder für sich allein, auf dem Theater Nüsse zu knacken haben. Dass Freyer Werke schon aus Prinzip anders und damit systematisch gegen die Bequemlichkeit unseres Geistes bürstet, war klar. Dass der einstige Brecht-Meisterschüler aber alles weglässt, was "La Traviata" bislang war, weniger. Er versetzt die drei Akte um die Liebe der schwindsüchtigen Kurtisane Violetta zu Alfredo in eine Unzeit, in einen Unraum. Die Handlung findet quasi auf einem Koordinatensystem des Todes statt, deren Mitte diagonal über die Bühne verläuft und für Violetta die Trennlinie zwischen Leben und Tod ist. Dorthin kehrt sie immer wieder zurück und sieht in einen imaginären Spiegel. Was sie dort sieht, ist sie selbst; natürlich; aber nicht als Leben, sondern als Tod; nicht mit rotem, sondern schwarzem Haar; mit schwarzem Kleid, nicht mit weißem; nicht in ihrem, sondern in dem Körper ihrer Zofe Annina, deren Name hier zu Anima, Seele (Violettas), umgedeutet werden könnte. Das ist gut gemacht, einfach verständlich und doch nicht plakativ. Freyer konzentriert hier Violettas omnipräsentes Ringen mit dem Tod auf das Psychologische, wenn man so will: auf die ewige Frage von Sein und Nicht-Sein und dem, was auf das Nicht-Sein folgen könnte. Diese plastische Ausleuchtung der Seele, von Cornelia Ptassek (Violetta) und Katrin Wagner (Annina) in eiserner Disziplin umgesetzt, ist beeindruckend und eine der Stärken der Regie. Freyers - wohl verachtendes - Bild von der Masse schlägt sich in den Festgesellschaften nieder. Sie sind einfach nur hässlich und doof, die immer wieder Kniebeugen ausführenden Freunde Violettas mit ihren grünen Haaren und weißen Fräcken, sie sind, im doppelten Wortsinn, grün hinter den Ohren, unaufgeklärt und unsympathisch. Eine zentrale Rolle kommt Alfredos Vater Giorgio Germont (Thomas Berau) zu. Er schreitet, in magischem Büßerviolett, langsam und gebieterisch über den schmalen Bühnenstreifen. Er kommt als so etwas wie ein Stellvertreter Gottes ins Hause Valery, um Violetta zur Umkehr zu bewegen, wenngleich aus rein egoistischen Gründen. Intellektuell auf höchstem Niveau Dies alles ist auf der Bühne so maskenhaft dargestellt, dass Emotion dort nicht vorgegaukelt wird. Das gehört zu Freyers Intention. Er will die Emotion nicht auf den Brettern. Er will sie im Publikum. Doch das ist ihm nicht ganz gelungen. Mit vielen intensiven Momenten, durch die Musik unterstützt, geht einem der Abend weder richtig unter die Haut, noch hinterlässt er andere physische Reaktionen. Er bleibt intellektuell, dies freilich auf höchstem Niveau. Leider kann die musikalische Ausführung nicht immer ganz mithalten. Das fängt beim Dirigat von Mannheims künftigem zweiten Ersten Kapellmeister, Rolf Gupta, an. Seine Absicht, Verdi in einer kammermusikalischen Transparenz zu entromantisieren, ist zwar gut, wurde von Chor und Orchester differenziert umgesetzt und passt zu Freyers Ansatz. Aber vielleicht fehlt es dem jungen Maestro noch etwas an Erfahrung mit Gesang, denn so oft und eklatant auseinander hat man Bühne und Graben in Mannheim selten gehört. Cornelia Ptasseks Violetta ist gut und steigert sich in der todesnahen Endphase der Oper ins Meisterhafte. Hier, im komponierten Sterben, kann sie ihre Trümpfe ausspielen: Geschmeidigkeit, messa di voce, der Nuancenreichtum. Ihr "Sempre libera" hingegen (ohne dreigestrichenes Es) hüllt sie in allzu weiches Timbre. Was bisweilen fehlt, ist das direkte Ansingen von Spitzentönen, die sie sehr schnell zurücknimmt und in ihren typischen Stil wandelt. Insgesamt aber: eine tolle Leistung! Ihr Partner, Jean-François Borras, hat es neben Ptassek darstellerisch schwer. Von der Regie als eine Art Pumuckl angelegt, wirkt er auch stimmlich etwas klein, wenngleich er durchaus edle Töne von sich gibt. Thomas Beraus Germont indes war, wenngleich nicht außergewöhnlich farbenreich, sehr beeindruckend kräftig und konstant. Majestätisch! Die anderen - Yanyu Guo (Flora), Katrin Wagner (Annina), Tobias Haaks (Gastone), Boris Grappe (Baron Douphol) und Martin Busen (Marquis) - füllten ihre Partien darstellerisch wie stimmlich auf das Beste aus. Mannheim kann sich mit dieser Neudeutung der "Traviata" mehr als sehen lassen. Ist es der ganz große Wurf? Vielleicht nicht ganz. Aber das Nationaltheater kann so mit den großen Häusern der Republik konkurrieren. Das ist sehr viel! |
|
Rein ins Loch – Licht aus Oper: Wie ein alter Diavortrag: Achim Freyer inszeniert „La Traviata" in Mannheim Von Sigrid Feeser MANNHEIM. Sie hält die Arme hilflos ausgebreitet nach oben. Sie dreht sich, schleppt ihre Roben herbei, probiert sie an, trifft auf eine Doppelgängerin. Ein laufstegartig nach hinten führendes weißes Band entscheidet in Achim Freyers Mannheimer „Traviata"-Inszenierung über Abstand und Nähe, Leben und Tod. Maskenhaft zugeschminkte Gesichter, starke Farben, Zirkusfräcke für alle. Kasperlefiguren statt Charaktere, Typen statt Menschen. Die Leidenschaft, sie ist nur aufgemalt. Von Realismus in Verdis Kurtisanenoper will der Gesamtkunstwerker Freyer nichts wissen. Auch nichts vom schönen und schrecklichen Brausen eines an den gesellschaftlichen Konventionen scheiternden Liebeswahns im Halbweltmilieu. Er gibt dem Stück eine minimalistisch karge Szene und perfektes Lichtdesign, Tochter Amanda liefert die Kostüme. Freyer ist Bildermensch, kein Dramatiker, die Inszenierung funktioniert wie ein alter Diavortrag, bei dem immer neue Bilder aufeinander folgen. Hier herrscht der Irrsinn der Reduktion, verkleidet als endzeitlich dräuendes Welttheater. Das Ende ist an Tristesse nicht zu überbieten. Die trügerisch wieder auflebende Violetta fällt einfach in ein Loch, und das Licht geht aus. Da greift keiner mehr still ergriffen zum Taschentuch. Müssen wir das haben? Freyer-Inszenierungen sind immer Glaubenssachen; entsprechend teilte sich das Publikum in strahlende Gläubige und buhende Ungläubige. Das größte Problem der Aufführung freilich ist ihre musikalische Qualität. Dirigent Rolf Gupta gefällt sich im nebensächlichen Begleiten, Antrieb und Schwung kommen nicht aus dem Graben, eine bräsige Taktik manierierter Verlangsamungen führt zu Stillstand und ständigem Neuanfang. Für Cornelia Ptassek, (zu) hoch gehandelter Sopran-Star des Hauses, kommt die Violetta wohl zu früh; sie ist der Partie lediglich im dritten Akt gewachsen. Als Alfredo hört man einen merkwürdig unbeteiligten Tenor mit guten vokalen Gaben: Jean-Francois Borras; Thomas Beraus Vater Germont frappiert als eklatante Fehlbesetzung. |
|
Befremdliches Spiel mit Signalfarben Von Gabriele Weingartner
Wenn die Außerirdischen in der Nobel-Boutique Shoppen gehen. Szene mit Cornelia Ptassek und Kathrin Wagner. Foto Hans Jörg Michel MANNHEIM Pretty Woman alias Julia Roberts hätte wahrscheinlich nicht geweint in der "La Traviata"-Inszenierung Achim Freyers im Nationaltheater Mannheim. Denn dieses Mal hat der Altmeister der in Ästhetik gegossenen Emotionen des Guten zuviel getan. Er versetzte dem lebensvollen, von gesellschaftlichen Verwerfungen strotzenden Libretto von Francesco Piave den stilisierenden Todesstoß, packte alle Handlung der tränenvollen Kurtisanengeschichte in das Korsett ewigmenschlicher Konflikte und ließ damit auch das Opern-Geschehen leblos und formalisiert erscheinen. Natürlich zeitigte dies allerlei Nebeneffekte. Für die darstellenden Sänger und Sängerinnen bedeutete es, dass sie seltsam statuarisch und immer nur in kleinen Schritten die weiße Linie entlang gehen durften, die der Regisseur ihnen quer über den Bühnenraum ausgelegt hatte, dass sie die Arme wie Puppen strecken und senken mussten und sie so - schon weil sie weiß geschminkt waren - immer nur als Abziehbilder ihrer selbst agieren konnten. Aus den Gefühlen zwischen Violetta, der ausgestoßenen Hure, und Alfredo, ihrem Liebhaber, wurde dadurch die herzzerreißende Dynamik entfernt. Und da sie sich in Kostümen befanden, die zwischen Zirkus und Punk changierten, konnte man auch die ganze Handlung nur mehr als ein hoch ästhetisiertes, in signalträchtige Farben gehülltes Spiel begreifen. Ein Nullsummenspiel, um genau zu sein, in welchem nur immer wieder das eine behauptet wurde: dass es Liebe nicht gibt und man nur ferngesteuert handelt. Logisch war da nur, dass es auch in der Lebewelt der Violetta keine Charaktere gab, nicht einmal Männer und Frauen, sondern nur weiß gewandete, scheinbar vom Mars gekommene Wesen, denen grüne Büschel auf den Köpfen wuchsen. Kein Champagner floss in der eigentlich in der Belle Epoque angesiedelten Oper. Was nicht heißt, dass die von Amanda Freyer gestalteten Kostüme nicht ihre eigene, eingängige Schönheit besaßen. Aber man hätte sie auch dem Kindertheater verordnen können. Rundweg überzeugend erschien dagegen die musikalische Interpretation von Verdis Oper, die Rolf Gupta mit dem Orchester und dem Chor des Nationaltheaters Mannheim ungemein sensibel und so gut wie nie mit plakativen Fortissimo-Entladungen ins Werk setzte. Thomas Berau als Vater Alfredos ließ einen geradezu väterlich timbrierten Bariton verströmen, Jean-Francois Borras als Alfredo beglaubigte die Seelenschmerzen, die er darstellerisch nicht zeigen durfte, mit Schmelz und Verve. Und sensationell war zweifellos das Debüt Cornelia Ptasseks in der Titelrolle - ihre Kult-Arien sang sie mit großer lyrischer Intensität. Kein bisschen verrucht oder gar forciert, sondern in der Tat mit jener unverfälschten Kindlichkeit, die zum Freyer´schen Spiel-Konzept passte. |
|
Verdis Liebesgeschichte "La Traviata" an der Mannheimer Oper Von Frieder Reininghaus Giuseppe Verdi soll "La Traviata" in nur anderthalb Monaten geschrieben haben. Es ist seine einzige Oper, die in der Gegenwart spielt. Als Vorlage diente der Roman "Die Kameliendame" von Alexandre Dumas. Doch von der romantischen Sozialkritik des Stoffes ist in der Inszenierung von Achim Freyer am Mannheimer Nationaltheater nichts zu spüren.
Orchester des Nationaltheaters Mannheim. (Bild: Musikalische Akademie Mannheim) Die entrückten Klänge der Introduktion zur "Traviata" verweisen auf das Ende: Auf dies Sterben in der schönsten elegischen Schönheit, auf die hochherzige Großmut der Violetta Valéry und auf den Anflug von Katharsis bei den beiden Männern, die der schönen jungen Frau zuvor so übel mitspielen. Die beiden haben es, jeder auf seine Weise, einfach gut mit sich gemeint und wenig Rücksicht auf das - ohnedies von der Tuberkulose bereits schwer angeschlagene - Leben der Anderen genommen. Auch Achim Freyer hat es gut gemeint mit sich. Am Nationaltheater Mannheim bietet er, in völliger Abkehr von der bürgerlich-realistischen Handlungsvorlage aus dem bürgerlichen Paris und der Mitte des bürgerlichen 19. Jahrhunderts, sein altbewährtes, streng stilisiertes statisches Figuren-Theater: zeitlose Figuren, die in Rollen - und situationsbedingt in Farben - getaucht werden, in ortlosem Raum. "Echnaton" besaß mit solchem Zugriff hohe Plausibilität. Bei der "Zauberflöte" verwies dies auf realiter nicht vorhandene metaphysische Abgründe. Beim "Mädchen mit den Schwefelhölzern" oder "Majakowskis Totentanz" war es auf die eindringlichste Weise authentisch. Hier aber zielt die Transformation ins Nichts. Da hilft auch ein Text von Roland Barthes im Programmheft nichts, der die heitere, aber in seiner haltlosen Vereinseitigung grottenfalsche These aufstellte: der "zentrale Mythos der Kameliendame" sei "nicht die Liebe, sondern die Anerkennung". Selbst wenn diese Abstraktion zuträfe: zu lebendigem Theater hat sie Achim Freyer nicht zu erwecken vermocht. Schön war es, wirklich sehr schön. Alles schön modernes Design - die Bühne streng reduziert auf einen fast leeren Raum - das mag eine "altersweise" Lösung sein für ein zunächst von Jugendlichkeit sprühendes Stück. Die leere Bühne schmückt ein großer schräger Balken, der sich zu den unterschiedlichen Milieus, welche das Werk durchmisst, in verschiedenen Farben illuminiert. Dieser Leuchtbalken hätte vor dreißig oder vierzig Jahren ein fortschrittsfrohgemutes Firmen- oder Banken-Logo abgegeben. Anfänglich legt die Sopranistin Cornelia Ptassek, die die Titelpartie bestreitet, eine Kostümprobe ab: zeigt Kleider von allemal gleichem unbequemem Zuschnitt in verschiedenen Farben - und tastet sich, Hand an Hand mit einem Double, an einer imaginären Glasscheibe entlang, die wohl die Demarkationslinie zwischen dem noch Lebenden und dem Abgestorbenen andeuten könnte. Mit kindlichem Bilderhumor wurden von Achim Freyer die "Zigeunerinnen" der Ballnacht in den leeren Raum gezirkelt. Auch von ihnen geht keine erotische Ausstrahlung aus. Keine Gefahr, nirgends. Die Männer als Stierkämpfer werden ebenso verharmlost. Piave und Verdi wollten, dass das alles weit schärfer gewürzt erscheint. So versenkte die Inszenierung den brisanten Gehalt des Werks in der Begütigung durch Abstraktion und Zwangskollektivierung der bürgerlichen Individuen. Die Choristen revanchierten sich durch recht "individuelles Singen" - eben nicht miteinander, wie von der Partitur gefordert, sondern irgendwie jeder für sich. Überhaupt war das musikalische Resultat, das unter der Leitung von Rolf Gupka zustande kam, von vielen Ungenauigkeiten geprägt. Manches wirkte gar wie buchstabiert: Jean-Francis Borras als Alfredo kam gern ein bisschen zu spät und Thomas Berau als Vater Germont fehlte die betörende Tiefe in der Stimme. So war es, genau betrachtet und gehört, in Mannheim nur bedingt schön. Und an den Intentionen des Werks konsequent vorbei. |
|
Violetta e gli spettri di Freyer A Mannheim va in scena la "Traviata" di Achim Freyer nel segno di un'interpretazione fortemente personale e coerente con il proprio universo espressivo. Regia forte ma resa musicale discontinua, con una protagonista non del tutto all'altezza alla complessità del ruolo. Caldo successo con qualche contestazione a Freyer. Caldamente sconsigliato ai puristi verdiani.
Kathrin Wagner (Annina) e Cornelia Ptassek (Violetta) È difficile giudicare questo spettacolo che si fa ammirare più per la coerenza di un maestro della scena quale Achim Freyer con il suo universo espressivo lontano sia dall'iconografia classica stratificata nella memoria di noi spettatori sia da ogni lettura intimistica o psicologistica forse imprescindibile per quest'opera. Non è la "Traviata" di Verdi ma la "Traviata" di Verdi vista da Achim Freyer, cioè da un artista dalla forte cifra personale che rivisita un soggetto popolare e lo racconta attraverso il suo linguaggio di segni. Poco incline all'introspezione psicologica ma anche a interpretazioni sociali o politiche, Freyer racconta la storia di Violetta come una danza macabra popolata di burattini spettrali dai quali la protagonista cerca invano di fuggire. Costruito su simmetrie (la vita e la morte, lo specchio immaginario che le separa) e su oggetti e colori dalle forti connotazioni simboliche, lo spettacolo trova i suoi momenti più felici nelle due feste risolte con estro grottesco di straniante efficacia. Funziona meno nei passaggi intimistici, per la meccanica gestualità che svuota di senso i dialoghi e annulla ogni dinamica drammaturgica. Se il segno registico è forte, lo stesso non si può dire per la resa musicale. La direzione di Rolf Gupta è elegante, non cade nel facile, ma complessivamente è poco incisiva. E nemmeno la protagonista Cornelia Ptassek offre una prova del tutto convincente, complici un fraseggio deficitario e una dizione ai limiti del comprensibile. Discrete le prestazioni di Jean-François Borras (Alfredo) e Thomas Berau (Germont). Rendiamo atto che non aiutava comunque la spersonalizzazione imposta dalla regia. Il pubblico risponde con calore e riserva solo qualche isolato dissenso a Freyer. Caldamente sconsigliato ai puristi verdiani. Stefano Nardelli |