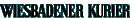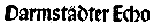|
Die Toten unter uns Ein herrliches, dabei alles andere als unschuldiges Vergnügen. Angesagt ist Giacomo Puccini, für einmal aber weder mit "La Bohème" noch mit "Tosca", sondern mit dem späten, vergleichsweise selten gespielten "Trittico". Das stellt besondere Anforderungen. Zum einen gilt es, eine enorme Zahl an Partien ganz unterschiedlichen Charakters zu besetzen, zum anderen sollen sich das Schauerdrama "Il tabarro", das Rührstück "Suor Angelica" und die Farce "Gianni Schicchi" zu einem Ablauf fügen, der am Ende mehr bietet als eine Folge dreier Einakter. Beides wird in der von Bernd Loebe geleiteten Oper Frankfurt überzeugend gemeistert. Am Werk ist hier nämlich der Regisseur Claus Guth, von dem man eine naturalistische Umsetzung, wie sie zum Beispiel die sonst in vielem überzeugende DVD aus dem Teatro Comunale di Modena zeigt, natürlich nicht erwarten kann. Das Verbindende sind für ihn die Toten, die beiden verstorbenen Kinder im "Mantel" wie in "Schwester Angelica" und der eben verblichene Buoso, um dessen Erbe sich die Verwandten in "Gianni Schicchi" streiten. So streifen die Seelen der Hinweggegangenen, von der Kostümbildnerin Anna Sofie Tuma ganz in Weiss gekleidet, sichtbar-unsichtbar durchs Geschehen. Ein Geschehen übrigens, das sich in allen drei Stücken auf einem Schiff abspielt: Christian Schmidt, der langjährige Bühnenpartner des Regisseurs, hat eine zweistöckige Inneneinrichtung mit Bar und enger Treppe auf die Frankfurter Drehbühne gestellt, die den drei Werken einen einheitlichen Rahmen gibt und viel räumliche Beweglichkeit ermöglicht. Die Metapher der Reise durch das Reich der Toten besticht, die Crux ist nur, dass sie nicht überall gleichermassen aufgeht. Bei "Gianni Schicchi" wirkt sie aufgesetzt, denn auch hier ist dieses Stück vorab eine wirblige, bisweilen derbe Komödie, die von den Darstellern mit viel Einsatz und nicht ganz so viel Gelingen über die Rampe gebracht wird. Sänger sind eben keine Schauspieler, könnte man da denken – aber das wäre danebengegriffen. Denn wo gibt es mehr Bühnenpräsenz als bei Julia Juon? Die Schweizer Mezzosopranistin zieht in "Gianni Schicchi" als Familienälteste die Fäden und steuert als die alte Frugola im "Tabarro" eine wesentliche Farbe bei; durch ihren Auftritt als fürstliche Tante, die der verzweifelten Nichte im Kloster den Tod ihres unehelich geborenen Kindes mitteilt, macht sie "Suor Angelica" zum heimlichen Höhepunkt des Abends. Eiskalt steht sie im roten Deux-Pièces hinter der Bartheke; ohne den Stock, der bei dieser Partie gewöhnlich obligatorisch ist, dafür in stimmlicher Hochform, nämlich mit glänzender Tiefe, strahlender Höhe und perfektem Registerausgleich bringt sie die unerbittliche Härte dieser Figur über die Rampe. "Suor Angelica" wurde schon bei der Uraufführung des "Trittico", 1918 an der New Yorker Metropolitan Opera, als kitschig abgetan und gilt bis heute als Schwachpunkt des Dreiteilers. Dass das keineswegs so sein muss, erweist der Abend in Frankfurt mit aller Deutlichkeit. Der junge Dirigent Nicola Luisotti, der ausgeprägtes Gespür für diese Musik erkennen lässt, hat das Mass der Süsse hellwach im Griff. Er lässt – und Angelina Ruzzafante (Suor Angelica) vermag ihm hierbei mit ihrem leicht in die Höhe steigenden und wohlklingenden Sopran jederzeit zu folgen – das Gefühlsselige nicht einfach strömen, sondern stellt es als raffiniert Gemachtes aus. Sorgsam dosiert er die Farben, nuanciert setzt er Akzente – und lässt damit erkennen, wie meisterlich Puccini den Druck auf die Tränendrüse beherrschte. Fast noch mehr gilt das für den "Tabarro", den Luisotti geradezu als sinfonische Dichtung darstellt. Lustvoll rauscht das Frankfurter Museumsorchester auf, und rasch wird deutlich, auf welch hohem Niveau der Orchesterbehandlung dieser Einakter fusst. Vielleicht liegt hier das Geheimnis dafür, dass das Stück in dieser Produktion so spannend wirkt. Unglaublich lastend die Atmosphäre zwischen dem verzweifelt an seiner Frau hängenden Michele und der jungen Giorgetta, deren Liebe zum deutlich älteren Ehemann mit dem Tod des gemeinsamen Sohns gestorben ist, und zugespitzt dann die Lösung des Knotens, die sich hier nicht unter dem Mantel verbirgt, sondern drastisch ans Licht gezogen wird. Mit seinem noblen Bariton, der im Mezzoforte besonders zur Geltung kommt, gibt eljko Lui den Michele, während Elsa van den Heever seine Frau Giorgetta mit hellen Zügen und Carlo Ventre den Nebenbuhler Luigi mit tenoraler Kraft versieht. Das macht nicht nur Vergnügen, es berührt. PETER HAGMANN |
|
OPER VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH Es kommt ein Schiff geladen... Eine Theater-Metapher für vieles Wesentliche: Narrenschiff, Totenschiff. Die Schiffsmusik Puccinis ist ein barkarolenartiges Triolenmotiv, etwas träge und stetig, aber mit schicksalsschwangeren Moll-Aufreckungen. Keine sprudelnde, irisierende, hymnische Wassermusik wie Debussys "La mer", eher ein dumpfes Dahinfahren in bedrängter, auswegloser Eintönigkeit. Wie das Leben in den Tod fährt und die Toten zu unheimlich wiederkehrenden Fahrensgestalten des Lebens geraten. Das dunkle Barkarolenmotiv durchsäuert nur den ersten der drei Einakter, die Giacomo Puccini zu einem "Trittico" zusammenfasste, die auf einem Löschkahn spielende Tragödie "Il tabarro" um Eifersucht und Mord. In eine abgeschlossene Welt führt aber auch das folgende Nonnenstück "Suor Angelica", die unendlich traurige Ballade einer jungen Adligen, die wegen eines "Fehltritts" hinter Klostermauern gesteckt wird und, nachdem sie vom Tode ihres fernen geliebten Kindes erfährt, Selbstmord begeht. In allerlei katholisierend-verklärender Umkleidung und Verklärung erhebt der ehemalige Kirchenmusiker Puccini hier eine im Grunde antikatholische Anklage wider die Grausamkeit der Menschen und ihrer Institutionen. Ins Florenz Dantes geleitet schließlich "Gianni Schicchi", der vermeintlich unbeschwert-burleske Kehraus. Indes geht es in dieser geschwärzten Eulenspiegelei um ein frivoles, gaunerhaftes Spiel mit dem Tode. Der gerissene Schicchi mimt einen Sterbenden, um der lauernden Verwandtschaft doch noch einen Teil der ihr entgangenen Erbschaft zu sichern und sich selbst den fettesten davon. Das büßt er in der Frankfurter Neuerzählung von Claus Guth mit dem eigenen Tod, womit der schmunzelnd-einvernehmliche Schluss der Komödie eine überraschende Pointe bekommt. Das Schiff fährt überall hin. Es durchmisst schwerelos die Daseinsbezirke von Lebenden und Toten. Neben den singenden Personen treten bei Claus Guth geisterhaft die Verblichenen aus den anderen Zusammenhängen auf, weiten die Perspektive ins Imaginäre. Das Schiff gibt auch dem Totenreich Raum, das man sich etwa als eine elegante Lounge mit Pullmansesseln vorstellen kann. Auch mischen sich die engelhaft Weißgekleideten mit den dramatis personae, auf sie und ihre Handlungen zeigend, als erzählten sie sich selbst diese spannenden Geschichten (und andere), an denen auch sie einst mitwirkten. Nicht auf Anhieb entfaltet sich die durchdachte Schlüssigkeit dieses Erzählens. Eine Strecke weit muss das Schiff erst zurücklegen, bis sich die Konzeption der erfahrenen Inszenierungslandschaft klärt. Der von Christian Schmitt auf die Bühne gebaute gleißend helle Luxusliner wirkt als Schleppkahnszenerie zuerst irritierend: Eine elegante Bar als Schauplatz jämmerlicher Tänzchen; Treppe, Reeling und wohlausgestattete Kabinen als Orte verschwiegener Umtriebe von armseligen, gehetzten Liebesleuten. Realismus, pariserischer Vorstadt-Verismo gar, sind ausgetrieben. Folgerichtig das eher verfremdete Klosterambiente mit den Frauenchören aus dem Inneren des Schiffsrumpfs. Und statt des klassischen Nonnenhabits einem strengen Gouvernantenschwarz der Kleidung (Kostüme: Anna Sofie Tuma), von dem das Grellrot der Fürstin (mit schneidender Diktion: Julia Juon) absticht, die Angelica die grausame Botschaft überbringt. Beim Erlösungsfinale erreicht Angelica die Lounge, in der sich auch ihr Kind aufhält, bleibt aber, sehnsüchtig den Arm nach ihm ausstreckend, von ihm getrennt. An komödiantischer Drastik handelt Guth dem "Schicchi" nichts ab, und in der choreographischen Arbeit mit dem Verwandtenensemble bestätigt er nochmals seine handwerkliche Präzision. Aufs schönste gelungen also der Versuch, das "Trittico" als eine welttheatralische Einheit, die Trinität als eine in sich runde Lebens- und Todes-Unität sichtbar zu machen - und damit auch eine Aufführungspraxis in Frage zu stellen, die den Zusammenhalt des Triptychons allzu oft zerriss und nur Einzelstücke präsentierte, was vor allem zu Lasten der unterschätzten "Suor Angelica" ging. Der Frankfurter Zugriff konnte sich auch auf faszinierend überzeugende sängerische Argumente stützen. Zeljko Lucic gab dem Michele des "Tabarro" und dem Gianni Schicchi das notwendig gegensätzliche, durchweg phänomenale baritonale Format. Carlos Ventre war der kraftvoll-facettenreiche jugendliche Luigi-Tenor der ersten, Massimiliano Pisapia der glücklichere Liebhaber Rinuccio der letzten Oper. Hier ließ auch die angenehme, weich timbrierte Sopranstimme der Lauretta von Juanita Lascarro aufhorchen. Lyrisch intensiv sang Elza van den Heever die Giorgetta. Besonders ansprechend die höhensichere, weit ausschwingende Stimme der kurzfristig eingesprungenen Angelina Ruzzafante als Angelica. Mit dem inzwischen bereits erfolgsgewohnten Gastdirigenten Nicola Luisotti war Puccinis späte Opernmusik in den besten Händen. Chor und Orchester agierten und reagierten minuziös. Das "Trittico" gehört zu den modernsten, "impressionistischsten" Partituren des Komponisten; integriert sind scharf skandierende bitonale Klangwirkungen, ohne dass Schwung und Schmelz der kantablen Opernitalianità vernachlässigt wären. Die Farbigkeit und Beweglichkeit der Tonsprache waren in dieser Interpretation bestechender denn je. Eine opulente musikalische Schiffs- und Lebensreise fand statt. Eine grandiose Opern-Erfahrung. Die Frankfurter Oper, ein guter musiktheatralischer Hafen. Oper Frankfurt: 17., 19., 25., 27. Januar, 01., 03., 09., 14., 22. Februar. www.oper-frankfurt.de [ document info ] Dokument erstellt am 14.01.2008 um 16:36:02 Uhr Letzte Änderung am 14.01.2008 um 17:18:24 Uhr Erscheinungsdatum 15.01.2008 |
|
Totenschiff vor dem Kap der Klischees
[...] Schon immer haben sich Zweifel an der Ernsthaftigkeit und Tiefe von Puccinis Porträts geregt. Denn der Komponist überführt den Überdruck der von ihm vertonten Fiaskos gern in Eruptionen, bei denen sich Sänger und Orchester hemmungslos lautstark ausschluchzen und ausheulen. Das hat ihm den Ruf eines sentimentalen Kitschiers eingebracht. Allerdings ist dieser Ruf eher in der Aufführungstradition begründet als in den Partituren. Das wird auch in Frankfurt überdeutlich. Sobald im Anfangsstück Il tabarro (Der Mantel) die Bootsbesitzergattin Giorgetta und ihr Liebhaber Luigi ihre Leidenschaft und Sucht nach Sex artikulieren dürfen, da tun das Elza van den Heever, Carlos Ventre und der mit massivem Blech aufgerüstete Orchesterklang mit einer derartigen Verve, dass einem als Zuhörer die Ohren abzufallen drohen. Das ist die Apokalypse, der Gefühlsgau, das Ende der Dinge. Doch solch hemmungslose Entladung widerspricht dem Rest der Partitur, sie scheint einem völlig anderen Stück zu entstammen. Das kümmert aber niemanden. Zumal solches Operngebrüll einen mächtigen Eindruck beim Publikum hinterlässt. [...] Regisseur Claus Guth, einer der viel beschäftigten Opernmacher der Republik, hält die Drehbühne im Dauerbetrieb. Ausstatter Christian Schmidt hat darauf ein Totenschiff der Träume gebaut. Im Unterdeck ist die Schiffsbar untergebracht, oben ein Großraum mit Sesseln, in dem weiße Gestalten, offensichtlich Tote, reisen. Das Menschenleben als unendliche Seereise: kein wirklich aufregender Gedanke. Dieses Bühnenbild muss nicht nur für den Mantel herhalten, auch für die Kloster-Suizidgeschichte der Suor Angelica und die Erbschleicherei Gianni Schicchi. [...] Diese Einheitsbühne ist kein glücklicher Einfall. Wird dadurch doch eine Gemeinsamkeit der Stücke in Raum und Zeit behauptet, wo Puccini größtmögliche Kontraste in Raum und Zeit suchte. Als der Vorhang das dritte Mal in die Höhe geht und auch für Gianni Schicchi das vertraute Bild zeigt, ruft's aus dem Publikum enttäuscht: „Wie langweilig!" Was aber verbindet die drei Stücke jenseits der distanziert trocken erzählenden Musik? Der Tod. Mantel und Angelica sind Todesphantasien, beide Male spielt ein gestorbenes Kind eine Rolle, das bei Guth auch überflüssigerweise als süßer Todesengel herumläuft. [...] Allerdings hat Regisseur Claus Guth erwartungsgemäß mit dieser zutiefst katholischen Geschichte [der Suor Angelica] seine größten Probleme, mit der Angst vor der Todsünde, vor Selbstmord und dem finalen Erlösungswunder, das hier zu einer banal esoterischen Jenseitsvision verkommt. Auch Dirigent Luisotti wäre sehr viel stärker gefordert gewesen, mit der sentimentalisierenden Aufführungstradition in Sachen Puccini zu brechen, zugunsten von Objektivität, Härte, Distanz. So aber wird auch in Frankfurt die Chance vertan, die gängigen Einwände gegen diesen Komponisten zu widerlegen. REINHARD J. BREMBECK |
|
Claus Guth inszenierte die drei Einakter von Puccinis "Trittico" in Frankfurt als Variationen über den Tod Es muss einen roten Faden geben. Es muss eine Klammer geben zwischen Giacomo Puccinis Einaktern "Il tabarro", "Suor Angelica" und "Gianni Schicchi", die stärker ist als der schlichte Wunsch des Komponisten nach der Bündelung dreier Miniaturen zu einem musikdramatischen Triptychon. VON SUSANNE BENDA Regisseur Claus Guth, der jetzt für seine Inszenierung von Puccinis "Trittico" an der Frankfurter Oper nach einer solchen Verbindung suchte, fand sie: im Tod. Tatsächlich prägt in allen drei Einaktern mindestens ein Verstorbener die Handlung oder setzt sie in Gang. Der Tod allein erschiene einem indes als mindestens ebenso beliebiger Kitt wie etwa die Liebe. Wirklich zwingend wird Guths roter Faden deshalb erst durch Christian Schmidts drehbares Einheitsbühnenbild: Die räumliche und soziale Hermetik eines Kreuzfahrtschiffes spiegelt die Geschlossenheit der einzelnen Stücke wieder. Zwischen Leben und Tod, so die Vorgabe der Inszenierung, bewegt sich der schwere Tanker mit seinen hellen Räumen, den engen Treppen, mit seiner schicken Bar und dem Oberdeck, auf dessen Pullman-Sesseln vornehmlich weiß gewandete Statisten ruhen. Es sind die Toten. Sie sind überall, und sie sind viele. Auf der Bühne nimmt sie zwar keiner wahr, doch dem Publikum erklären sie die Opern-Welt. Ein weißer Knabe erinnert in "Il tabarro" ("Der Mantel") die Lebenden an ihre Vergangenheit, an Träume und Sehnsüchte, in "Suor Angelica" ("Schwester Angelica"), dem Herzstück des "Trittico", darf der Geist des im Stück zuvor erdrosselten Tenors noch einmal quer über die Bühne laufen, und schon bei den letzten Takten dieses Einakters sehen wir den alten Buoso Donati, wie er sich zum Sterben in jenes Bett legt, das bei "Gianni Schicchi" im Mittelpunkt des turbulenten Geschehens stehen wird. Dies alles lässt sich - abgesehen vielleicht nur vom allzu sentimental geraten Schluss des mittleren Werkes - auch deshalb mit Gewinn betrachten, weil Guth die Personen auf der Bühne fein zu führen und weil er sie zu Typen zu stilisieren weiß, die das dramatische, das lyrische und das komische Werk zu einem höchst unterhaltsamen Dreiteiler über menschliche Befindlichkeiten formen. Dafür, dass Puccinis Musik nicht bei der Spiegelung des Allzumenschlichen stecken bleibt, die ihr ja immer ein besonderes Anliegen ist, sorgt Nicola Luisotti am Pult des Frankfurter Museumsorchesters: Unter seinen wendigen Händen klingt Puccini wie gestreichelt; viele Details werden nicht nur präzise hörbar, sondern sie atmen, singen, und jeder Teil hat einen eigenen Klang. Gute Sänger sind im Ensemble - allen voran Elza van den Heever, die als sehr farbreiche Giorgetta in Frankfurt ein exzellentes Debüt feierte. Neben ihr gefiel der serbische Bariton Zeljko Lucic als Michele wie (vor allem) als enorm spielfreudiger Gianni Schicchi. Die Schweizerin Julia Juon (Frugola, Zia Principessa, Zita) löste ihre Aufgabe in gleich drei Partien mit großem dramatischem Impetus, Juanita Lascarro und Massimiliano Pisapia als Rinuccio und (schwangere!) Lauretta sind auch sängerisch ein bezauberndes Paar, und auch Angelina Ruzzafante als Suor Angelica machte ihre Sache so gut, wie man es einer kurzfristig aus dem Ensemble eingesprungenen Sängerin gar nicht zugetraut hätte. Am Ende gab es langen Beifall. Nach Frankfurt zu fahren hatte sich wieder gelohnt. So bildreich und detailgenau wie Claus Guth muss man Giorgettas traurige Feststellung erst einmal umspielen können: "Wie schwer es doch ist, glücklich zu sein!" |
|
Über den Fluss mit den toten Erinnerungen Von Götz Thieme Claudio Abbado, der bedeutendste italienische Dirigent unserer Tage, hat überhaupt keine Not mit Giacomo Puccinis Opern. Er ignoriert sie. Es ist vielleicht bezeichnend, dass nach dem Zweiten Weltkrieg zwei der zentralen Puccini-Interpreten keine Italiener gewesen sind: Herbert von Karajan und Carlos Kleiber. Sie haben den 1924 gestorbenen Komponisten ernst genommen, der am Ende seines Lebens merkte, dass er in eine Zeit hineinragte, die zunehmend nicht die seinige war. Karajan und Kleiber haben dort begonnen an den Partituren zu proben, wo die Kapellmeister und Maestri nach süffiger Arienbegleitung die Arbeit einstellten. Nicola Luisotti gehört seit langem wieder zu den Landsleuten des Komponisten, denen es der geniale Orchestrator, der Klangfarbenmagier angetan hat, die Puccini nicht zum MaxiLehár befördern, sondern zum Zeitgenossen von Claude Debussy. Auf die internationale Entdeckung des Dirigenten mit dem "Trovatore" 2002 können sich die Stuttgarter etwas zugutehalten, hier erfreute Luisotti sie außerdem mit "Otello" und "Madama Butterfly", künftig aber müssen sie auf ihn im Graben verzichten. Eine raketengleiche Karriere hat ihn über Wien, London und Paris nach San Francisco geführt, wo er von der Saison 2009/10 an als Chefdirigent wirken wird. Orchester mögen den 46-Jährigen, der zehn Jahre jünger ausschaut und sich in die Partituren stürzt, als sei er zwanzig. Beim Frankfurter Museumsorchester jetzt war es nicht anders, gerade rechtzeitig hatte der Frankfurter Opernintendant sich den Mann aus Viareggio für die Neuinszenierung von Puccinis "Il Trittico" geangelt. Aber Bernd Loebes Hoffnung, Luisotti für weitere Projekte zu gewinnen, wird schwer erfüllbar und teuer sein, obgleich Luisotti mit Loebes Ensemble zufrieden sein darf - so rasch findet sich nicht eine solche Sängerbesetzung. Der Dirigent hat ein fein entwickeltes Gehör für Puccinis Schattenklänge, die in den späteren Werken, von der "Butterfly" an, ein Hauptreiz dieser Partituren sind - die mit fesselnder Verdichtung aufrauschenden Phrasen sind für Luisotti ohnehin kein Problem. So hört man viele Farben in den Holzbläsern - von der Bassklarinette, den tiefen Flöten - und opake Streicherlinien. Stimmung entsteht durch Zeichnung: dass sich erste und zweite Violinen gegenübersitzen, trägt zur Deutlichkeit bei, hier verklumpt nichts. Das bekommt besonders dem ersten Stück des Triptychons, "Il Tabarro", ein atmosphärisches Panorama, das, von Luisotti genau gewichtet, nur zwei dynamische Höhepunkte kennt: das Liebesduett der untreuen Giorgetta mit dem Arbeiter Luigi und den brutal gezackten Schluss. So werden die scharfen Septimen im Drehleierwalzer zum bitteren Kommentar des sozialen Elends, und das Brummen der Kontrabässe hat pittoreske Schiffskahngemütlichkeit verloren. Diese Seine ist ein dreckiger Fluss, auf dem der eifersüchtige Michele der untreuen Frau den ermordeten Nebenbuhler vor die Füße kippt. Die musikalische Herausforderung bei der "Suor Angelica" liegt im Schluss mit seiner Nähe zum Klosterkitsch. Geweint wird beim Selbstmord der Schwester Angelika und der finalen Transfiguration ohnehin immer - aber wie genau da ein Dirigent hinhört und schlicht bleibt, keine Drüsenmassage betreibt, das macht den Unterschied. Luisotti kennt ihn genau. Zur Abrundung des Dreierschlags, die Erbschleicherkomödie um den ausgekochten Aufsteiger Gianni Schicchi. Der Dirigent dreht selbst hier, wo es naheliegt, nicht fett pinselnd auf. Im Parlandogewusel der geldgierigen Verwandten spürt er der Modernität in Puccinis Lakonie nach - und beinahe ist man erleichtert bei diesem konzentriert-inspirierten Musizieren, dass es in den letzten Takten ein wenig im Orchester wackelt, als ob man mit einem Ohr schon die verdienten Ovationen vorausahnt. Gegen die orchestrale Farbenpracht setzt der Regisseur Claus Guth mit dem Bühnenbildner Christian Schmidt auf ein kühles Konzept. Was verbindet die unterschiedlichen Einakter, fragten sie sich, und kamen wie etliche vor ihnen auf das naheliegende Thema des Todes. Der profunde Puccini-Biograf Dieter Schickling hat dafür wenig übrig: "Das verbindet mindestens zwei Drittel aller jemals geschrieben Opern." Gleichwohl, Acheron oder Styx, die Flüsse, die Lebenswelt und Totenreich trennen, gelten Guth und Schmidt als verknüpfendes Bildmotiv. Befahren werden sie vom Schiff der Toten, es ist eine Kreuzung aus hellweißem Kabinendampfer und Kanalfähre mit grünlichen Passagiersitzen, und bevölkert von den kalkgesichtigen Toten unserer Erinnerung. Unter ihnen der Junge, den Michele und Giorgetta verloren haben, woran ihre Ehe nun zugrunde geht; ebenso das Kind, das Angelika abgeben musste und das gestorben ist, bevor sie es wiedersehen konnte. Auch den getöteten Luigi sieht man zu Beginn der "Angelica" vorbeigeistern. Der reiche Buoso Donati schließlich, der leider das falsche Testament hinterlassen hat und die Kirche statt der Verwandten bedacht hat, äugt während des Schwanks über die Reling, und erlebt, wie sich Schicchi, der in seine Rolle geschlüpft ist, einen Gutteil des Erbes selbst vermacht. Diese Befrachtung der drei Handlungen in einem ansonsten ortlosen Heute, wie es Anna Sofie Tumas Kostüme andeuten, führt im Einzelnen zu schönen Momentaufnahmen, wirkt aber überambitioniert und manchmal prätentiös geheimnisraunend, wenn wieder hinter einem Milchglasfenster ein Toter die Hände an die Scheibe legt. Zieht man diese Parallelisierung des Geschehens ab, bleibt in der Summe sauberes Regiehandwerk mit etwas wenig Charakterisierungswitz beim "Schicchi". Das hat man überdrehter gesehen. Mehr schwarzhumorige Slapstickaktion dürfte sein, wenn der tote Buoso vorübergehend in die Badewanne befördert wird. Und das "Titanic"-Zitat, wenn die hier schwangere Lauretta zu ihrem Arienhit "O mio babbino caro" gleich Kate Winslet die Arme breitet wie in James Camerons Film, passt genauso wenig zur gemessenen Personenführung wie Schicchis Proletenausstattung beim Fußballgucken: Feinrippunterhemd, Adiletten, die fette Golduhr und die Bierdose gehören in die Asservatenkammer des Regietheaters. Am Schluss - eine der besseren Regiepointen - tappt auch Gianni Schicchi als Toter daher, erschossen von den betrogenen Verwandten. Schicchi ist eine Prachtrolle für jeden Bariton, dem die Bühnenrampensau in seiner Karriere nicht abhanden gekommen ist. Dem Star des Frankfurter Ensembles, Zeljko Lucic, ist sie körperlich nahtlos angepasst - und dem haarfransigen Lucic-Charme entzieht man sich schwerlich. Gleich rollendeckend glimmt ihm als Michele im "Mantel" die Mordswut in den Wolfsaugen. Längst macht der Sänger internationale Karriere. Sein Premierenauftritt war guten Flugverbindungen zu danken, denn am Tag vorher stand er noch auf der Bühne der New Yorker Met. Die von James Levine dirigierte "Macbeth"-Aufführung am Samstagnachmittag endete offensichtlich rechtzeitig. Womöglich deswegen erschien der Darsteller Lucic zwar agil, trumpfte aber als Sänger nicht wie gewohnt saftig-kernig auf. Gerade als Schicchi hätte es ein wenig mehr in der Basslage sein dürfen. Solche Reiseeskapaden gehören wohl zu den harten Bedingungen des Geschäfts, die ein Intendant zähneknirschend akzeptieren muss, wenn er mithalten will. Für die krankheitsbedingte Absage der Angelika vier Tage vor der Premiere fand sich dafür im Ensemble hervorragender Ersatz. Angelina Ruzzafante, als einmal nicht ätherische Weltfremde, vom Tugendpfad Abgekommene, sondern als eine Frau, die das Leben gekannt hat, sang unsentimental, kraftvoll und vorzüglich. Das weich geflutete hohe A am Ende ihrer Arie "Senza mamma" war ein Vorgeschmack auf das baldige, fantastisch leise hohe C, das man selten so rein hört. Überwiegend punktete die Aufführung mit genau abgestimmter Besetzung. Carlo Ventre sang mit körnig-rauchigem Timbre den Luigi, als Giorgetta debütierte Elza van den Heever mit hoher Sopranbegabung. In allen drei Opern präsent war Julia Juon, die aber als böse Fürstin in der "Suor Angelica" zu wenig fiese Alttöne mitbrachte. Ensemblecharaktere wie Claudia Mahnke, Juanita Lascarro als Lauretta und Carlos Krause sind ohnehin Frankfurter Stärken. Am Schluss gab es aufmunternde Buhs für Guth, der nach diesem Dreiteiler einen ungleich gewichtigeren Vierteiler angeht. Im März ist in Hamburg Auftakt zu seiner "Ring"-Deutung. |
|
Der Tod ist allgegenwärtig Von Michael Dellith Weiß gekleidete Gestalten, Boten zwischen Leben und Tod, sind auf der Bühne ständig präsent. Sie durchstreifen die Sphären von Diesseits und Jenseits, die nicht strikt voneinander getrennt sind. Auch die Protagonisten selbst tauchen als Tote auf – als Vorausblick auf ihr bevorstehendes Schicksal. Der Tod ist allgegenwärtig: Dies ist die Quintessenz, die der Regisseur Claus Guth aus allen drei Einaktern von Puccinis „Il trittico" gezogen hat. Wie ein roter Faden zieht sich die Auseinandersetzung mit dem Tod durch dieses von Guth als Zyklus begriffene Triptychon: Bei „Il tabarro („Der Mantel") wird nicht nur ein tödlich endendes Eifersuchtsdrama gezeigt. Auch die Vorgeschichte, die zum Bruch der Ehe zwischen dem Schiffer Michele und seiner Frau Giorgetta geführt hat, der Tod des gemeinsamen Kindes, wird vor Augen geführt. Ebenso erscheint bei „Suor Angelica" („Schwester Angelica") der uneheliche Sohn der Nonne auf der Bühne, von dessen Tod Angelica nur aus der Erzählung ihrer Tante erfährt – eine Nachricht, die Angelica in den Wahnsinn und schließlich in den Selbstmord treibt. Und auch beim dritten Einakter, der Burleske „Gianni Schicchi", ist der Tod nicht nur zu Beginn präsent, sondern auch am Ende als Bestrafung für den Titelhelden sichtbar. Claus Guth bringt Puccinis „Il trittico" nicht als historischen Bilderbogen auf die Bühne. Vielmehr lässt er alle drei Einakter in einer nicht näher bestimmten Gegenwart (Kostüme: Anna Sofie Tuma) spielen. Christian Schmidt hat dazu die passende Einheitskulisse auf der Drehbühne geschaffen: eine Art offenes Puppenhaus, das in klinisch kühlem Ambiente Räumlichkeiten eines Ausflugsschiffes – man denkt sofort an das antike Bild vom Totenschiffer Charon – offenbart, samt Bartresen, Treppen, Reling, Kabinen und einem Kinosaal – ein Konzept, das aufgeht, zumal Guth auch eine originelle, ausgefeilte Personenführung gelingt. So können die Einakter fließend ineinander übergehen. Fließend, das ist auch das Stichwort für das effiziente Klanggeschehen im Orchestergraben. Nicola Luisotti gab am Pult des Museumsorchesters einen glänzenden Einstand. Er befeuerte die Partitur mit Verve und Sinn für Farben und dynamische Kulminationen. Der so erzeugte Klangstrom trug die Sänger sicher durch die Wogen der Partitur. Männlicher Gesangsstar war – wie erwartet – Zeljko Lucic, der mit seiner Virilität die Bühne beherrschte, ob als betrogener Ehemann in „Il tabarro" oder als Schlitzohr Gianni Schicchi, wo er sein komödiantisches Talent voll ausspielte, aber stets die Kultiviertheit seines Baritons bewahrte. Als kleine Sensation wurde mit Recht die Sopranistin Angelina Ruzzafante gefeiert, die kurzfristig für die erkrankte Danielle Halbwachs eingesprungen war. Die Partie der Schwester Angelica wusste sie stimmlich grandios zu steigern, wobei sie in ihrer warmen, weichen und mütterlichen Anmutung perfekt für die Rolle war. Anrührender und natürlicher kann man diese Partie kaum gestalten. Elza van den Heever (Giorgetta) und Carlo Ventre (Luigi) sowie Juanita Lascarro (Lauretta) und Massimiliano Pisapia (Rinuccio) gaben voller Emphase die jungen Liebespaare, während Julia Juon und Carlos Krause als komische Alte in bester Commedia-dell’-Arte-Tradition den Kollegen fast die Schau stahlen. Die engelsgleich intonierenden Chordamen (Einstudierung: Alessandro Zuppardo) vervollständigten dieses rundum positive Bild des Premierenabends, der das enorme Leistungsvermögen des Frankfurter Opernhauses einmal mehr bestätigte. Die wenigen Buh-Rufe für die Regie gingen am Ende im großen Premieren-Jubel unter. |
|
Ein Schiff als Ort des Übergangs Von Axel Zibulski
Großartige Besetzung: "Il tabarro" mit Zeljko Lucic (Michele, links), Carlo Ventre (Luigi) und Elza van den Heever (Giorgetta) in Frankfurt. Foto: Rittershaus FRANKFURT Jener Pariser Schleppkahn, auf dem mit "Il tabarro" die erste Oper von Puccinis "Il trittico" spielt, gibt den Anstoß: In Claus Guths Frankfurter Neuinszenierung dieser drei Einakter ist das Schiff, wie im antiken Mythos, Ort des Übergangs vom Leben in den Tod. Und so wirkt es konsequent, wenn die immer wieder mittels der Drehbühne verschobenen Kammern auf zwei Ebenen auch den Raum für die beiden weiteren Opern bilden, für die in einem Kloster spielende "Suor Angelica" ebenso wie für jenen "Gianni Schicchi", der von einer Episode aus Dantes "Göttlicher Komödie" inspiriert ist. Denn um den Übergang zwischen Leben und Tod geht es in allen drei Stücken, deren Handlungen zwar völlig unabhängig voneinander ablaufen, zwischen denen Guth damit aber eine äußerst plausible Klammer gefunden hat. Weitgehend frei von veristischen Schauereffekten erzählt Guth die Dreiecksgeschichte "Il tabarro" ("Der Mantel"). Das proletarische Opern-Personal versammelt sich an der Bar. Für Träume sorgt Hochprozentiges, und am Ende rollt nicht, wie im Libretto vorgesehen, der tote Liebhaber aus dem Titel gebenden Mantel des betrogenen Ehemanns. Vokal ist das Eröffnungsstück großartig besetzt, mit Carlo Ventre als tenoral sattem und strahlkräftigem Liebhaber Luigi, mit Elza van den Heever als dramatisch durchschlagender Giorgetta, deren Gatten Michele Frankfurts Ensemblemitglied Zeljko Lucic mit gewohnt hoher Kultiviertheit gibt. Auf dem Oberdeck des Schiffs, in dem weiß gekleidete Gestalten wie in einem Totenreich versammelt sind, haben in "Il tabarro" schon einmal die Nonnen aus "Suor Angelica" Platz genommen, die in ihrem Kloster in Frömmelei und Aggressionen flüchten. Ihre Schwester Angelica wurde nach der Geburt eines unehelichen Sohnes von ihrer Familie dorthin verbannt; von ihrer Tante, die Julia Juon auch vokal treffend herb und kühl anlegt, erfährt sie en passant vom Tod des Sohnes. Ein Junge lässt dabei ein Papierschiffchen aus dem "Totenreich" der Bühne herabfallen - einer der großartigen poetischen Momente der Inszenierung. Angelina Ruzza- fante sang in der Premiere die Titelpartie als nervenstarke Einspringerin für die erkrankte Danielle Halbwachs. Schließlich "Gianni Schicchi": ein Triumph fürs Frankfurter Ensemble, das die geprellte, erbgierige Verwandtschaft mitreißend verkörpert, ein Triumph für Zeljko Lucic in der Titelpartie und für das Museumsorchester (Leitung: Nicola Luisotti), ein Triumph auch für Regisseur Claus Guth, der das Schlussstück zum humorvollen und spritzigen Kabinettstück werden lässt. Am Ende ein Schuss hinter der Bühne, der nicht im Libretto steht. Dann reiht sich auch das Schlitzohr Schicchi bei den Toten ein. Die letzte Gerechtigkeit trifft eben jeden. |
|
Keine Erlösung aus Schlamassel Giacomo Puccinis Einakter-Folge "Il Trittico" durchschlagender Publikumserfolg an Oper Frankfurt
Auf dem Oberdeck: Zeljko Lucic (Michele) und Elza van den Heever (Giorgetta) in „Il Tabarro". Foto: Monika Rittershaus Ob mörderisches Sozialdrama, Selbstmord einer Ordensfrau oder burleske Erbschleicher-Komödie: Der Tod ist in Puccinis Einaktern "Il Trittico" präsent. Auch in Claus Guths Neuinszenierung von "Il Tabarro" (Der Mantel), "Suor Angelica" (Schwester Angelica) und "Gianni Schicci", zur Premiere in der Oper Frankfurt ein Publikumserfolg. Weil der Regisseur in starken Bildern und eindringlichen Szenen zeigt, dass es keine Erlösung aus menschlichem Schlamassel gibt. Weil Niccola Luisotti dies samt ungemein flexiblem Museumsorchester druckvoll untermauert. Und weil das Ensemble um Noch-Mitglied Zeljko Lucic, verstärkt von wenigen Gästen, wieder einmal der Star ist. Selbst der immense Personalaufwand und eine kurzfristige, krankheitsbedingte Umbesetzung bringen die Frankfurter kaum noch in Verlegenheit. Christian Schmidts kompakte Bühne mit Bad, Schlafzimmer, Bar, Veranda, Kapelle und Oberdeck vereint verschiedene Spielorte und überwindet zeitliche Distanz, mal Schiff, mal Kloster, mal Privathaus. Eine Treppe geleitet in eine Art Oberwelt, von weiß gewandeten Wesen bevölkert, die eine unsichtbare Anzeigentafel anstarren oder an den Wänden lauschen. Ein engelhafter Knabe verbindet diese kühle Totenwelt mit den in warmes Licht getauchten Niederungen des Menschseins. Er spielt mit einem Papierschiffchen, Symbol für die letzte Reise - Guth versteht es, Menschheitsmythen ironisch auf Abstand zu halten. Der Tod des Jungen ist Auslöser für eine mörderische Dreiecksgeschichte zwischen Pariser Schiffern. Unfähig, den Vater zu lieben, der die Ehe zu retten versucht, geht seine Mutter ein fatales Verhältnis mit einem Arbeiter ein, ertappt vom Ehemann, der den Liebhaber erwürgt. Ein tristes Milieu, das Puccini gnadenlos in durchkomponierten, expressionistisch anmutenden Klang überführt, mit Strawinsky vorwegnehmenden Schrägständen. Sentiment ist allenfalls als Selbstzitat (aus "La Bohème") zugelassen, im leidenschaftlichen Aufschwung, im breiten Klangstrom, im munteren Tänzchen, enervierende Momente, die der Dirigent wie abrufbereit hält, ein erstaunliches Temperament am Pult. Bariton Lucic erlebt auch stimmlich jenen seelischen Druck, der die Katastrophe auslöst - später gibt er als Schicchi intensiv den windigen Drahtzieher. Wie Mezzosopranistin Julia Juon, eine Lumpensammlerin, deren Visionen vom besseren Leben anrühren. In allen drei Einaktern präsent, wird sie noch mit eiskalter, schneidender Stimme die Fürstin singen und als komische Alte starke Bühnenpräsenz bekunden. Unverkennbar Carlos Krause, ob verhärmter Hafenarbeiter oder durchtriebener, geldgeiler Bürgermeister in "Gianni Schicchi": Sein Bassbariton gehört noch nicht zum alten Eisen. Ungemein stark Carlo Ventres Tenor als Liebhaber, reich an Substanz, Hochtöner mit beeindruckenden italienischen Momenten. Oder Elza van den Heever als unselige Mutter auf der Suche nach etwas Glück, ein starker Sopran auch von innen heraus. Dauerhafte Gebete und ein unendlicher Ave-Maria-Strom von den zu Klangsamt verpflichteten Chören (Alessandro Zupardo, Apostolos Kallos, Kinderchor) bestimmen "Suor Angelica". Die Einspringerin wird zur unmittelbar berührenden Heldin. Angelina Ruzzafantes seelenvoller Sopran ist in der Todesszene - als sie erfährt, dass ihr unehelicher Sohn tot ist, begeht sie Selbstmord - bei diffusem Orchesterklang zu gnadenloser Härte fähig. Der Kitschfalle entgeht Guth souverän. Todsünderin Angelica bittet die Jungfrau Maria um Errettung und wird mit dem Sohn vereint - in der Oberwelt, dem Aufenthaltsraum der Seelen. Auch bei der finalen Buffo-Nummer einer nur aufs Geld erpichten Mischpoke sind die Toten gegenwärtig. Ansonsten stellt Guth den ironischen musikalischen Anmerkungen köstliche Tableaus zur Seite und vertraut aufs komische Drehmoment des Ensembles, dem ein Sammellob gebührt. Mit Lucic als Schicchi, der lieber Fußball im TV schaut und erst von seiner verliebten Tochter (stimmlich quirlig, mit Liebesglut von der Empore: Sopranistin Juanita Lascarro) zum Erb-Betrüger mutiert, was tödlich für ihn endet. Aus dem Off bittet er um mildernde Umstände, wird aber gnadenlos zur Hölle geschickt. Wünscht dennoch einen amüsanten Abend gehabt zu haben. In der Tat! Nur den dünnbrüstigen Buhrufern gefiel’s wohl eher nicht ... KLAUS ACKERMANN |
|
Kreuzfahrt auf einem Totenschiff Musiktheater: Claus Guth inszeniert Giacomo Puccinis drei Einakter „Trittico" (Triptychon) in Frankfurt Wie Bach, Bartók oder Schönberg ließ sich Giacomo Puccini in den Bann der Magie von Zahlen ziehen. Die Drei, seit jeher Sinnbild von Vollkommenheit, ist in diesem Zusammenhang nicht nur mit den drei Rätseln der Prinzessin Turandot exponiert, sondern manifestiert sich nachhaltig in Puccinis „Il Trittico", jener 1918 an der New Yorker Metropolitan Opera uraufgeführten Trilogie, in der Puccini in einer abendfüllenden Folge drei Einakter zusammenführt. Diese sind – was Stoff, Milieu, Ort und Zeit betrifft – völlig unterschiedlich. „Il tabarro" (Der Mantel), ein veristisches Dramolett, schildert eine Eifersuchtstragödie unter Pariser Schiffsleuten um 1900. „Suor Angelica", eine rührselige Legende, spielt in einem Nonnenkloster zur Zeit der ausgehenden Renaissance. Und „Gianni Schicchi", eine von Dante entlehnte Schelmengeschichte, ist mit 1299 zu datieren: Ein reicher Florentiner ist gestorben und hat seinen Besitz der Kirche vermacht. Die Verwandtschaft flippt aus, Gianni Schicchi muss her. Während die Leiche versteckt wird, nimmt der vermeintliche Freund den Platz des Verstorbenen ein, diktiert das Testament neu und schanzt sich und seiner Tochter den Löwenanteil des Erbes zu. Drei Stücke, die wie eine klassische Sinfonie oder eine Sonate mit dramatischer Eröffnung, lyrischem Mittelteil und turbulent-burleskem Finale anmuten, sich aber auf der Bühne schwer unter einen geistigen Bogen stellen lassen. Dies ist Claus Guth in seiner Frankfurter Neuinszenierung indes gelungen: Bei den „versteckten, unterirdischen Kanälen" interessieren den Regisseur vor allem die „unsichtbaren Linien zu den Toten", denn der Tod ist in allen drei Einaktern präsent. Als Metapher eines Totenschiffs stellt die Bühne (Christian Schmidt) Segmente eines Kreuzfahrtdampfers, zweistöckig mit Kabinen, Ruheraum, Bar, Treppe und Reling, dar. Wie in Sartres „Le jeu est fini" sind die Toten, hier als weiß gekleidete, im Zeitlupentempo schleichende Gestalten, ins Geschehen eingebunden und vermischen sich auf der gemeinsamen Fahrt ins Totenreich mit den Lebenden zu einer untrennbaren Schicksalsgemeinschaft. In der düsteren Flussschifferballade „Tabarro" wird für Giorgetta (mit leidenschaftlichem Sopran, dramatisch explodierend: Elza van den Heever in ihrer ersten Frankfurter Rolle) die kleine Schiffswelt zwischen Betten und Herd zum Gefängnis. Im großen Duett-Aufschwung mit ihrem Liebhaber Lucio (tenoral glänzend, mit Heldenkontur: Carlo Ventre) sehnt sie sich nach einer Familienidylle im Grünen. Ihr Mann Michele (mit kraftvollem Bariton: Îeljko Luãiç), der Besitzer des Schlepperkahns, den die Eifersucht zum Mord an Lucio treibt, lebt ganz in der Vergangenheit und seinen Erinnerungen. Ungemein fesselnd, auch in der sozialkritischen Milieuschilderung der Besatzung, deren abgewetzte Klamotten und Signalwesten (Kostüme: Anna Sofie Tuma) seltsam querstehen zum Designerchic des Schiffsinterieurs, gelingt Claus Guth, der früher am Staatstheater in Darmstadt häufig inszeniert hat, die Vermittlung dieses Dramas. Klaustrophobisch beklemmend, völlig fern von Devotionalienkitsch, wirkt auch das reine Frauen-Stück: Im Umkreis geschwätziger Nonnen, die sich mit 3-D-Brillen offensichtlich auf dem Weg zur Erleuchtung wähnen, gibt es für die todessehnsüchtige Schwester Angelica (kurzfristig eingesprungen aus den Reihen des hochmotivierten Frankfurter Ensembles, mit berührenden Pianissimo-Höhen: Angelina Ruzzafante) kein Entrinnen aus dem Seelenknast. Karnevalsstimmung schließlich in Nummer drei des „Trittico". In der vom Mittelalter in die Gegenwart katapultierten Posse vom Spaßmacher, der eine bigotte Gesellschaft von Erbschleichern um ihren Vorteil bringt, kann sich der stimmgewaltige, erzkomödiantische Bariton Îeljko Luãiç in der Titelrolle des Gianni Schicchi voll ausleben. Juanita Lascarro (Lauretta) und Massimiliano Pisapia (Rinuccio) sind ein jubelndes Liebespaar mit stimmlichen Höhenflügen bei ihrer Lobpreisung des heimatlichen Florenz. Doch selbst in dieser Komödie spielt der Tod mit. Und sogar Gianni Schicchi bleibt am Ende – wie bei Dante vorgegeben – der Weg in die Hölle nicht erspart. Am Dirigentenpult agierte temperamentvoll der ausgewiesene Puccini-Spezialist Nicola Luisotti, designierter Musikdirektor der San Francisco Opera. Im „Mantel" kehrte er mit dem Frankfurter Museumsorchester die veristischen Realitäten der Puccini-Partitur hervor und formte, über die impressionistischen Valeurs hinausgehend, ein ungemein modern tönendes, in den Drehorgelwalzer-Dissonanzen an Strawinski erinnerndes Klangbild. Feine Schattierungen, gleichsam aus den vier einleitenden Glockenschlägen entwickelt, bestimmten „Schwester Angelika", pralle Orchestervirtuosität mit satten Farben den „Gianni Schicchi". Insgesamt eine umjubelte, großartige Frankfurter Produktion, die besondere Anerkennung verdient, da es sich bei fast allen Protagonisten des Premierenabends um Rollendebüts handelte. |
|
Das Totenschiff gibt keinen preis (...) Wer in Il tabarro den romantischen Lastkahn und das Seine-Milieu erwartet oder in Gianni Schicchi den Florenz-Prospekt, wird in dieser Inszenierung nicht auf seine Kosten kommen. Sie ist zu ernst, zu intelligent, zu perspektivenreich für den normalen Opernkonsum. Dabei führt Claus Guth seinem Konzept eine oft hinreißende Theatralität zu, belichtet scharf Personen und Situationen, legt deren Nervenstränge in Bewegungen und Haltungen bloß. Auch Poetisches fehlt nicht, wie der kleine gestorbene Junge Giorgettas und Micheles, der ein winziges Papierschiffchen wie ein Leitmotiv durch alle Szenen trägt. Die Aufführung gewinnt ihr großes Format aber auch durch eine hinreißende musikalische Darstellung aller drei Werke. Nicola Luisotti, trotz seiner Jugend bereits hoch gehandelter Dirigent an den großen Opernbühnen, zaubert aus dem Frankfurter Opernorchester die schönsten Puccini-Klangfarben hervor, scheut nicht dramatische Schlagkraft und melodischen Schmelz, demonstriert, was für ein raffiniert komponiertes Stück Suor Angelica ist, und behält bei allem den befeuernden Blick für die Sänger auf der Bühne. Diese revanchieren sich mit großem Gesang und lebendigstem Spiel. (...) (...) Puccini, der sich einstmals in die häufige Zerlegung seines Trittico resigniert fügte, würde sein Plazet nach dieser Aufführung womöglich widerrufen. Vielleicht war er ja sogar als weißer Schatten auf dem Sonnendeck inkognito anwesend. Auf einem Totenschiff geht niemand verloren. GERHARD ROHDE |
|
Frankfurt am Main TRITTICOMord, Selbstmord, Betrug. Es geht kriminell zu in Puccinis Opern-Trilogie Il trittico. 3 Kurz-Opern zum Jahresanfang. Ein Fest mit überwältigenden Sängerleistungen. Zeljko Lucic erweist sich als hinreißender Komödiant in Gianni Schicchi, dem Schlussteil, in dem ein gerissener Gauner erbgeile Hinterbliebene ums Erbe prellt. Irre witzig. Anfangs, als düsterer Seineschiffer in Der Mantel, ermordet er den Liebhaber seiner Frau. Nachdem Elza van den Heever und Carlo Ventre ausgiebig in verwehrtem Liebesglück schwelgten. Das Bühnenbild ist schön, aber falsch. Kreuzfahrtschiff statt Schleppkahn, es stimmt auch später nicht, macht aber zunehmend Sinn, wird zu Puccinis Totentraumschiff. Im Mittelteil geht Schwester Angelica, für Fehltritt büßende Nonne in den Tod, als sie von böser Tante erfährt, ihr Sohn sei vor Jahren gestorben. Angelina Ruzzafante, kurzfristig eingesprungen, singt mit Inbrunst, wird zur Königin des Abends. An ihrer Seite brilliert Julia Juon als böse Alte. Optisch ein Genuss, musikalisch brillant, stimmig inszeniert. Das Orchester unter Nicola Luisotti wächst über sich hinaus. Berechtigter Jubel. Wertung: TOLLJosef Becker |
|
Zwischen Leben und Tod Kritik von Andreas SchubertObwohl als abendfüllende Operntrilogie gedacht, wird Puccinis Il Trittico nur selten in dieser Form gespielt. Stattdessen hat es sich eingebürgert, die Einakter Il tabarro, Suor Angelica und Gianni Schicchi in variablen Konstellationen aufzuführen. Meist entfällt dabei die mittlere (und gemeinhin als wenig publikumswirksam angesehene) Suor Angelica, so dass ein wohlproportionierter Doppelabend entsteht. Ebenso üblich ist es, den in jedem Opernführer als Geniestreich gepriesenen Gianni Schicchi mit gefälligen Einaktern anderer Komponisten zu kombinieren. Die Oper Frankfurt ist diesen bequemen Weg nicht gegangen und hat als vierte Premiere der Saison das komplette Trittico angesetzt – ein reizvolles, aber auch ambitioniertes Projekt. Denn einerseits ist der Zyklus kaum einem Orchester geläufig und fordert ein großes, mit vielen ersten Kräften besetztes Sängerensemble, andererseits stellt er das Regieteam vor die Herausforderung, drei in ihrem Charakter beinahe diametrale Stücke in den dramaturgischen Rahmen eines Opernabends zu fügen. Ausgereifte Regiearbeit, maßvoll umgesetzt Doch gerade letzteres ist in der Frankfurter Inszenierung von Claus Guth hervorragend geglückt. Mit analytischem Blick und einem sicheren Gespür für innere Zusammenhänge ist es dem zurzeit international gefragten Regisseur gelungen, die Einakter szenisch fest miteinander zu verbinden, ohne dass dies die Eigenständigkeit der Werke gefährdet. Bestimmender Faktor von Guths Interpretation ist der Tod. Als roter Faden durchzieht er die Stücke, ist Agens der Handlungen, Start- und Endpunkt zugleich. So wenig originell dieser Ansatz auf den ersten Blick scheint, so brillant ist Guths Konzeptualisierung. Er verlegt die Handlung aller Stücke auf ein Schiff, das, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen, ‘zwischen Lebenden und Toten kreuzt.’ Das kühle Bühnenbild (Christian Schmidt) ist durch den klugen Einsatz der Drehbühne flexibel bespielbar und gliedert sich in mehrere Räume, die den beiden Existenzbereichen klar aber undogmatisch zugeordnet sind. Unten die Lebenden: ihren Leidenschaften verfallen, mit ihrem Dasein hadernd, ihre Interessen verfolgend. Oben die Toten: weiß gekleidet, der Materialität entzogen aber – und das ist der zentrale Regiecoup – alles andere als unbeteiligt. Denn Guth lässt die Sphären ebenso subtil wie symbolträchtig interagieren und erreicht damit eine Verzahnung der Stücke, die so natürlich wirkt, dass man das oft praktizierte Auseinanderreißen des Trittico nur mehr als grundfalsch empfinden kann. So sieht man zu Beginn von Suor Angelica, wie der in Il tabarro ermordete Luigi ins Totenreich gerufen wird, während die von Angelica bereitete Medizin für den schon im Sterben liegenden Buoso aus Gianni Schicchi bestimmt ist. Dieser wiederum steigt in der Schlüsselszene der bitterbösen Komödie noch einmal herab, um seine pietätlosen Verwandten einzeln mit durchdringendem Blick zu mustern. Indem Guth darüber hinaus einen Einfluss der Toten auf die Lebenden andeutet (die verstorbenen Kinder von Michele und Giorgetta bzw. Angelica treten mittelbar in Kontakt mit ihren Eltern), entwickelt er die Amor-Figur aus seinem Salzburger Figaro, die ja auch Unsichtbares sichtbar zu machen sucht, konsequent weiter. Das Publikum honorierte diese ausgereifte und maßvoll umgesetzte Regiearbeit mit entschiedenem Applaus und vielen Bravorufen, gegen die ein paar subversive Buhs vom dritten Rang nicht die mindeste Chance hatten. Ein Star, zwei Neuentdeckungen und ein tolles Ensemble Musikalisch gestaltete sich der Abend höchst befriedigend, was vor allem an der herrlichen Stimmungsmalerei lag, die Nicola Luisotti am Pult des Frankfurter Museumsorchesters hervorbrachte. Mit seinem balancierten Dirigat verstand er es, Puccinis Klangwogen in ihrer ganzen Farbenpracht ausspielen zu lassen, ohne die Sänger dabei jemals in Bedrängnis zu bringen – eine Leistung, die darauf hoffen lässt, dass der designierte Musikdirektor der San Francisco Opera für weitere Produktionen in Frankfurt gewonnen werden kann. Dasselbe gilt für Zeljko Lucic, der das Ensemble in absehbarer Zeit zugunsten seiner internationalen Karriere verlassen wird. Mit klangschönem, in allen Lagen durchgebildetem Material triumphierte der Starbariton nicht nur als Michele im tabarro, sondern präsentierte sich in Gianni Schicchi auch als talentierter Komödiant – zwei Rollendebüts, die die Vielseitigkeit des sonst auf dramatische Verdi-Partien abonnierten Sängers unterstrichen. Im tabarro wurde Lucics Leistung von der seiner Partnerin Elza van den Heever insofern noch übertroffen, als diese ihr Hausdebüt gab und das Publikum somit nach allen Regeln der Kunst überrumpeln konnte. Die Südafrikanerin sang eine Giorgetta, die alles hatte, was man sich für diese Partie wünscht: Natürlichkeit, Timbre und nicht zuletzt fokussierte Spitzentöne, die das Orchester mühelos überstrahlten. Ein Name, den man sich merken sollte. Als Luigi überzeugte Carlo Ventre mit stählernem Tenor, dessen Klang in Mittellage und Tiefe aber von kehligen Nebengeräuschen beeinträchtigt wurde. Das zweite erfolgreiche Hausdebüt gab es in Suor Angelica. Für die erkrankte Danielle Halbwachs übernahm die ursprünglich als Genovieffa vorgesehene Angelina Ruzzafante kurzfristig die Titelpartie und lieferte ein eindringliches Portrait der suizidalen Nonne, das nur von einigen Höhenschärfen getrübt wurde. Als Fürstin strahlte Julia Juon eine eisige Präsenz aus und bestach mit sicher geführtem, die Rolle klanglich optimal ausleuchtendem Mezzosopran. Überhaupt gebührt Juon ein Extralob, da sie als Einzige in allen drei Opern mitwirkte und sich dabei als exzellente Charakterdarstellerin empfahl. Gianni Schicchi schließlich geriet – nicht zuletzt aufgrund der gut durchdachten Personenregie – zu einer beispielhaften, auch von einer durchweg ansprechenden Besetzung der kleinen Partien getragenen Gemeinschaftsleistung (besonders hervorzuheben: Claudia Mahnke, Daniel Behle und Thomas Charrois). Das junge Liebespaar wurde von Juanita Lascarro und Massimiliano Pisapia charmant verkörpert, einzig Lascarros ‚O mio babbino caro’ blieb stimmlich zu blass, um einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. |
|
Giacomo Puccini Il Trittico Puccinis Einakter wurden seit über zwei Jahrzehnten nicht in Frankfurt gespielt. Euphorisch gefeiert wurde nun die Premiere in der Inszenierung von Claus Guth. Guth läst alle drei Stücke in einem Einheitsraum (Bühne: Christian Schmidt) spielen. Diesem Luxusdampferambiente fehlt leider Charme und Geschichte, sodass im Publikum die Ermüdungserscheinungen darüber bei Vorhangöffnung des dritten Teils nicht zu überhören waren. Kostüme (Anna Sophie Tuma) und Raum wirken nicht aufeinander abgestimmt. Stilistisch schwankt der Abend zwischen Realismen und ästhetischem Konzeptdenken. Dennoch besticht Guths Regie durch eine sehr detaillierte und konzentrierte Personenführung. Gerade im Tabarro wird minutiös die Spannung fein aufgebaut. Das sich Belauschen und Belauern, der „Suspense" und das Timing stimmen exakt. Tote in engelsweißem Gewand schleichen stets präsent über die Bühne: mir zu überladen und deutlich, wobei der Moment der Begegnung Suor Angelikas mit ihrem verstorbenen Sohn ergreifend wurde. Im Gianni Schicchi wird die Regie streng choreographisch, was der Handlung klärend zugute kommt. Herrliche Details wie die angedeutete Schwangerschaft Laurettas oder Schicchis proletarische „Türkenkoffer"-Herkunft sollen nicht unerwähnt bleiben. Musikalisch ist der Abend wieder mal vom Feinsten. Die Oper Frankfurt besticht im Moment auch in Repertoirevorstellungen durch das hohe Niveau in diesem Bereich. Ob Ensemble oder Gäste, es gab keine Ausfälle. Zeliko Lucic, dessen balsamischem Bariton-Organ die höhere Verdi Tessitur noch mehr liegt, wie man eindrucksvoll am Vorabend aus der Metropolitan Opera ihn Macbeth singend, hören konnte, bringt zwei völlig konträre Charaktere wie den Michele im Tabarro und den Schicchi auf die Bühne. Sein weiches Timbre konnte sich im Tabarro nicht immer ganz durchsetzen, dafür überrascht er mit von ihm völlig ungewohnten, komischen Farben in der Bufforolle. Er ist und bleibt hoffentlich noch lange eine Fixpunkt für die Oper Frankfurt. Carlo Ventre ist ein Luigi aus dem Bilderbuch: uneitel mit herrlicher Höhe und großer Emphase. Eine Entdeckung ist die junge hingebungsvoll spielend und singende Giorgetta von Elza Van Der Heever. Erotisch im Timbre und der Ausstrahlung. Die kleineren Mantelpartien sind souverän besetzt mit Hans-Jürgen Lazars stimmstrahlendem Tinca und Carlos Krauses mehr knorrig, als schönstimmigem Talpa. Daniel Behle verkauft wohlklingend Mimis Lied und auch Karina Kardaschewa und Ricardo Ittura als junges Liebespaar können gefallen. In der Suor Angelika springt recht kurzfristig Angelina Ruzzafante als Titelsängerin ein. Mit großer Courage, weißer, aber dadurch unschuldig wirkender Stimme kann sie sehr für sich einnehmen. Unter den ungezählten Mitschwestern sollen Claudia Mahnke als strenge Zelatrice, June Card als altersweise Äbtissin, Magdalena Tomczuk als vorlaute Novizin, Elteva Rulfs als dramatisch besorgte Pflegerin und Sylvia Hamvasi als zarte Genoveva hervorgehoben sein. Im Gianni Schicchi macht die Verwandtschaft ihre Sache sehr bourlesk und spielfreudig. Zu den Vorigen stoßen beherzt Franz Mayer als Betto und Nathaniel Webster als Marco dazu. Massimiliano Pisapia singt seinen Rinuccio herzhaft unbekümmert, technisch nicht sehr fundiert, dafür umso lockerer seine heikle Florenz Arie. Juanita Lascarro malt zerbrechliche Laurettafarben mit Ironie und filigraner Stimmgebung. Dietrich Volle als sonorer Notar, Thomas Charrois als wunderbare Quaksalberkarikatur, aber auch Jimmy Mosebach, Walter Jäkel und Matthias Holzmann tragen zur Erheiterung des Geschehens bei. Heimlicher Star für mich ist an diesem Abend die Mezzosopranistin Julia Juon. In allen drei Stücken zeigt sie unterschiedlichste Farben, stimmlich makellos schön und immer focussiert. So die schusselige Raumpflegerin im Tabarro (Frugola), eine eiskalte Adelige (Principessa) im Mittelteil und die geldgierige Zita im Schicchi. Ein großes Kompliment für diese Leistung bringt ihr auch einhellig das Publikum entgegen. Nicola Luisotti leitet das Museumsorchester auf allerhöchstem Niveau. Bestens diese Literatur kennend begeleitet und führt er zugleich, wenn er auch manchmal die Sänger an ihre Lautstärkegrenzen aus lauter Begeisterung heraus treibt. Einhelliger Jubel in Frankfurt. Damian Kern |
|
Drei als eins Giacomo Puccinis Drei-Opern-Einakter "Il Trittico" stand in Frankfurt am Main auf dem Opernplan. "Ich habe das nie so überzeugend aktualisiert gesehen", lobt Thomas Vogt. Michael Köhler: Ein bisschen klösterlich geht es bei unserem nächsten Teil weiter, wir wechseln zur Opernbühne: Je eine Episode aus den drei Teilen von Dantes "Divina Commedia" zu einem Zyklus zu verbinden, das war Grundidee für Giacomo Puccinis abendfüllende Drei-Einakter-Oper "Il trittico". "Il tabarro", der Mantel, ein Milieudrama, ein packendes Eifersuchtsdrama, "Schwester Angelica" und "Gianni Schicci", das sind die drei Teile, aus denen der Abend besteht. Frage an den Kollegen Thomas Vogt: Gibt es bei diesen drei Opern-Einaktern ein verbindendes Thema?Thomas Vogt: Ja, das war schon immer die Frage, gleich nach der Uraufführung 1918 in New York hat man sich gefragt, was haben die drei Stücke eigentlich miteinander zu tun? Und das führte im Verlauf der Aufführungsgeschichte auch zu merkwürdigen Konstruktionen, dass man ein Stück weggelassen hat, nämlich die "Suor Angelica" - das Mittelstück - meistens, ausgerechnet das, was Puccini am meisten am Herzen lag, oder dass man das mit anderen Stücken, zum Beispiel "Gianni Schicci" und "Salome" hat man mal in der Met kombiniert, aus welchem Grund auch immer, ja, weil die eine Pause brauchten, und das war es. Köhler: Hat man auch die Reihenfolge manchmal auf den Kopf gestellt? Vogt: Die Reihenfolge auf den Kopf gestellt, alles mögliche mit anderen Stücken kombiniert, was Sie wollen. Und der Regisseur Claus Guth hat eben zeigen wollen, dass diese drei Stücke wirklich eine Verbindung haben, und diese Verbindung, da könnte man natürlich jetzt oberflächlich erst mal sagen, sie handelt von Leben und Tod, aber das handeln ja fast alle Opern. Das Verbindungsstück ist das Eingeschlossen-Sein, das Nicht-Entkommen-Können. Das Eifersuchtsdrama spielt auf einem Kahn, das hat Guth genommen als Anlass … Köhler: Das ist "Il tabarro". Vogt: "Il tabarro", der Mantel, das Ganze auf einem, na ja, nicht gerade Traumschiff, aber auf einer Art Luxusliner spielen zu lassen, und bietet einen Querschnitt mit dem üblichen Treppenhaus, was ja gern bei Claus Guth in der Inszenierung ist, und verschiedenen, na ja, Kajüten kann man nicht sagen, das sind schon nette Appartements. Und auf dem Oberdeck befinden sich weißgekleidete Tote, die Leute, die in dem Stück sterben, werden dann eben auch weißgewandet, gehen die Treppe rauf und nehmen dann auf dem Oberdeck Platz. Dieses Bühnenbild zieht sich also durch alle drei Stücke, ist die Verbindungsklammer und macht auch plausibel: Es geht darum, man kann dem Schicksal und dem Raum, in dem man sich aufhält, nicht entkommen, man kann höchstens einen anderen Raum betreten, aber man kommt von dem Schiff nicht runter. Köhler: Frage: "Schwester Angelica", haben Sie eben im Nebensatz gesagt, sei sein Lieblingsstück gewesen. Da gibt es persönliche Gründe für, er kommt aus einer religiösen Familie, die Schwester war im Kloster und so weiter. Vogt: Genau. Köhler: Das ist ein ganz hartes, schweres, unglaublich dramatisches Stück über eine Nonne im Kloster. Vogt: Ja, Selbstmord einer Nonne, die dann erfährt, dass ihr Kind - das ist ein uneheliches wahrscheinlich, und deswegen musste sie auch ins Kloster -, es wird ihr mitgeteilt, dass das schon zwei Jahre lang tot ist, und damit hat sich ihr Lebenssinn erfüllt. Also, sie ist kundig in Heilkräutern, aber auch in Giftpflanzen, und hat sich aus den Giftpflanzen, die sie schon von langer Hand gezogen hat, einen Trank gebraut, und den trinkt sie und stirbt. Köhler: Bevor Sie uns sagen, wie gesungen wurde: Gibt es so etwas Konventionelles wie eine Bühne, auf der man ein Kloster sieht? Eine Äbtissin? Das Thema der Überwachung? Oder hat Claus Guth, der 43-jährige Regisseur, der sonst modernes Regietheater, moderne, zeitgenössische Oper macht, das anders gelöst? Vogt: Das sind alles zeitgenössische Kostüme, vor allen Dingen "Gianni Schicci", was ja zu Dantes, also im Florenz des 13. Jahrhunderts, spielen soll, das spielt alles im Heute, und es kommt sehr gut. Man vermisst auch weder die Klostermauern, noch das historische Florenz, sondern der Sinn des Stückes, die Energie des jeweiligen Stückes, wurde von dem Regisseur benutzt, und es kracht dann auch richtig, es zündet. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn potenzielle Energie verpufft und ungenutzt bleibt, und Guth hat wirklich den Nerv des Stückes getroffen, indem er die Figuren so geführt hat, dass man immer genau wusste: Aha, das ist jetzt der Knackpunkt, und deshalb sind die so und nicht anders. Köhler: "Suor Angelica", ein Stück für lyrischen Sopran? Vogt: Ja, das war in Frankfurt Angelina Ruzzafante, sie ist eingesprungen, sollte erst eine kleinere Rolle spielen und hat die Angelica dann übernommen und das sehr, sehr gut gemacht. Aber für mich das Highlight des Abends war die Darstellerin der Giorgetta im "tabarro", das ist die Südafrikanerin Elza van den Heever, und sie hat einen ganz tollen Moment im "Mantel" gehabt, den hören wir jetzt. Überhaupt muss man sagen, dass Frankfurt in den letzten Jahren in der Intendanz von Bernd Loebe wirklich ein sehr gutes Händchen für Besetzungen hat. Es sind dabei noch Zeljko Lucic als Michele im "Mantel" und als Protagonist in "Gianni Schicci", Carlo Ventre als Luigi, Julia Juon in den drei Mezzorollen, und vor allen Dingen Massimiliano Pisapia, der lyrische Tenor, als Renuccio. Das muss man erst mal an größeren Häusern hinkriegen, ganz großes Kompliment, Hut ab für diese Besetzung. Köhler: Abschließend ganz kurz geantwortet', Thomas Vogt: Sie sagen, das Konzept ist aufgegangen, das Thema des Nicht-Entrinnen-Könnens ist flüssig dargestellt, transponiert ins frühe 20. Jahrhundert? Vogt: Unbedingt, ich habe das nie so überzeugend aktualisiert gesehen wie in Frankfurt gestern. Köhler: Thomas Vogt über "Il trittico", drei Opern, Einakter, gesehen am Frankfurter Opernschauspiel von Puccini in der Regie von Claus Guth. |
|
FINANCIAL TIMES Frankfurt Opera By Shirley Apthorp The dead are among us. White-clad, entranced, they wander through our lives, observing, unobserved. They are the common thread in Puccini’s Il trittico, as Claus Guth sees it. In his new production for the Frankfurt Opera, Guth digs deep and strikes gold. Superficially unrelated, Puccini’s three one-act tales do indeed all deal with death, and all play out in claustrophobically closed settings. Guth extrapolates these similarities, placing all his characters – living and dead – together in the airless confines of a low-budget cruise-ship (sets by Christian Schmidt). Of course, this works best for the water-based Il tabarro. Why would all those nuns be living out their lives afloat, or Buoso’s entire family be waiting for him to croak so far from land? But Guth draws his connections with a sure hand, letting his nuns buy the minstrel’s song in Il tabarro and sending his ghosts to haunt the neighbouring operas. His characters are minutely observed and passionately played, his details poignant and plausible. It is the death of Michele and Giorgetta’s child that drives the couple apart, and Guth lets us see the boy, dreamily steering a paper boat, gazing reflectively into the distance. He runs a hand over his father’s arm. A heartbeat later Michele shivers, frowns, and touches the place where his son’s hand has been. The evening is full of such simple but devastatingly effective gestures. We see how Giorgetta’s aching sense of physical loss drives her into Luigi’s arms, and how Michele’s brooding anger finally explodes into fatal violence. Guth twists our emotions without ever lapsing into kitsch or overstatement. This sense of balance is crucially shared by the conductor Nicola Luisotti, who can paint ravishingly sensual and yearning aural landscapes but constantly tugs his disciplined forces back from the brink of emotional excess. The final ace up the Frankfurt Opera’s sleeve is its first-rate casting, an exemplary mix of house stalwarts and astonishing surprises. Into the latter category falls South African Elza van den Heever, giving her German debut as Giorgetta. It is a performance of remarkable emotional conviction and technical assurance, with a freshness and originality that lesser houses might only dream of finding. Also formidable are Zeljko Lucic’s damaged, dangerous Michele, Carlo Ventre’s unfettered, all-or-nothing Luigi and Julia Juon’s magnificently quirky Frugola. Juon is back again in Suor Angelica, this time as the title nun’s sadistically buttoned-up aunt, oozing repressive moral certainty. Again, Guth tells the story as it is, lending a hint of cultish obsession to the rituals of on-board cloister life, giving Angelica a laboratory in lieu of her garden, and sending her dead son to tend her plants and visit her dreams. Angelina Ruzzafante, a last-minute ring-in for the indisposed Danielle Halbwachs, gives a scorchingly honest account of the title role, strongly supported by her fellow initiates. So convincing was Lucic as the murderous Michele that one balks a little to see him back as Gianni Schicchi. Guth brings out the macabre cruelty of the avaricious family by sending Buoso’s ghost to drift among them, vulnerable, unjudgmental, in stark contrast to their grasping ambition. And he takes Schicchi’s parting reference to Dante’s Inferno to its logical conclusion, sending the hero to join the deceased via an offstage gunshot in the final bars. The ambiguity of Lucic’s return thus becomes a deliberate ploy, and the singer revels in the dark overtones of his role. For all its bleak conclusion, this is a Gianni Schicchi that draws plenty of laughter and flies on the edge of perfect comic timing. The ensemble work, both musical and dramatic, is tight and clever, the cast well- matched and wonderfully assured. In all, this is an evening to recommend. |