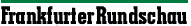|
Niemand wird älter VON HANS-JÜRGEN LINKE Was für ein Team: immer rastlos auf der Suche nach der optimalen Lösung für den Kunden. Alle Facetten der Berater-Persönlichkeit sind auf dieses Ziel orientiert, von anders ausgerichteten Facetten ist nichts bekannt. Das geht natürlich nur ein paar Jahre gut, irgendwann melden sich unangepasste Bedürfnisse, die Abschlüsse werden schlechter, der Abstieg beginnt. Jörn Arnecke, Komponist, und Falk Richter, Librettist und Regisseur, haben in dem Musiktheaterstück "Unter Eis" dem vage konturierten Unternehmensberater Paul Niemand eine Geschichte gegeben, eine des Älterwerdens, das als ökonomisches Versagen und Sterben wahrgenommen wird, ist. Das Stück wurde im vergangenen Jahr auf der Ruhr-Triennale uraufgeführt und hatte jetzt seine Frankfurter Premiere im Bockenheimer Depot. Niemands Persönlichkeits-Konstrukt ist das einer voluminösem Leere, Restkategorie funktionalisierter Humanität. Richter hat gut zugehört, bei McKinsey oderJürgen Klinsmann, er karikiert kundig und milde, und die Berater Sonnenschein (André Szymanski) und Glasenapp (Thomas Wodianka) bringen das echt gut rüber. "Unter Eis" ist eine Mischform aus stilisiertem Sprechtheater und lyrisch-dramatischem Gesang für einen Bariton und einen Knabensopran. Es ist die Klage einer drangsalierten, vereinsamten, erstarrenden Existenz mit geringem Selbstreflexions-Spielraum, woher sollte Niemand auch einen Spielraum haben. Unaufdringlich und transparent Jörn Arneckes Musik ist von einiger Raffinesse, oft geräuschhaft, aber unaufdringlich und transparent. Verständlichkeit und präzise Unterstützung des Textes haben eine große Rolle gespielt, so dass der Eindruck eines zeitgenössischen Kunstwerkes mit aktueller Intention und beträchtlichem ästhetischen Potenzial entsteht. Das Orchester - beschränkt auf Hörner, Streicher und Perkussionsinstrumente - sitzt nicht zwischen Bühne und Zuschauerraum, sondern auf erhöhten Podien ( "Inseln") um das Publikum herum verteilt, so dass der Saal wie mitten ins Geschehen hinein versetzt ist; ein Effekt, den einkomponierte Wanderungsbewegungen der Musiker von einer Insel zur anderen noch verstärken. Der dramatische Raum selbst (Bühne: Alex Herb) changiert zwischen diskursivem Krankenhaus und sterilem Gerichtssaal, hat durchlässige Grenzen, auf denen ständig Video-Projektionen laufen, und wird für die traumhafte Schluss-Sequenz erweitert, so dass die seelische Leere, das psychologische Zentralthema des Stückes, eine große Bühne bekommt. Hauptdarsteller Markus Brück kann darin im Finale im härenen Mantel an den mythischen Niemand, Odysseus in der Höhle Polyphems, erinnern, ohne den psychologischen Mikrokosmos des Unternehmensberatertums zu verlassen. Brück ist sowohl als Sänger wie als Darsteller von starker Präsenz, Szymanski und Wodianka und fünf Solisten des Philharmonia Chor Wien machen das Büro komplett, und Carlo Wilfart von der Chorakademie Dortmund ist ein eindrucksvoller Knabensopran, der das Kind im Manne repräsentiert. Falk Richters Inszenierung schafft eine glückliche Balance zwischen gut ausgearbeiteten Effekten, textdienlicher Bühnenaktion, sensibler Berücksichtigung der Musik und einem historisch-psychologischem Resoanzraum; und man hat den Eindruck, hinterher tatsächlich die Welt ein bisschen besser zu verstehen als vorher. Das Werk unterhält gute Kontakte zur umgebenen Wirtschaftswelt und passt damit nach Frankfurt wie nur selten eines der zeitgenössischen Musiktheaterliteratur. Bockenheimer Depot, 4., 6., 7. Juni, 20 Uhr [ document info ] Dokument erstellt am 03.06.2008 um 16:44:02 Uhr Erscheinungsdatum 04.06.2008 |
|
Bizarres Beraterwesen Die riesige Wasserfläche im Bockenheimer Depot lässt bei tropischen Temperaturen in der ehemaligen Straßenbahnhalle kurz den Gedanken an eine ungebührliche Abkühlung aufkommen. Aber nein, natürlich ist das rechteckige Bassin Teil der Inszenierung von "Unter Eis", wie der Komponist Jörn Arnecke und Autor Falk Richter ihr Musiktheater in 13 Szenen genannt haben, das derzeit von der Oper Frankfurt gezeigt wird. Im Zentrum des Werks steht der Unternehmensberater Paul Niemand, dessen geschäftliche Erfolge nachlassen. Auf das hoch kapitalistische Klima, in dem er sich bewegt, stimmen schon vor der Aufführung Geschäftsleute in weißen Anzügen ein, die eifrig über Bilanzen diskutieren oder nervös mit dem Handy telefonieren. Während der Aufführung selbst sitzen die Zuschauer unter einer Zeltkonstruktion und blicken auf hohe Konferenztische: Dort sitzen sie, die ausschließlich männlichen Unternehmensberater, die in Falk Richters eigener Inszenierung auf ihren Laptops klappern oder Phrasen in deutsch-englischer Melange dreschen, indem sie etwa von "Personal effectiveness" und ähnlichen verbalen wie inhaltlichen Schauerlichkeiten sprechen. Wenn Karl Sonnenstein, ein Kollege Paul Niemands, neben der heimlichen wie totalen Mitarbeiterüberwachung auch gleich das Aussetzen der Demokratie fordert, dann wird damit der kapitalismuskritische Ansatz von "Unter Eis" zwar auf die Spitze getrieben. Zugleich wird aber auch eine gewisse Unentschiedenheit des Stücks befördert. Denn in diese teils durchaus bizarren bis komischen Darstellungen des Wirtschaftslebens mischen sich die Psychosen der Hauptfigur, etwa das Bild einer aus dem Fenster geworfenen Katze oder Kindheitserinnerungen mit abstürzenden Flugzeugen. Selbstmordgedanken, am Ende ein Delirium: Da scheint dann letztlich ein bisschen viel hineingepackt worden zu sein in dieses Musiktheater, das mit seinem perfiden Spott und seiner Überzeichnung des Beraterwesens gerade in Frankfurt einen aparten Kontrapunkt zur Realität setzt. Allerdings, und auch das ist ein Manko, fehlt es eben zu häufig an der Musik: Man spürt, dass "Unter Eis" zunächst als Schauspiel geschrieben wurde; Arneckes flächiger, gemäßigt moderner Orchestersatz verflüchtigt sich nicht nur deshalb oft im Bockenheimer Depot, weil die von Yuval Zorn geleiteten Musiker wie auf Inseln verteilt im Raum sitzen. Es ist auch die häufig bloße Begleitfunktion, die diesen Eindruck verstärkt. Am Ende öffnet sich der Bühnenraum, weitet sich über die Wasserfläche: Ein Junge (ein Mitglied der Chorakademie Dortmund) wird mit sauberem Scheitel in diese eben ganz und gar männliche Welt eingeführt. Paul Niemand, der von Bariton Markus Brück mit starker Präsenz und nur gespielter Erschöpfung verkörpert wird, sinkt in dem Bassin zu Boden. Gerade zum am Ende der zweieinhalbstündigen Aufführung wirkt manches auch szenisch etwas unbeholfen. Gefeiert wurde diese Koproduktion mit der RuhrTriennale gleichwohl nachhaltig. AXEL ZIBULSKI |
|
OPER
Die Zeitoper der zwanziger Jahre feierte im Bockenheimer Depot der Frankfurter Oper fröhliche Urständ. Aber sie kam doch in einem sehr veränderten klanglichen Gewand daher. Jörn Arneckes Musiktheaterstück „Unter Eis" um den in die Jahre gekommenen Unternehmensberater Paul Niemand basiert auf einem Text von Falk Richter und ist letzten Herbst als Auftragswerk der Ruhrtriennale in Bochum uraufgeführt worden. Erzählt wird in zahlreichen stimmlichen und orchestralen Schattierungen vom allmählichen Einfrieren jeder Vitalität und Menschlichkeit unter dem Druck, allzeit effizient sein zu müssen. Falk Richter war sein eigener Librettist und führte in Frankfurt auch Regie. Mit harten Brüchen in der Szenenfolge schaffte er es, das ganze Darstellungsspektrum des Musiktheaters der vergangenen hundert Jahre von der Brettl-Revue über das expressionistische Monodram samt Raumklangkonzept bis zu den Videoprojektionen unserer Tage unterzubringen. Arneckes meist zurückhaltende Klanglichkeit bildet eine akustische Folie, vor der das traurige Spiel vom Altern in der Neuen Ökonomie stattfindet. Mensch als Opfer der Technik Lebensdynamik und Entfremdung spielen gleichermaßen eine Rolle in Arneckes und Richters stimmigem Konzept. In der aktuellen Zeitoper „Unter Eis" werden die heutigen Lebensverhältnisse, in denen es um das reibungslose Funktionieren auch noch in der Freizeit geht, ins Absurde geführt, als Groteske konterkariert. Was früher in diesem selten gewordenen Genre laut, manchmal burlesk-grob klang, ist bei dem Hamburger Komponisten Arnecke nur noch verhalten, meist ein müder, vielleicht schon kapitulierender Reflex. Die einst unter dem Eindruck moderner Entwicklungen wie dem Flugzeugbau oder der Telekommunikation entstandene Zeitoper stellt in ihrer heutigen Form den Menschen als Opfer der Technik dar. Ständig verfügbar, ständig überwacht, ständig taxiert: So lautet das Resümee der conditio humana nach gut zwei bühnentechnisch hochkarätigen und von irrlichternder Videokunst kommentierten Opernstunden. „Unter Eis" ist auch eine Keine-Zeit-Oper. Jeder der drei Protagonisten aus dem industriellen Beratungswesen ist ein Getriebener seiner selbst, ein Selbstbetrüger, ein Einsamer. Worthülsen und Klischees am laufenden Band. Dem suizidgefährdeten Paul Niemand (Markus Brück) rechnen seine zwei ehrgeizigen Kollegen Karl Sonnenschein (André Szymanski) und Aurelius Glasenapp (Thomas Wodianka) ständig vor, wo es bei ihm hakt und wie bei ihnen alles steigt: Effizienz, Umsatz, Potenz. Geschlossene Hightech-Ensembleleistung Der auskomponierten Warteschleife, bei der man an einen Flughafen oder eine Konferenzlounge denkt, entspricht das sterile Weiß eines Ausstellungpavillons oder übergroßen Cateringzeltes (Bühnenbild: Alex Harb). Das Wechselspiel zwischen Rezitation und Gesang entwickelt anfangs höllische Längen. Als Märchen, Traum, Rückblick und Vision gelingt Arnecke und Richter dann aber die szenisch-klangliche Metamorphose in einen „Zustand von Musik selbst" (Wolfgang Rihm). Paul Niemand klebt schließlich doch zu sehr am Leben, um wirklich ins Wasser oder über den Fluss zu gehen. Seine traurige Stimme ist nur eine von vielen im Tremolo der unendlichen Trolleymelodien, die die Einsamkeit der Flughäfen begleiten. Niemand ist ein Heiner-Müller-Hamlet, der an der Küste Europas steht und mit der Brandung Blablabla redet. Schlicht ergreifend gerät dem Inszenierungsteam die Schlussszene mit dem Knabensopran (Carlo Wilfahrt) aus der Chorakademie Dortmund. Er erkennt in dem symbolschwangeren Wasserbassin im Bockenheimer Depot als Kindergeschäftsmann, dass „das Leben, das vor mir liegt, schon tausendmal gelebt wurde. Bariton Markus Brück spielte und sang Paul Niemand als herumirrenden King Lear und Jakob Lenz in ein und derselben Person sehr ausdrucksstark und mimisch packend. Yuval Zorn führte souverän durch die vielschichtige Partitur. Das Publikum kann ihm dabei zusehen, während er für seine Musiker nur per Videoübertragung sichtbar ist. Das in Holzboxen um den Pavillon verteilte Orchester folgte ihm schlafwandlerisch. Viel Applaus für eine sehr geschlossene Hightech-Ensembleleistung voller Kontraste. ACHIM HEIDENREICH |
|
Glanz und Elend der Jungmanager
"Unter Eis" erwies sich dagegen als eminent kurzweiliges, bitterkomisches Stück. Es nimmt die Absurdität junger, karriereorientierter Manager aufs Korn, fulminant gesungen, gesprochen und gespielt vom Bariton Markus Brück, der einen ausgebrannten, sich verzweifelt gegen seinen Abstieg wehrenden Paul Niemand verkörpert und zwei Schauspielern (André Szymanski, Thomas Wodianka), die pausenlos redend den ganzen Aberwitz eines um jeden Preis erfolgsorientierten und gewinnmaximierenden Arbeitens zeigen. Fünf weitere, uniform weiß gekleidete Männer (Solisten des Philharmonia Chors Wien) sind die fleischgewordenen Ängste und Gewissensbisse des Protagonisten Mr. Nobody. Zugleich gehen sie mit ihm zum Survival-Training oder spielen in einem selbstverfassten erzkomischen Musical über das Schicksal einer Robbe. Was für ein furioses Feuerwerk an szenischen und sprachlichen Pointen (Libretto und Inszenierung: Falk Richter) erfüllte das Bockenheimer Depot! Das Kammerorchester aus solistischen Streichern, vier Hörnern und Schlagzeug (Leitung: Yuval Zorn), die in der gesamten Halle verteilt sind und in ihr wandeln, begleitete, illustrierte und vertiefte perfekt das Geschehen - allerdings mehr in Form einer durchkomponierten Schauspielmusik denn als Oper. Das freilich ist dem Sujet durchaus angemessen. Alex Harb hat auch für diese Koproduktion mit der Ruhr-Triennale (Uraufführung im September 2007) die Bühne entworfen: Einen Raum, der zunächst ein gläsernes Zelt suggeriert, in dem das Publikum auf einer Tribüne Platz nimmt. Nach der Pause, als sich das Stück verdichtet und alptraumhafte Züge annimmt, öffnet sich die Rückwand und das Spielpodium fährt langsam über eine Wasserfläche ans Ende der nun frei einsehbaren Holz-Eisen-Konstruktion des ehemaligen Tram-Depots. Trotz hoher Temperaturen am Premierenabend machte die bald folgende Schlussszene frösteln: im Wasser aneinander gekauerte, stumme Männer, deren Schicksal in einem kleinen Jungen fortlebt, der schon all die Zwänge eines Erwachsenenlebens verinnerlicht hat und sie allein singend zum Besten gibt. Klaus Kalchschmid "Unter Eis" am 4., 6. und 7. Juni |