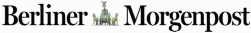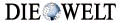|
|
Dopo cent'anni Cassandra ritrova Elektra Fu vero plagio? GIANGIORGIO SATRAGNI Dopo cento anni, per iniziativa della Deutsche Oper di Berlino, si è riaperto un famoso caso musicale che individuò nella Elektra di Richard Strauss, rappresentata a Dresda nel 1909, un singolare esempio di "telepatia musicale" in rapporto alla precedente Cassandra del più giovane e oggi dimenticato italiano Vittorio Gnecchi, data a Bologna nel 1905 con la direzione di Toscanini. L'uno prese dall'altro? A Berlino per la prima volta i due lavori sono stati dati in forma consequenziale, anche se ciò, nelle intenzioni della regista e sovrintendente Kirsten Harms, avveniva piu' sulla base della successione narrativa della tragedia greca. In Cassandra Agamennone ritorna dalla guerra di Troia portando con se' la veggente e viene ucciso dalla moglie Clitennestra, nel frattempo concubina di Egisto, per vendicarsi del sacrificio della comune figlia Ifigenia; in Elektra la protagonista attende il ritorno del fratello Oreste, che vendicherà il loro padre uccidendo Clitennestra ed Egisto. Ma sull'identita' o non identità musicale fra le due opere si è sparso molto inchiostro; lo stesso Giovanni Tebaldini, che aveva aperto la polemica, tirò indietro la mano dopo aver gettato il sasso dicendo di non aver mai parlato di plagio, e peraltro aveva agito in malafede incollando come esempi frammenti di Cassandra per dimostrare identità tematiche con Elektra. Gnecchi affermò di aver dato due volte il proprio spartito a Strauss, che avrebbe ringraziato per lettera: ma non tirò fuori la lettera, semprechè esistesse, perché oggi non esiste, come non esiste traccia di Gnecchi nell'archivio di casa Strauss, che in pubblico non fece mai parola del caso. E allora? Se mai Strauss ha avuto Cassandra, ha letto al massimo la prima e l'ultima pagina: il gesto d'attacco di Cassandra è quasi identico a Elektra, identica è la tonalità, mentre nel finale di Cassandra la protagonista invoca Oreste come lo farà Crisotemide nel finale di Elektra. Per il resto, il confronto mette in evidenza più le differenze che le similitudini, al di là dell'atmosfera tragica: peraltro Gnecchi, nel libretto versificato dal pucciniano Illica, immaginava un orizzonte mediterraneo disatteso nella rappresentazione berlinese, inutilmente indebolita da un taglio. Gnecchi era un promettente compositore d'opera italiana che guardava alla civiltà strumentale tedesca, mentre il sommo Strauss era tedesco fino al midollo. Il canto spiegato di Gnecchi condivideva qualcosa col verismo di un Giordano e col giovane Puccini, ma era rivestito da un'orchestra lussureggiante il cui modello poteva anche essere lo Strauss dei poemi sinfonici, ma che trova più affinità con i preziosmi del viennese Zemlinsky, col suo allievo Korngold, col tedesco Schreker, a sua volta inzuppato di melodia italiana attraverso Puccini. Fuor di dubbio nessuno in Italia orchestrava nel modo maiuscolo di Gnecchi, e il maturo Puccini lo farà in altro modo. Però Elektra è altra cosa, la sua forza implacabile, oltre che da soluzioni radicali, viene dalla serrata drammaturgia che si serve dei motivi conduttori; in Cassandra, poi, il coro ha la funzione centrale che possedeva nella tragedia greca, in Elektra quasi non esiste. Lo stesso Tebaldini si difese poi affermando che le due opere non potevano essere paragonate: l'orchestra della Deutsche Oper, diretta da Leopold Hager, ha in reperorio Elektra e la suona benissimo, mentre, leggendo per la prima volta Cassandra in modo non altrettanto buono, non fa che allargare il solco. |
|
|
A BERLINO DI SEGUITO LE DUE OPERE: RESA IN PARTE GIUSTIZIA AL COMPOSITORE MILANESE BERLINO - Richard Strauss colpevole di plagio. Elektra, senz' altro una delle opere più in vista del catalogo di lui, scopiazzata di sana pianta dal titolo d'esordio di un giovane compositore italiano di belle speranze. A voler calcare la mano, si potrebbe dire che il senso del dittico in scena alla Deutsche Oper di Berlino è questo. Ma in realtà le cose non stanno proprio così. Nel 1905 Vittorio Gnecchi, rampollo di famiglia milanese molto in vista, rappresenta al Comunale di Bologna Cassandra, atto unico ispirato a Sofocle su libretto di Luigi Illica. Sul podio, Arturo Toscanini. Non un successo trionfale, ma nemmeno un fiasco. Incoraggiato, Gnecchi incontra Strauss a Torino e gli dona copia della partitura chiedendone, in cambio, un' opinione. Nel gennaio 1909, prima a Dresda dell'Elektra straussiana. Pochi mesi dopo appare sulla Rivista Musicale Italiana un saggio nel quale vengono confrontati decine di spunti melodici tratti dalle due partiture dimostrando, in alcuni casi una certa somiglianza, in altri una sostanziale identità. Nasce così il "caso Gnecchi". Da una parte Illica, che da uomo di teatro (e di marketing) qual era, esorta il giovane compositore a sfruttare pubblicitariamente la cosa; dall' altra Strauss che si rinchiude nel silenzio, infastidito dalle accuse quanto dal ronzare di una mosca. In mezzo il povero Gnecchi, che vorrebbe far valere le sue ragioni ma è sconsigliato dal suo stesso avvocato di non mettersi contro a un gigante come il bavarese. Anche perché il plagio non è dimostrabile in musica come in letteratura: un motivo "suona" in un certo modo a seconda del contesto armonico, ritmico e timbrico in cui si trova. Nuovi articoli e saggi, prese di posizione di studiosi e musicisti di vaglia. Il caso s'ingrossa con effetti paradossali per Gnecchi: Cassandra prende a circolare con continuità nei Paesi di lingua tedesca ma trova porte chiuse in patria: la Scala la rifiuta "per non dispiacere a Strauss", come candido scrive il direttore artistico Vittorio Mingardi. Peggio ancora in America, dove da accusatore Gnecchi si trova sul banco degli imputati. La critica scrive: "Cassandra sarebbe una bella opera, peccato sia copiata da Strauss"! Anziché promuovere il suo musicista, l'editore Ricordi lo scarica. Morale: meglio sarebbe stato per Gnecchi che il caso non scoppiasse. Lo spettacolo di Berlino, prima Cassandra poi "Elektra" nella stessa serata, dimostra tre cose. La prima è che Cassandra non è un capolavoro ma opera che merita molta più attenzione di quanta ne abbia avuta finora. La seconda è che il confronto è impietoso (come eseguire una una dopo l' altra una Passione di Bach e una di Homilius, pure degna di rispetto), perché in mano a Strauss quei motivi, riconoscibili a orecchio, creano un mondo; in mano all'italiano un titolo di buona maniera, che sarebbe ancor più convincente se fosse cantato in tedesco (l'italiano con quelle armonie suona come suonerebbe un' opera seria di Händel cantata in tedesco). La terza è che appare più che plausibile, seppur indimostrabile, l'ipotesi che il bavarese abbia usato quei temi come una sorta di "memoria inconscia" che si era sedimenta in lui dopo aver visionato la partitura di Cassandra. Buona la messinscena di Kirsten Harms, che gioca sulla contiguità dei due soggetti (l'Elettra di Gnecchi è bambina, quella di Strauss donna adulta). Discreta la direzione di Leopold Hager. Ottimi i due cast. Bene le protagoniste Malgorzata Waleaska (Cassandra) e Jeanne-Michèle Charbonnet (Elettra), anche se rivelazione della serata è la straordinaria vocalità di Manuela Uhl, Crisotemide nell'atto unico di Strauss. Enrico Girardi |
|
|
FINANCIAL TIMES November 6 2007 Double bill of murderous intent By Shirley Apthorp Vittorio Gnecchi’s Cassandra (1926) is one of those operas you hardly ever get to hear. Richard Strauss lifted the opening theme for his own Elektra. Accusations of plagiarism were made. Ironically, the Italian came out of the spat in far worse shape than his German colleague, and Cassandra soon lapsed into obscurity. Berlin’s Deutsche Oper, currently in need of recognition and success, has come up with the idea of unearthing Cassandra and presenting it in a double bill with Elektra. The two operas fit together thematically, both examining the troubled House of Atreus with Sophocles as a starting-point and Orestes’s matricide as climax. Gnecchi, however, views events through Clytemnestra’s eyes, and points out (as Strauss does not) that the murder of her husband was preceded by his having dispatched their daughter Iphigenia. With this project, Intendantin Kirsten Harms has put herself perilously in the spotlight. Since she pulled the plug on Hans Neunfels’s Idomeneo a year ago because of alleged Muslim extremist threats, the reputation of her house has continued to suffer. This is the third time she has staged an opera in her house herself. Neither of her earlier efforts were triumphs. Nor have her repertoire and casting choices helped boost audience numbers. On the plus side, the announcement last week that Donald Runnicles is to take over from the unloved Renato Palumbo as chief conductor from 2009 gives cause to hope that the Deutsche Oper might have a future with Harms. The double-bill is an idea that looks interesting on paper but falls flat in the execution. It does Cassandra no favours at all to be presented alongside Elektra, so that everyone can see immediately just how much worse the Italian opera is than Strauss’s masterpiece. The fact that Cassandra is also sung, played and conducted significantly worse is equally unhelpful. Gnecchi’s dizzily foetid late romanticism is the kind of thing you either have to like or hate. The influences of Wagner, Strauss and Berlioz are clearly audible, with a hint of Respighi and a whiff of Puccini that has been left out of the fridge for too long. The piece is a kind of oratorio, with a Greek tragedy-style choir commenting on the action, and long, wordy monologues in between. Leopold Hager failed to keep choir and orchestra together. In the seminal role of murderous wife Clytemnestra, Susan Anthony appears in front of a gilded wall in Marilyn Monroe wig, little black dress and pearls, dragging the corpse of a slaughtered ram and an axe, a physically compelling performance that sounds strained in the upper registers and often falls short of the note. Aegistrus (unremarkable: Piero Terranova), whom Gnecchi gives more of a run for his money than Strauss, seduces and manipulates her in suit, tie and black leather gloves. Cassandra appears, heralding disaster; Malgorzata Walewska gives a spine-tingling and fruity account of this plum role. Agamemnon (loud: Gustavo Porta) returns wrapped in a blanket and encrusted with blood. The golden walls part to reveal a muddy walled courtyard for Elektra, where everybody fares better. Harms tells this story as a classic in modern dress, with few psychological insights, no original ideas, yet unimpeachable handiwork. Hagen conducts better, the orchestra responds, and the cast is solid enough, with Manuela Uhl’s impassioned Chrysothemis and Jane Henchel’s show-stopping Clytemnestra head and shoulders above the rest. A warm audience response suggests that Harms is at least on the right path for her public. Cassandra is to be dropped after a short run, with Elektra staying in the repertoire. They could have done it that way from the start. |
|
|
SEEN & HEARD 14.12.2007 Deutsche Oper BerlinRichard Strauss Elektra For earlier performances, the Deutsche Oper had hit upon the fascinating idea of preceding Elektra with Vittorio Gnecchi’s Cassandra, known to Strauss and premiered four years earlier in 1905 under Toscanini. Cassandra deals with a preceding section of the myth of the accursed house of Atreus, focusing upon Klytemnestra’s murderous revenge upon Agamemnon for the sacrifice of their daughter Iphigenia, as foretold by the ever-unheeded prophetess Cassandra. Sadly, the performance I could attend was solely of Elektra, yet I tried nevertheless to bear in mind the mythological context, with the result that the characters’ hysterical derangement seemed slightly less arbitrary than otherwise might have been the case. The curse of Pelops upon his sons, Atreus and Thyestes, for the murder of Chrysippos, their half-brother, reaches down to yet another generation.
palace of Mycenae, she crawls around upon the ground, a waste land of broken images, awaiting vengeance from her brother, Orest. Others looked in upon her, whether from above or on her level, whether to mock or to fear, but this was definitely her space. The jeering maids, all very well sung, surrounded and yet could not break her, likewise the grotesque Klytämnestra. For Kirsten Harms’s excellent Personenregie focused our attention ever more keenly upon the extraordinary dynamics of this family and its supporting cast. The situation had become so desperate, as much for Klytämnestra and Aegisth as anyone else, that something had to happen. And of course it did. Jeanne-Michèle Charbonnet summoned up a tremendous performance in the title-role, a role as cruelly relentless as the opera itself. The very occasional moment of tiredness could easily be forgiven in the context of a portrayal encompassing such violent and yet never quite un-musical swings. It was certainly not all presented at full-throttle: despite the ominous presence of Strauss’s huge orchestra, there was considerable subtlety of vocal shading to this Elektra. Dancers from the opera’s ballet acted out her dance for her, albeit with her interaction, suggesting a projection of her dreams and nightmares even unto death. Leopold Hager’s excellent conducting assisted greatly in permitting Charbonnet to accomplish this. A conductor who never quite seems to have gained the regard his due, and perhaps best known for his Mozart, Hager was quite at home with the exigencies of the score. Whilst in the final reckoning this reading may have lacked the razor-sharp attention to line and to colouristic extravagance of a Christoph von Dohnányi, I have rarely heard the crucial dance element to so much of the music brought out so tellingly, especially in the run up to Elektra’s final, wild dance itself. We are not nearly so far from Der Rosenkavalier as might be imagined. In this, of course, Hager was dependent upon the strength of his orchestra, whose strings and brass in particular impressed. The brass contribution to the coming of Orest was crucial not only in identifying the mysterious stranger, but also in underlying the Wagnerian sound of Fate, without which the drama would seem merely sensational.
Viewed as a whole, the performance took a little while to scale the heights, or perhaps to plumb the depths, although it was never less than very good. If I found myself desperately wishing for Orest to arrive, even if only to introduce a male voice into the world of sometimes shrill female hysteria, then that is doubtless as it should be. From the moment of Orest’s arrival, everything appeared to move up a gear; the working out of Fate was made absolutely clear. The last half hour or so was almost unbearably powerful. In this strange tragedy without catharsis, one cannot but feel browbeaten by the end, but it would be unbearable in the wrong sense, were this to have resulted from a bad or mediocre performance. There was no question of that here, in what must be accounted a considerable triumph for Berlin’s Deutsche Oper. Mark Berry |
|
|
"CASSANDRA" UND "ELEKTRA" Spannung im Saal, Augenblicke einer an der Deutschen Oper Berlin lang entbehrten Selbstvergessenheit des Musiktheaters. Bei Kirsten Harms Inszenierungen von "Cassandra" und "Elektra" spürt man, wie stark das Opernherz an der Bismarckstraße schlägt. VON CHRISTINE LEMKE-MATWEY
Wenn Elektra und Orest sich wiedersehen, die Schwester-Hassgeburt und der Bruder-Rachegott, nach Jahrzehnten der Ungewissheit und des liebelosen Dahinvegetierens, dann ist das, gemeinhin, eine Eruption: der konzentrierten Orchesterkraft, der verdrängten Affekte, der mythisch gestauchten Zeit. Wie ein Cluster sprengt Elektras „Orest!"-Schrei jäh alle noch irgend geltenden (musikalischen) Bezüglichkeiten. Ein schwarzes Loch, in dem jedes „Es war" und jedes „Es wird" zur Hölle fährt und gen Himmel schießt; ein Paradebeispiel für das, was Richard Strauss 1949 im Blick auf seine frühe kühne Partitur – nicht ohne den Selbstekel des alten Mannes – „psychische Polyphonie" genannt hat. Und ein großer, leuchtender Theatermoment. Anders als Georg Solti oder Giuseppe Sinopoli, Karajan, Sawallisch oder Böhm nimmt Leopold Hager diesen Moment mit dem Orchester der Deutschen Oper eher lyrisch, kantabel, fast zart, als verschluckte sich hier ein Gefühl, ein überlebensgroßes, monströses, von dem man bis zum Schluss nicht weiß, ob es höchsten Triumph oder tiefstes Entsetzen verheißt. Der Bruder, der vielleicht doch zu spät kommt; die Schwester, die ihrem Trauma erlegen ist; die Blutrache für Agamemnon, den gemeuchelten Vater, als einzige Utopie. Auch die Zäsur vor dem Schrei kennt bei Hager weiche Kanten, die Nerven, die hier blank liegen, scheinen weniger zum Zerrreißen gespannt als auf irre Weise plötzlich beruhigt. Der Bruder ist da, endlich da. Und die fabelhafte Jeanne-Michèle Charbonnet legt in das, was sie ihrem Erlöser zu singen und zu sagen hat, alle mystische Verzückung, alles vergrabene und vergessene Liebessäuseln dieser Welt – mit mehr guttural verschämtem als heldischem, aber sauber geführtem und klug seine Kräfte einteilendem Sopran. „Hehres, unbegreifliches, erhabenes Gesicht, / o bleib’ bei mir! Lös nicht / in Luft dich auf, vergeh’ mir nicht". Ein Fanatiker des Machartlichen bei Strauss ist der Salzburger Hager – derzeit Musikchef an der Wiener Volksoper – also nicht. Alles Chromatische, Dissonante, Geschichtete dieser Musik wirkt bei ihm nicht gespreizt oder gar selbstreferentiell, sondern stets gebunden, ja eingebunden: in den Sog des fatalen Geschehens wie in eine sehr sympathische kapellmeisterliche Bescheidenheit. Dem Beginn (Mägde-Szene) mag es auf diese Weise zwar an Schärfe fehlen, auch erscheinen Hagers Tempi nicht immer zwingend, doch dieser Abend ist vor allem eines nicht – und darin liegt die „Elektra"-Kunst: Er ist nie zu laut. Der Atriden-Mythos als Kammerspiel, und am Horizont dräut bereits Strauss’ Kehrtwendung hin zur tonalen Uneigentlichkeit des „Rosenkavalier". Die Sänger wissen es ihrem Dirigenten mit Inbrunst zu danken, allen voran Jane Henschel als Klytämnestra mit geradezu furchterregend gestanzter Textverständlichkeit, ein Ungetüm, eine hexenhaftgreise Papagena in knallrotem Federkleid. Oder Manuela Uhls Chrysothemis, die zwar ein wenig metallisch klingt, aber in dieser Härte, dieser Verhärtung auch anrührt. Ebenso Alfred Walkers sonorer, zärtlich-blutrünstiger Orest und Reiner Goldbergs Aegisth, ganz geiferndes Zerrbild seiner selbst. Und natürlich die Mägde, die ihre vertrackte Aufgabe mit großartiger Präzision und Eloquenz meistern (Nicole Piccolomini, Julia Benziongber, Ulrike Helzel, Andion Fernandez, Jacquelyn Wagner). Spannung im Saal, Augenblicke einer an der Bismarckstraße lang entbehrten Selbstvergessenheit des Musiktheaters. Kirsten Harms, die Regisseurin, siedelt die holzschnittartige Handlung – was passiert, passiert innen – in einer Art Silo an, am Grund eines Schachts, einer Mülldeponie, einer Schädelstätte (Bühne: Bernd Damovsky). Gebeine ragen aus der Asche, in der die Figuren sich wälzen und bekriegen, das Beil wird versteckt und wieder ausgebuddelt, alles vorhersehbar, dicke Staubwolken fliegen auf, schon fürchtet man um die Sängerlungen, und das Licht hat keine Chance. Nur ganz am Ende, zur Apotheose des Tanzes, ergießt es sich hellheiß von oben herab, taucht die Szenerie in güldenstes Gold, als wäre es ein Bild von Klimt: Die tote Elektra rücklings im Kreise etwas peinlich agierender weißer Larven liegend (Choreografie: Silvana Schröder), Orest aus der Luke wie weiland Agamemnon grüßend, blutüberströmt, der Retter als Schlächter als Opfer. Die Entschlüsselung der Vorgeschichte verdankt sich dem Schwesterstück zu „Elektra" vor der Pause, Vittorio Gnecchis „Cassandra" von 1905. Sehr viel mehr an Erkenntnis bietet diese Ausgrabung und dramaturgische Konstruktion freilich nicht. Um in Erfahrung zu bringen, dass KlytämnestraClitennestra ihren Gatten Agamemnon Bade erschlug, weil dieser für Troja die gemeinsame Tochter Iphigenie geopfert hatte, braucht man keine Stunde Musik, die einem in satter Melodik und sahniger Instrumentierung vor Ohren führt, wie schade es doch ist, dass Hollywood erst kurz darauf erfunden wurde und Puccini, apropos Italien, der bessere Dramatiker war. Gewiss, sängerisch sind Gnecchis Partien attraktiv, die Besetzung kann sich erneut sehen und hören lassen: Susan Anthony als hysterisch-schrille Clitennestra, Gustavo Porta als kampfesstumpfer Agamennon sowie Malgorzata Walewska in der Titelpartie der antiken Seherin, ein füllig brodelnder, ausdrucksstarker Mezzosopran. Außer dass sich einzelne musikalische Motive in der Tat ähneln („Elektra" wurde 1909 uraufgeführt), haben sich die beiden Einakter allerdings wenig zu sagen, von Durchdringung oder gegenseitiger Befruchtung ganz zu schweigen. Eine Zwangsehe, deren Meriten allein auf dem Papier bestehen. Harms’ Doppelregie wirkt überdies ein wenig unbeholfen, als reichte ihre szenische und/oder psychoanalytische Fantasie am Ende nicht aus, um die archaischabstrakte Versuchsanordnung, die sie sich aufgebürdet hat, auch mit Leben, mit Kunst, ja mit Wahrheit zu füllen. „Cassandra", das bedeutet kaum mehr als einen Spalt, einen Schlitz in der Mauer des späteren Schachts – und viel konzertantes, rampennahes Opernspiel. Da reckt und streckt das Volk oben in den Logen Chorhände und Fackeln zum Ballett, da schleift die noch junge Clitennestra einen eigenhändig geschlachteten GummiWidder hinter sich her und hat der ebenfalls noch juvenile Egisto (Piero Terranova) die Fäuste notorisch in den Hosentaschen geballt. Ästhetisch sucht das Ganze zweifellos unter die Fittiche eines Götz Friedrich oder Harry Kupfer in den achtziger Jahren zu schlüpfen. Das mag man beklagen und gestrig finden und dem Regieteam verübeln. Wenn Elektra sich aber nach der Pause zu ihrem zweiten und dritten „Orest!"-Stoßseufzer und -Koseruf vom Bruder umarmen und in die väterliche Decke hüllen lässt, erübrigen sich solche Fragen. Dann spürt man, wie stark das Opernherz an der Bismarckstraße schlägt. |
|
|
Cassandra im Fegefeuer der Oper Von Klaus Geitel Es stimmt schon: der Tonfall ist in beiden Werken derselbe. Dieser bis zum Überdruss ausgereizte, geradezu erschöpfend hochexpressive Riesenklang des fortgesetzt wie mit Keulenschlägen dahermusizierenden Orchesters.
Es stimmt schon: der Tonfall ist in beiden Werken derselbe. Dieser bis zum Überdruss ausgereizte, geradezu erschöpfend hochexpressive Riesenklang des fortgesetzt wie mit Keulenschlägen dahermusizierenden Orchesters. Es schreibt musikalisch die antike Vielfach- und Ewigkeitstragödie um Agamemnon und Klytämnestra, um Cassandra und Elektra hervorwuchtend geradezu an die Wand. Unterstützt in Vittorio Gnecchis "Cassandra", von Toscanini 1905 in Bologna uraufgeführt, noch dazu durch stimmstarke Choreinwürfe von Wolkenbruch-Charakter. Die Deutsche Oper hat in ihrer Produktion auf einzigartig explosive Weise Gnecchis "Cassandra" und Richard Straussens "Elektra" kunstreich verbandelt. In Italien hat man seinerzeit Strauss ein gewisses Epigonentum, sogar eins mit strafwürdigem, geistigem Diebstahlscharakter angelastet. Dabei haben beide Komponisten nur, jeder auf seine eigene unerbittliche Art, die Tragödien durchaus genialisch auf Biegen und Brechen hörbar gemacht. "Cassandra" geriet sträflicherweise gründlich in Vergessenheit. "Elektra" hielt ihre Stellung zu Recht unangefochten im Repertoire. BEIDE WERKE DAUERN DREI STUNDEN Beide Werke nun in über dreistündig dahin krachender Ausführlichkeit nicht gegeneinander, sondern miteinander aufzuführen, erwies sich als wenn auch erschöpfende, so doch fulminante Wahnsinnsidee, ausgekostet ringsum bis zum letzten Orchesterschlag. Leopold Hager führt ihm sein gewaltig aufspielendes Orchester mit unermüdlicher Hand befeuernd entgegen. Genau so eindringlich antworten die von William Spaulding einstudierten "Cassandra"-Chöre von der Höhe der Ranglogen herab. Diese "Cassandra" gleicht einem Besuch im Fegefeuer der Oper. Es steckte gleichzeitig die Zuhörer zu aufflammender Begeisterung an. In Bernd Damovskys hochkonzentrierter Ausstattung zeigt Kirsten Harms eine meisterhafte Regie. Achtzehn Fackelträger lassen gleich zu Beginn der "Cassandra" an der Rampe die Flammen lodern. In "Elektra" watet das verzweiflungsvoll blutige Geschehen in knöcheltief schwarzem Sand, in den sich am Ende, Fischen gleich emporschnellend, bald reglos niederstürzend, zur triumphierenden Singheldin auch noch herzlich unerwartet, doch bezwingend eine Riege weiß gekleideter Tänzerinnen gesellt. Atemberaubend! ELEGANTE FRAU MIT HACKEBEIL Das aber ist vor allem die Leistung beider Ensembles. Hochkarätiger besetzt ging schon lange keine Berliner Opernaufführung in Szene. In "Cassandra" klingen mit schier einzigartiger Intensität die rivalisierenden Stimmen auf. Die von Susan Anthony, der hocheleganten jungen Klytämnestra mit dem langstieligen Hackebeil in der blutigen Hand, die gleichzeitig aber immerfort mit dem Dolch ihres geschliffenen Soprans treffsicher zuzustoßen versteht. Und der blutvolle Mezzo von Matgorzata Walewska in der Titelpartie, zu einem Hellsehertum verurteilt, das nur Schrecken zeigt. In ihrer Mitte die tenorale Stimm-Majestät von Gustavo Porta als Agamemnon, dessen Leichnam am Ende durch eine Bühnenluke auf den Müll fliegt. Piero Terranova, der Nutznießer des Verbrechens, flegelt, vorzüglich singend, die Hände bis zu den Armen fortgesetzt in den Hosentaschen, als Aegisth über die Bühne. Ein Ensemble von höchster Geschlossenheit singt Gnecchis "Cassandra" ins Leben zurück. Die Titelpartie in "Elektra" hat die Amerikanerin mit dem imposant französischen Namen Jeanne-Michèle Charbonnet übernommen. Die schönsten Stimm-Französinnen kommen offenbar auch aus New York. Miss Charbonnet singt sich als Elektra allmählich frei und weiß, sich kolossal steigernd, die Riesenpartie (und die Sandattacken) unerschöpft zu bewältigen. Ihre Schwester Chrysothemis aber ist Manuela Uhl, ein wahres Singwunder, zu deren Dauer-Engagement an die Deutsche Oper man das Haus nachdrücklich beglückwünschen darf. Sie singt mit einer schier unglaublichen, durchschlagskräftigen Intensität, die geradezu süchtig zu machen versteht. Den Orest gibt mit sympathischer Zurückhaltung und Natürlichkeit Alfred Walker. In diesem Kreis stimmfrischer, junger Interpreten macht Jane Henschel in ihrer rotsamten königlichen Pracht, immer noch auf das verfluchte Hackebeil der Jugend gestützt, die angemessen morbide Figur. Reiner Goldberg zaudert sich eindringlich als Aegisth in den Tod. Die Deutsche Oper aber ist künstlerisch derweil zu neuem Leben erwacht. Inmitten der Tragödien-Finsternis ringsum kann sich als einziger Lichtblick Kirsten Harms im scheinbar vorgeschriebenen schneeweißen Kleid an der Rampe zeigen. Der Jubel um sie, Leopold Hager, das Ensemble war kolossal. Schade nur, dass "Cassandra", der Reißer, einstweilen nur noch zweimal aufgeführt wird. |
|
|
MUSIKTHEATER Es sollte ein Befreiungschlag werden, wieder einmal. Aber Kirsten Harms, Intendantin der Deutschen Oper Berlin, legt erneut eine mäßige Inszenierung vor. Sie bindet erstmals "Elektra" von Richard Strauss mit der weitgehend vergessenen Kurzoper "Cassandra" zusammen. Von Manuel Brug
Wenn in Berlin alles mit rechten Dingen zugehen würde, wie etwa in Wien, Paris, Brüssel oder New York, dann hätte die 2004 berufene Kirsten Harms eben ihren Intendantinnen-Job an der Deutschen Oper Berlin angetreten. Dann hätte sie nach langer Suche letzte Woche in Gestalt von Donald Runnicles einen neuen, im Betrieb hoch respektieren Generalmusikdirektor präsentiert. Und sie könnte auf eine ordentliche erste Spielzeit verweisen, die mit alten und neuen, soliden wie sensationsheischenden Regienamen aufwartet. Sie hätte schließlich dieses Wochenende sich selbst an die Premierenspitze gestellt - mit einem ihrer Steckenpferde, der Wiederentdeckung angeblich zu Unrecht vergessener Opern. Die sie inhaltlich geschickt verknüpft mit einem Repertoireklassiker, um so das Risiko für Berlin größtes, auf Auslastung angewiesenes Opernhaus niedrig zu halten. Und man hätte, ist das Licht im goldenen, meist düsteren Kasten von Bernd Damovsky endlich erloschen, gesagt: ganz nett, für den Anfang. Sieht noch ein wenig aus wie Kieler Fleißarbeit. Aber das wird ja - vielleicht. KLÄGLICHER RETTUNGSVERSUCH Leider aber steht Kirsten Harms, die bereits zwei Monate nach ihrer Berufung im Amt war, nach drei mäßigen bis ärgerlichen Spielzeiten vor einem oft schlecht gefüllten Zuschauerraum hart mit dem Rücken zur frisch sanierten Bühnenwand. Glücklose Sänger-Engagements und Regieverpflichtungen waren die Regel. Mit dem bereits ausgeschiedenen Renato Palumbo hatte sie entschieden aufs falsche Dirigentenpferd gesetzt. Große Oper und viel Pathos wollte sie für das Haus, doch meist langte es nur für schlaffes Mittelmaß. Auch bei ihren eigenen Regieleistungen, Rossinis "Semiramide" und Franchettis "Germania". Die Koppelung der "Elektra" von Strauss/Hofmannsthal mit dem vier Jahre vorher von Toscanini uraufgeführten Quasi-Prolog "Cassandra" des unbekannten Italieners Vittorio Gnecchi (1876-1954), die dieser gemeinsam mit dem Puccini-Librettisten Luigi Illica verfasst hat, sollte nun das Steuer rumreißen, den Leck geschlagenen Operntanker auf Kurs bringen. Es gelang nur kläglich. BILDER WIE AUS DER REGIESCHULE Nicht dass der ambitionierte Doppelabend ("Elektra" wird künftig auch allein gespielt) ein Misserfolg geworden wäre. Das Premierenpublikum zumindest jubelte. Nur für was eigentlich? Das um 20 auf 50 Minuten gekürzte Gnecchi-Stück erzählt dramaturgisch schwerfällig in oratorienhaft unverbundenen Szenen die Vorgeschichte am Atridenhof zu Mykene, versucht um Sympathie für Klytämnestra zu werben, deren Tochter Iphigenie von Agamemnon dem Trojanischen Krieg geopfert wurde, und die sich zudem mit dessen Geliebter Kassandra konfrontiert sieht. Gnecchi lässt gleich zu Anfang mit einem Akkord aufhorchen, den Strauss später zu seinem Agamemnon-Motiv umgedeutet hat, und wartet mit einer flüssigen, eher polyphon deutschen denn melodieselig italienischen Musik auf, die freilich schon nach zehn Minuten "Elektra" hinweggefegt und vergessen ist. Ein reizvoller Dramaturgenfund also, mehr nicht. Kirsten Harms inszeniert das brav, wie in der Regieklasse, mit einer Beil und abgezogenen Hammel schwingenden Klytämnestra-Blondine im kleinen Schwarzen, mit Perlenkette und blutigen Armen. Auch Agamemnon kommt blutrot, in eine Militärdecke gehüllt aus dem Krieg, der hinterm bühnenfülllenden Adventstürchen zu vermuten ist. Der kommentierende Chor, weißgekalkt, im Einheitsanzug zahnloser Regiemoderne, ringt eurhythmisch die Arme aus den Seitenlogen. STATT KRACH UND KNALL NUR BLUBBERBLASEN Bei "Elektra" schlägt dann erbarmungslos die Stunde der Regiewahrheit; mit Versionen von Kusej, Konwitschny und Bieito hängt die Latte aktuell hoch. Harms aber spult ab, hat nichts zu erzählen, weder über Familie noch Schicksal oder Mythos, stellt ihr Personal beziehungslos in den mit schwarzem Granulat und Knochen gefüllten Kasten ihres als Ausstatter erbärmlichen Ehemanns. Vor zwanzig Jahren wäre das modern gewesen, heute langweilt es nur. Dazu kommt - Ausnahme: Jane Henschels saftige Klytämnestra - eine redlich mittelmäßige Sängerschar und ein allzu sanftmütiger Leopold Hager am Pult. Wo es sonst krachen und fetzen, wo große Oper gellen und Pathos quellen müsste, da blubbert die Musiktheaterblutsuppe höchstens lauwarm. |
|
|
"Cassandra" und "Elektra" an der Deutschen Oper Von Esteban Engel / WZ Online / dpa Mit einer Doppelpremiere wollte Kirsten Harms, die Intendantin der Deutschen Oper Berlin, ein Jahr nach der "Idomeneo"-Affäre ihr Haus aus den Negativschlagzeilen holen. Mit selten gespielten Kurzoper "Cassandra" des Italieners Vittorio Gnecchi (1876-1954) und Richard Strauss' Einakter "Elektra" gelang Harms als Regisseurin zwar ein Publikumserfolg - ein Aufbruch war es nicht. Demonstrativ spendete ein Teil der Zuhörer Beifall, doch auch Buhrufe mischten sich dazwischen. Der Samstagabend stand am Ende einer verheißungsvollen Woche für das gebeutelte Berliner Opernhaus. Mit der Berufung von Donald Runnicles zum neuen Generalmusikdirektor war dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) ein Coup gelungen. Harms will nun wieder mit Kunst Aufmerksamkeit bekommen. Der Skandal um die "Idomeneo"-Absetzung hat ihr schwer zugesetzt. Weil in der Inszenierung von Hans Neuenfels der abgeschlagene Kopf des Religionsgründers Mohammed zu sehen ist, hatte sie der Warnung der Sicherheitsbehörden vor angeblich drohenden islamistischen Anschlägen nachgegeben und die Oper vom Programm genommen. Nach heftigen Protesten wurde sie wieder unter Polizeischutz wieder gespielt. Die Fachzeitschrift "Opernwelt" erklärte in ihrer Kritikerumfrage die Deutsche Oper zum "Ärgernis des Jahres". Zwar ist das Tandem "Cassandra-Elektra" keine Weltnovität. Schon 1954 wurden beide Werke erstmals an einem Abend gespielt. Sie kreisen um den zentralen griechischen Mythos des Atriden-Geschlechts und stehen auch musikalisch in enger Beziehung zueinander. Musikwissenschaftler haben behauptet, dass Strauss von "Cassandra" (1905) für seine "Elektra" (1909) abgeschrieben habe. Tatsächlich kannte Strauss (1864-1949) die in Bologna unter Arturo Toscanini uraufgeführte "Cassandra" sehr gut. Und die Partituren haben auffällige Gemeinsamkeiten. Doch gegen "Elektra" kann "Cassandra" nur verlieren. Wo Strauss ein "Gemenge aus Nacht und Licht, schwarz und hell" bietet, so Librettist Hugo von Hofmannsthal, baut Gnecchi eine Klangwand auf, auf der es fast ohne Steigerung vom ersten bis zum letzten Akkord heftig, laut, erregt zugeht. Die etwa 50 Minuten lange "Cassandra" zeigt die Vorgeschichte von "Elektra". Die Rache von Königin Klytämnestra am Opfertod ihrer Tochter Iphigenie steht hier im Mittelpunkt. Mit ihrem Geliebten Aegisth erfüllt sie die Weissagung Cassandras und bringt König Agamemnon um. In "Elektra" geht es dann um die Rache von Agamemnons Tochter Elektra am Mord ihres Vaters. "Cassandra" spielt vor einem goldenen Vorhang auf der Rampe, aus dem Saal begleitet der Chor das Geschehen. Für "Elektra" haben Harms und ihr Bühnen- und Kostümbildner Bernd Damovsky im Hinterhof des Palastes von Mykene dunklen Sand anliefern lassen. Die Sänger müssen durch eine Art Mondlandschaft waten, in der neben viel Unrat auch das immer wieder auftauchende Rachebeil der Elektra vergraben ist. Agamemnons Tochter Elektra ist im Rachewahnsinn gefangen, nur der Tod der Mörderin ihre Vaters verspricht ihr Befreiung. Am Ende steht sie einsam und verloren da. Trotz stimmlicher Probleme wurden die Amerikanerinnen Susan Anthony als Klytämnestra in "Cassandra" sowie Jeanne-Michèle Charbonet in der "Elektra"-Titelpartie gefeiert. Jubel erhielten aber vor allem Malgorzata Walewska als Kassandra in Gnecchis Oper sowie - in "Elektra" - Jane Henschel als dämonische Klytämnesta und der Berliner Rainer Goldberg als Aegisth. Auch das Orchester unter Leopold Hager, das zuweilen etwas schleppend agierte, bekam großen Zuspruch. |
|
|
Ohnmacht und Mord Von Georg-Friedrich Kühn An der Deutschen Oper brachte Kirsten Harms in einer dreistündigen Doppelpremiere gleich zwei starke Frauen auf die Bühne: Cassandra und Elektra. Dabei waren viele eher skeptisch, denn der 1876 geborene Komponist Vittorio Gnecchi und sein Werk "Cassandra" sind nahezu vergessen. Wie sollte seine Oper über die Trojanische Seherin gegen Richard Strauss' Meisterwerk über die Agamemnon-Tochter "Elektra" bestehen? Stärkste Szene dieses Doppelabends ist zweifellos der Schluss, wenn Orest, der heimgekehrte Bruder der Elektra die Mutter Klytämnestra und ihren Liebhaber Ägisth ermordet hat. Wie ein bluttriefender Skalp erscheint er da im Burg-Türchen, einer Art Müllkippe: es ist die nämliche Maske, in der sein Vater, der Troja-Heimkehrer Agamemnon in der der Strauss-Hofmannsthalschen "Elektra" vorangestellten "Cassandra" auftrat. Unten im Vorhof, wo Elektra im modrigen Abfall hauste, hat die Rache-brütende Agamemnon-Tochter ihren grauen Kittel ausgezogen. Im weißen Kleid wie die erinnerte und vom Vater für günstige Winde geopferte Schwester Iphigenie tanzt sie ihren Rache-Triumph.Und viele kleine Iphigenien kriechen wie Maden und Würmer in das knietief aus geschwärztem Kork bereitete Grab, bewegen sich, ihre Körper schlängelnd, krümmend - bis sie langsam ermatten und im Orchester das Agamemnon-Thema noch mal aufleuchtet. Dies Agamemnon-Thema, mit dem die Strausssche "Elektra" auch beginnt - und das ist das Verblüffende - findet sich sehr ähnlich schon vorgebildet in der "Cassandra"-Oper von Vittorio Gnecchi. Gnecchis "Cassandra", 1905 immerhin von Arturo Toscanini in Bologna uraufgeführt, hat Strauss wohl gekannt. Er stand damals in engem Kontakt mit Toscanini, der gern seine gerade fertige "Salome" in Italien erstaufführen wollte. Gnecchi, heute vergessen, erzählt in "Cassandra" gleichsam die Vorgeschichte zur Straussschen "Elektra": Die Heimkehr des Agamemnon aus dem Krieg und seine Ermordung durch die noch junge Klytämnestra, die nicht verwinden kann, dass er die gemeinsame Tochter Iphigenie auf dem Altar des Kriegsglücks geopfert hat. Gnecchis Musik ist eine Art Dauer-Espressivo, auf 50 Minuten verdichteter, italianisierter, singbarer Wagner, aber ungleich weniger raffiniert im Satz wie in der Instrumentation, vom ästhetischen Rang eigentlich inkompatibel mit dem Straussschen Monolithen "Elektra". Kirsten Harms, die Regisseurin und Intendantin der Deutschen Oper Berlin, nennt denn vor allem dramaturgische Gründe, warum sie beide Stücke zu einem mehr als dreistündigen Abend zusammen spannt. Ich wollte zeigen, dass die Mutter bereits eine ähnliche Geschichte erlebt hat, um den Zuschauer in die Einfühlung in diese Figur zu schicken. Aber nicht nur musikalisch ist der erste Teil des Abends ungleich schwächer, auch szenisch kommt er übers Schablonenhaft-"Eindeutige" nicht hinaus. Interessant ist lediglich die Figur der Seherin Cassandra, die zwar das kommende Unheil sich fortpflanzender Rache und Gewalt ahnt aber nicht verbalisieren kann. Sängerisch und darstellerisch überragend in "Elektra" die gealterte, ihr Beil wie eine Gehhilfe schwingende Klytämnestra der Jane Henschel. Bewundernswert, wie Jeanne-Michèle Charbonnet die Partie der Elektra durchsteht - und in der Mini-Rolle des Ägisth Reiner Goldberg als Einspringer. Bei ihm versteht man auch - alte Schule - jedes Wort, ohne dass man sich in die Übertitelungsanlage flüchten muss. Leopold Hager am Pult liefert kaum mehr als Routine. Das Publikum applaudierte denn auch enthusiastisch vor allem den Sängern. Die Regisseurin musste auch einige Buhs einstecken - und mit ihr das Team: Silvana Schröder als Choreografin der Schlussszene und Bernd Damovsky für sein goldglänzendes Mykene-Einheits-Bühnenbild und die überwiegend in schwarz-weiß geschneiderten Kostüme. Für das in letzter Zeit gebeutelte Haus ist das immerhin ein Punkterfolg. Und zusammen mit der Nachricht über den künftigen neuen Generalmusikdirektor Donald Runnicles darf man nun vielleicht hoffen, dass die Deutsche Oper das tiefe Tal der Tränen hinter sich lässt. |
|


 Bernd Damovsky’s set, simple but not abstract, focused attention upon the bestial existence Elektra has led since the murder of Agamemnon. Banished from what passes for human society in the
Bernd Damovsky’s set, simple but not abstract, focused attention upon the bestial existence Elektra has led since the murder of Agamemnon. Banished from what passes for human society in the Jane Henschel is not the sort of artist to give so searingly nasty a reading of Klytämnestra as, say, Felicity Palmer (whom I have seen in London and Amsterdam), but the grotesquerie of this mother on her very last legs provided compensation. This never tipped into caricature, but her hysterical laughter duly horrified, upon momentarily regaining the upper hand by having taunted her daughter with news of Orest’s death. It focused more sharply what her words and vocal line had already told us, proceeding from her dreams rather than seeming a gratuitous addition to an already over-heated atmosphere. Burkhard Ulrich’s Aegisth was suitably sinister, oozing malevolent decay, yet once again without edging into caricature, as so often happens in this small but crucial part. Alfred Walker presented a fine Orest, absolutely secure in the role that Fate has allotted him, beautiful and implacably strong of tone, and truly moving during the revelation of his identity to Elektra. The orchestra’s role in the Recognition Scene – essentially, following Wagner, as Chorus to the protagonists – assisted them greatly. So much that could not be said in words followed the moment of recognition. Also deeply moving was Claudia Iten’s heartfelt Chrysothemis, unconditional in her love for her afflicted sister, yet appropriately horrified by Elektra’s plans.
Jane Henschel is not the sort of artist to give so searingly nasty a reading of Klytämnestra as, say, Felicity Palmer (whom I have seen in London and Amsterdam), but the grotesquerie of this mother on her very last legs provided compensation. This never tipped into caricature, but her hysterical laughter duly horrified, upon momentarily regaining the upper hand by having taunted her daughter with news of Orest’s death. It focused more sharply what her words and vocal line had already told us, proceeding from her dreams rather than seeming a gratuitous addition to an already over-heated atmosphere. Burkhard Ulrich’s Aegisth was suitably sinister, oozing malevolent decay, yet once again without edging into caricature, as so often happens in this small but crucial part. Alfred Walker presented a fine Orest, absolutely secure in the role that Fate has allotted him, beautiful and implacably strong of tone, and truly moving during the revelation of his identity to Elektra. The orchestra’s role in the Recognition Scene – essentially, following Wagner, as Chorus to the protagonists – assisted them greatly. So much that could not be said in words followed the moment of recognition. Also deeply moving was Claudia Iten’s heartfelt Chrysothemis, unconditional in her love for her afflicted sister, yet appropriately horrified by Elektra’s plans.