|
Bayreuther Festspiele Von Eleonore Büning Es ist so still geworden. Keine Enthüllung, keine Bezichtigung, keine Schlagzeile. Bayreuth steht im Stau. Erst im September wird die Entscheidung fallen im Stiftungsrat. Erst dann wissen wir, ob Wolfgang Wagner es diesmal wirklich ernst gemeint hat mit seiner Rücktrittserklärung oder ob er nicht doch, verjüngt und erfrischt durch das Ritual der Nachfolgedebatte wie Titurel durch die rituelle Enthüllung des Grals, wieder zurückkehren und die Bayreuther Festspiele für weitere gefühlte tausend Jahre leiten wird. So lange, wie diese Frage nicht geklärt ist, halten alle sicherheitshalber die Luft an. Der Debattenbedarf mag groß sein, die Nachrichtenlage jedoch ist mager. Die einzige einigermaßen frische Neuigkeit, die aus dem Festspielhaus vorab nach draußen drang, war, dass man heuer ein Public Viewing auf dem Bayreuther Volksfestplatz veranstalten wolle (wie schon seit Mortiers Zeiten in Salzburg auf dem Mozartplatz üblich) und dazu einen Internet-Livestream einrichte (mit 49 Euro für einmal „Meistersinger"-Gucken auf einem Preisniveau, das sich nur mit dem der Pornoindustrie messen kann). Temporärer Familienfrieden Unterdessen sind die Nachkommen des Komponisten Richard Wagner, die doch sonst alle Jahre wieder spätestens im Mai das Familienkriegsbeil auszugraben pflegen, um einander festspielvorbereitend zu verhauen und zu beharken in Interviews und Homestorys, alle miteinander ungeheuer lieb. Nike nörgelt nicht mehr (oder nur ganz leise). Kathi bellt nicht mehr in jedes Mikrofon und hat sich die ungezähmte blonde Jugendmähne in ordentliche Erwachsenenlocken legen lassen. Eva blickt wie immer stumm auf dem Tisch herum. Und der Alte hat das Knurren tief aus seiner Fafnerhöhle heraus so nachhaltig eingestellt, dass schon die Furcht umging (oder war es doch nur wieder ein boshaftes kleines Gerücht, vielleicht von Nichte Nike lanciert?), er habe darüber das Atmen vergessen und sei nicht mehr am Leben. Keine Sorge. Am Freitagabend bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele lächelte der Prinzipal strahlend in die Kameras. Von der dritten Umschlaginnenseite des offiziellen Festspielbuches lächelte mit, so strahlend wie auch im wahren Leben nur am Tag der Festspieleröffnung, „in memoriam" seine im November vorigen Jahres verstorbene Frau Gudrun. Wie immer waren Thomas Gottschalk mit Ehefrau Thea (regenbogenfarben, Tüll), Günther Beckstein mit Ehefrau Marga (dunkelgrün, Paillette), Joachim Sauer mit Ehefrau Angela (hellpetrol, Satin) und viele andere wichtige Wagnerianer mit am Start. Und wie immer trafen sich auch an diesem Freitag die Chormitglieder und Orchestermusiker der Bayreuther Festspiele morgens noch schnell am efeubedeckten Grab Richard Wagners im Garten der Villa „Wahnfried", um dem Meister ein Ständchen zu bringen. So verlangt es das Ritual. Am Abend steht der Chor schon wieder um dieses Grab herum. Jetzt ist der Efeu zurückgestutzt auf einen dünnen, grünen Rand. Die so entblößte Grabplatte erinnert so stark an die aus Syberbergs Wagner-Film, dass man jeden Augenblick damit rechnen muss, dass sie sich öffnen und Adolf Hitler heraussteigen wird. So weit kommt es dann zwar nicht. Aber es gibt genügend Augenblicke in dieser Bayreuther Neuinszenierung des „Parsifals" von Stefan Herheim, die sich syberbergartig an diesen Gedanken heranrobben. Kein Buh, das ist verdächtig Herheim, Jahrgang 1970, ist einer der derzeit meistherumgereichten Götz-Friedrich-Schüler, er gehört zu jener dritten Generation im Musik-Regietheater, der es schwerfällt, die Stücke noch einmal neu umzukrempeln, zu enthüllen und zu überschreiben, wo doch die zweite und erste Generation schon alles umgekrempelt, enthüllt, überschrieben hat. Alle starken Bilder sind schon verbraucht, das wichtigste Werkzeug dieser dritten Generation ist also das Zitat. Das kann furchtbar öde werden. Außerdem stand Herheim auch noch vor der schwierigen Aufgabe, eine neue Bayreuther „Parsifal"-Lesart zu erfinden, die bestehen kann nach dem heiß umstrittenen, transzendierend-bildermächtigen „Parsifal", den Christoph Schlingensief hier inszeniert hatte (und der skandalöserweise viel zu früh wieder abgesetzt, nicht einmal als Film dokumentiert worden ist). Und nun dies: ein „Parsifal", der die Zustimmung aller, der Jung- und der Altwagnerianer auf sich zieht schon beim ersten Mal. Sehr verdächtig! Der kein einziges Buh provoziert bei der Premiere, zu Recht. Der witzig und schlüssig drei Geschichten gleichzeitig erzählt, ohne auch nur einmal den Faden zu verlieren. Der dabei dicht an der Partitur bleibt und keine Sekunde schulmeistert oder langweilt. Legt man aber am Ende all diese Fäden zusammen, dann kann daraus der Strick gedreht werden, an dem das Unternehmen Bayreuth sich vielleicht eines Tages selbst aufhängt. Parsifal im Wunderland Die politische der drei Geschichten handelt vom Clan der Wagners und ihrer unseligen Nähe zu den Verbrechen der deutschen Vergangenheit. Diese Story beginnt 1871 oder auch 1882 (dem Jahr der „Parsifal"-Uraufführung) im Kaiserreich und endet 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik oder auch 2008 (rechnet man das finale Satyrspiel im Bundestag dazu). Die zweite ist märchenhaft legendenschwer und berichtet vom Unschuldsdummkopf Parsifal, der erst auf Umwegen über Kundrys Sündenküsse welthellsichtig wird und dann nicht nur dem Gralsritterkollektiv Erlösung bringt von allem Übel, sondern der ganzen Welt. Auf der dritten Ebene kommen wieder einmal reichlich Matrosenanzüge zum Einsatz, obligatorisch in allen von Freud inspirierten Operninszenierungen: da verwandelt Herheim den „Parsifal" in den Albtraum eines Kindes, das seine Mutter (Herzeloide) zu früh verliert, sich schuldig fühlt und diesen Knacks gründlich ödipal durcharbeiten muss, durchs eigne Unterbewusste stolpernd wie Klein-Alice durchs Wunderland. Oft fügt sich das auf verblüffende Weise zusammen: „Fort ins Bad", singt Kundry, die wir anfangs als Supernanny des kleinen Parsifal-Knaben im Haus „Wahnfried" kennengelernt haben, viel später, als sie schon große blaue Albtraumengelsflügel trägt, dem in Hermelin gehüllten Gralskönig Amfortas zu. Aber ihr ausgestreckter Gouvernantenzeigefinger zeigt wieder auf das Kind, und das steigt denn auch brav in die Wanne hinein und zieht sich aus. Als es dort untertaucht und sich, da eben die Rede ist vom steinalten Gralskönig Titurel, vorübergehend in einen faltigen Greis verwandelt, ruft der weise Gurnemanz, der eigentlich gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt ist, beiseiteblickend erstaunt: „Das ist ein anderes!" So dicht gefügt hat Herheim diese einander palimpsestartig übermalenden Parallelhandlungen, dass Albernheit und Tiefsinn immer wieder identisch werden. Ein Hauch von Transzendenz Es geht los im Innern der Villa „Wahnfried", wo die Wände mit englischen Tapeten bezogen sind und die Pendeluhr tickt auf dem Kaminsims. Über dem Kamin prangt das Bild der Germania von Kaulbach. Und hoch über allem schwebt im Wappen der deutsche Adler, der im zweiten Aufzug als NS-Reichsadler nach Westen blickt und nicht nach Osten, in den zu erobernden Lebensraum, ironischerweise dann aber im dritten Aufzug, als Bundestagsemblem, wieder in die ,richtige' Richtung gedreht ist. Wozu dieser Adler? Er gehört zwingend zum Stück: Anfangs verwandelt sich das Vieh wie durch Zauberei in jenen Schwan, den Parsifal im heiligen Gralswald vom Himmel schießt. Am Ende, als niemand mehr mit so etwas wie Transzendenz rechnet, schwebt plötzlich an seiner Stelle eine winzige, leuchtende, weiße Taube und wirft ihr Licht auf eine gerasterte Weltkugel aus Spiegelglas, so, dass sich das Publikum nun selbst darin erblicken kann, ebenfalls grob gerastert. Mit diesem Raster erinnert Herheim an die Bleistiftzeichnung, die der Bühnen- und Kostümbildner der Uraufführung des „Parsifals", Paul von Joukowsky, am Vorabend von Wagners Tod vom Meister anfertigte: eine Studie in Perspektiven, Tribut an die Ordnung vom Raum in der Zeit. Zugleich erfüllt Herheim, was Wagner, als die letzten Erlösungsakkorde der Oper aufwallen in purem Es-Dur, in die Noten geschrieben hat: „Aus der Kuppel schwebt eine weisse Taube herab und verweilt über Parsifals Haupte." Bitte nehmen Sie Abstand! Als der erwachsene Parsifal den Schwan erschießt, da trifft er aus Versehen (wie der Max ums Haar seine Agathe erschießt in Webers „Freischütz") sich selbst oder vielmehr: den Knaben Parsifal, und hält sich selbst betroffen tot in den Armen. Die klappsymmetrische Parallelstelle dazu ergibt sich später im zweiten Aufzug, als nicht Klingsor den Speer nach Parsifal wirft, sondern sein jüngeres Selbst, das allerdings längst keinen Matrosenanzug mehr trägt, sondern als Hitlerjunge unter dem Schutz einer SA-Sturmgruppe steht. Am Schluss des ersten Aufzugs sind die Grals-Soldaten noch munter durch die Verandatür von „Wahnfried" hinaus in den Ersten Weltkrieg marschiert. Am Schluss des zweiten hängen Hakenkreuzfahnen über „Wahnfried", und hinter den hohen Fenstern tobt im Innern ein Feuersturm. Im letzten Aufzug aber liegt „Wahnfried" in Trümmern, der Springbrunnen ist versiegt. Wie toll dehnen und spreizen sich die Räume in dem von Heike Scheele erfundenen Bühnenbild, bilden sich Kuppeln aus, ganze Wälder und lächerlich verkleinerte Bundestagssitzungssäle. Manchmal rumpeln die Kulissen bei diesen Verwandlungen so laut, als hätte Herheim vergessen, dass nicht nur dieser Parsifal als einziges Wagner-Werk für dieses Festspielhaus komponiert wurde, sondern auch umgekehrt das Haus einst gebaut wurde für diese Musik. Metallisch, kernig, sicher Der Dirigent Daniele Gatti, ebenfalls Bayreuth-Debütant, kommt auf Anhieb überraschend gut mit der schwierigen Bayreuther Akustik klar. Es gibt keine Wackler, alles fließt. Gatti versucht, den „Parsifal" als ein transparentes Kammermusikstück zu musizieren, mit teilweise elegisch verzögerten Tempi, die den Sängern schwer zu schaffen machen. Anfangs klingt das Orchester noch seltsam matt, im Laufe des Abends blüht es auf. Die Chöre singen, wie immer, großartig. Und sogar die Solo-Sängerleistungen sind, für Bayreuther Verhältnisse, nicht übel. Außer von der flackernd manierierten Kundry (Mihoko Fujimura) sind keine falschen Töne zu hören. Christopher Ventris als Parsifal, metallisch, kernig, sicher, spielt und singt so strahlend intensiv, dass er im zweiten Aufzug zum Zentrum der Aufführung wird. Einmal, im letzten Aufzug, zitiert Herheim ein Verfahren von Neuenfels und projiziert einen Text an die Wand. Es ist der Wunsch nach einer Stunde Null, wie sie die Wagner-Brüder Wieland und Wolfgang 1951 bei der Wiedereröffnung Bayreuths per Aushang formuliert hatten: Damit der Festivalbetrieb reibungslos ablaufe, bäten sie, von politischen Gesprächen freundlichst Abstand nehmen zu wollen. Es ist ein bisschen spät, wenn ein halbes Jahrhundert danach endlich auch auf der Bayreuther Bühne dieser Wunsch so offen ignoriert wird. Jetzt, nachdem junge Regisseure wie Stefan Herheim oder Katharina Wagner den Bann in Bayreuth gebrochen haben, wäre es an der Zeit, dass auch die Festspielleitung ganz offiziell etwas täte, um über die eigene Vergangenheit aufzuklären. Man muss ja nicht gleich Winifreds Tagebücher aus dem Archiv zerren. Eine kleine, erläuternde Plakette an den Breker-Skulpturen im Festspielpark wäre schon ein Anfang. |
|
Bayreuth VON HANS-JÜRGEN LINKE Während der Ouvertüre schon erfährt man plausible Gründe dafür, warum Parsifals Mutter den Namen Herzeleide trägt, und die Bewohner der Gralsburg sind sicher keine Engel. Dazu sind ihre großen Schwingen zu dunkel gefiedert, und die Gralsburg wirkt wie eine Stilkopie der Villa Wahnfried. In dem wilhelminischen Spätbiedermeier-Interieur repräsentieren säbelbewehrte Burschenschaftler, Schaukelpferd und Burg das Männlichkeitsbild für den Jungen, der Matrosenanzug trägt und dem allerlei rätselhafte Dinge widerfahren: die Mutter verlangt beängstigend nach ihm (oder verlangt es den Sohn beängstigend nach der Mutter?), Vater Amfortas leidet unter einer bösen Wunde, und hinter dem weißen Schwan, den er übermütig aus dem Wappen schießt, erscheint ein raubgieriger heraldischer Adler. Stefan Herheims brillant intelligente Inszenierung des "Parsifal", mit dem die Bayreuther Festspiele eröffnet wurden, macht das Personal des Bühnenweihfestspiels mit den Wagner-Zeitgenossen Sigmund Freud und Henrik Ibsen bekannt, und er zeigt den Ort der Handlung, nämlich der Spielstätte der Bayreuther Festspiele selbst. Freud machte den psychohistorischen gordischen Knoten des Ödipus-Komplexes als Ursache für Wagners Dauerschrei nach Erlösung aus. Ibsen zeigt, wie sich Unerlöstes in familialen Konstellationen weiter tradiert und zur Katastrophe drängt. Und dass die Katastrophe nicht unbedingt in der Familie bleibt. Es ist immer die gleiche Geschichte, die sich immer wieder neu erzählt. Bei Stefan Herheim kommt sie dreimal in sich zuspitzenden Varianten vor. Er erzählt nicht redundant das Ritual, das Wagners Plot selbst entfaltet, sondern gibt den Figuren Mehrdeutigkeiten, die Fragen aufwerfen und Schlüssel anbieten zu verborgenen Räumen dieser deutschen Gralsburg. Kundry (Mihoko Fujimura) ist eine tief ambivalente Frauenfigur, eine durch die Geschichte getriebene dunkle Seite von Parsifals Mutter Herzeleide. Schmerzensmann Amfortas (Detlef Roth) ist immer auch der anklagende Sohn eines Vaters, der ihm das eingebrockt hat. Es sind immer die Söhne, die es richten sollen, und immer die Mütter, die die Söhne treiben, das zu tun. Herheim erzählt auch, was und wen Parsifal (Christopher Ventris) alles zu erlösen hat - oder hätte - und lässt dabei manchmal Bilder entstehen, in denen das alles auch ein fürchterlicher Albtraum sein könnte, der einem verschreckten Jungen, einem verstörten Jüngling das Leben schwer macht. Handlungen verschachteln, Personen verwandeln sich, Kehrseiten werden bestürzend sichtbar, aber die Geschichte, um die es geht, ist die deutsche Geschichte, die nebenher, aber in großer Klarheit erzählt wird, einzig der sehr markante Gurnemanz (Kwangchul Youn) bleibt ohne Janusgesicht. So endet der erste Akt mit dem falschen Erlöser Wilhelm II. und dem Ersten Weltkrieg. So beginnt der zweite Akt in einem Lazarett (in dem die Blumenmädchen Krankenschwestern und Soldatenbräute sind), Klingsor (Thomas Jesatko) ist eine luziferische Variante des Entertainers aus dem Film Cabaret, Kundry eine Art blauer Engel (Kostüme: Gesine Völlm). Am Ende besetzt die SS die Welt, der Zweite Weltkrieg beginnt wie eine Götterdämmerung. Aber die Geschichte beginnt in Trümmern wieder von vorn, die verlassene Gralsburg ist diesmal der Bundestag, endlich könnte eine Erlösung gelingen. Und damit niemand auf die Idee kommt, dass Parsifal allein es schon richten wird, lässt Herheim einen riesigen Spiegel über der Bühne aufgehen, der dem Publikum das Subjekt und Objekt der Erlösung zeigt. Die Frage, warum Bayreuth schon wieder einen neuen "Parsifal" brauchte, beantwortet diese Inszenierung sehr überzeugend aus sich selbst. Daniele Gatti, der zum ersten Mal in Bayreuth dirigiert, braucht für den "Parsifal" fast eine Stunde länger als Pierre Boulez. Pausen und retardierende Momente werden ausgekostet, Klangfarben langsam inszeniert und verschoben, aber nie satt aufgetragen, das Ritual braucht seine Zeit und seine Zurückhaltung. Zumindest im ersten Akt passt das alles wunderbar auf Herheims Art zu erzählen, er scheint jede Minute, die Gatti ihm gibt, zu nutzen. Im zweiten und besonders im dritten Akt kommt es dann doch zu Längen, in denen die Geschichte aus der Musik und der pathetisch-statuarischen Dramatik keine Energie mehr bezieht, sondern sich eher aufhalten lässt. Diesen Stör-Effekt im Detail einer ansonsten grandios überzeugenden Inszenierung können die Sänger ausgleichen: Niemand bricht ein, jeder ist stimmlich und darstellerisch in jedem Augenblick der Größe der Aufgabe gewachsen, und nie tun Sänger einfach nur, was Sänger eben tun, wenn ihnen niemand gezeigt hat, was sie tun sollen. Herheims Inszenierung besticht nicht nur durch ihren großen Bogen, sondern auch durch ihre präzise ausgefeilte Arbeit im Detail. Und durch ein eingängiges und äußerst raffiniertes Bühnenbild, das Heike Scheele hat bauen lassen. Es enthält eine hohe Bewegungsintelligenz und lässt bei aller Vieldeutigkeit stets die reale Umgebung als Bezugsraum erkennen. Vielleicht ist Bayreuth jetzt wirklich erlöst, auch wenn einige Zuschauer es nicht mochten, dass die SS im zweiten Akt die Bühne besetzte. Am Ende gab es begeisterten und fast einhelligen Beifall für alle und alles. Festspielhaus Bayreuth:3., 6., 16., 28. August. www.bayreuther-festspiele.de [ document info ] Dokument erstellt am 27.07.2008 um 16:32:01 Uhr Letzte Änderung am 27.07.2008 um 20:39:18 Uhr Erscheinungsdatum 27.07.2008 |
|
Bayreuther Festspiele Mit der Geschichte des reinen Toren Parsifal sind die Wagner-Festspiele in Bayreuth eröffnet worden. Der norwegische Regisseur Stefan Herheim bietet einen Trip durch deutsche Geschichte an. Für die Nazi-Embleme im zweiten Akt gab es Buhrufe. Dabei ist die Inszenierung in ihrer verspielten Art großartig. Von Manuel Brug Auf der Webseite der Bayreuther Festspiele ist jeder Oper, die dort diesen Sommer gezeigt wurde, ein Requisiten-Symbol zugeordnet: ein Korsett für "Walküre", ein röhrender Goldhirsch für "Die Meistersinger". "Parsifal" wird dort durch einen altmodischen Gralskelch symbolisiert. Und tatsächlich, in Bayreuth gibt es (wieder) einen rot leuchtenden Humpen, ein Speer mit glühender Spitze, die Amfortas’ Wunde schließt, einen echten Gralstempel, das Abendmahl – und sogar die hell blinkende Neontaube zum Erlösungsschluss. Der wirklich ein solcher, versöhnlicher, wenn auch offener ist: Eine Kleinfamilie blickt frohgemut in ein ungewisses Morgen, symbolisiert durch einen rotierenden Globus, in dem gleichzeitig wir, die Festspielgäste und die Außenwelt, uns spiegeln. Und noch einmal lässt Dirigent Daniele Gatti – in himmlischer Langsamkeit – das Festspielorchester unisono aufleuchten und zart-intensiv verklingen; so wie dieser dritte Akt überhaupt zum genussvoll zelebrierten musikalischen Höhepunkt des letztlich mit großen Beifall aufgenommenen Abends wurde. Buhs für das Hakenkreuz Zuvor aber, am Ende des zweiten Aktes, hatte es mitten in die Szene hinein Buh-Rufe gegeben, weil der so fantasievolle wie deutungsübermächtige Regisseur Stefan Herheim ein letztes Bayreuther Tabu gebrochen hatte, an das sich im letzten Jahr nicht einmal Katharina Wagner in ihrer provokativ bilderstümerischen „Meistersinger"-Inszenierung gewagt hatte: Während Kundry wütete, aus deren Kuss und Verführungsbann sich der endlich klarsichtig gewordene reine Tor Parsifal löste, wurden im Gralstempel und damit im Festspielhaus – wie zuletzt 1944 vor der Tür – die Hakenkreuzfahnen gehisst, und Wehmachtssoldaten marschierten auf. Doch der braune Fascho-Spuk währte nur kurz. Der heilige Speer, den der effeminierte, weil durch sich selbst kastrierte Zauberer Klingsor (schwacher Beller: Thomas Jesatko) durch einen Hitlerjungen auf Parsifal hatte werfen lassen und der von dem abgefangen wurde, bannte den faulen Nazizauber: der Swastika-Adler krachte in Trümmern. Später hing an seiner Stelle dann die Taube, vorher hatte in der Wappenkartusche erst der kaiserliche Reichsadler geprangt, dann der Schwan, den Parsifal im Gralsbezirk widerrechtlich schoss; im dritten Akt, raffiniert nach oben gespiegelt, die „fette Henne", der behäbige BRD-Adler aus dem alten Bonner Bundestag. So ist der neue Bayreuther „Parsifal" gleich fünffach auf den Vogel gekommen – und das im Jahr Eins nach Schlingensief. War bis 2004 gerade Wagners hier uraufgeführtes Bühnenweihfestspiel entweder affirmativ als dubioses Glaubensritual ausgestellt, im neuen Nachkriegs-Bayreuth dann schamhaft und allzu neutral nach dem Gurnemanz-Motto „Das sagt sich nicht" jeder konkrete Welt- und Wertbezug vermieden worden, so hatte Christoph Schlingensief 2004 auf seiner mit Projektionen überzogenen Drehbühne eine Zentrifuge von sich kaleidoskopisch brechenden Deutungssplittern entfesselt. „Parsifal" als weltumspannend universelle Kunstreligion, mit deren profanem Glaubensbekenntnis jeder nach seiner Facon glücklich werden musste und konnte. Das Bayreuth-Debüt eines Norwegers Dem setzte jetzt der 38-jährige, in Deutschland ausgebildete Norweger Herheim konsequenterweise einen ebenso vielschichtigen, aber gerichtet plakativeren Deutungsansatz entgegen. In Riga hatte er in seinem „Rheingold", das ihm die Festspiel-Einladung einbrachte, den „Ring"-Auftakt klamottig-komisch als Bayreuther Puppenspiel mit Festspielhaus und Krupp-Nibelungenstahlwerk erzählt, in dem das bekannte historische Personal von Richard und Cosima bis Nietzsche und Bismarck mit Schwellkopf-Masken als monströses Kasperletheater agierte und taktierte. Diesen Ansatz hat er jetzt am Original abgewandelt. Herheim geht es darum, mit einem kühnen Zeitsprung von der Uraufführung 1882 bis in die bundesdeutschen Nachkriegsjahre, vom waffenrasselnden Kaiserreich über die doppelte Weltkriegskatastrophe bis zum demokratisch nüchternen Neuanfang zu zeigen, wie sehr das sich scheinbar abschottende Werk in der konkreten Bayreuther Festspielgeschichte vom jeweiligen Zeitgeist instrumentalisiert und auch missbraucht wurde. Was rein gemeint war, wurde schnell beschmutzt, die Ursünde nicht nur der Opernmenschheit befleckt auch den „Parsifal" von Anfang an. Ein historisch-bildersatter, kein ideologiekritischer Ansatz. Der deshalb am Ende auch nicht oberlehrerhaft mit Zeigefinger oder Zaunpfahl winkt. „Parsifal" verklingt einfach – die Zukunft nach dem Motto „Erlösung dem Erlöser" kennt jeder selbst. So kann Herheim sogar mit all den seltsamen Ritualen des Stückes umgehen, sie einfach zeigen: Reinigung, Abendmahl, Fußwäsche, Taufe, Karfreitagszauber alles ist da und konkret – natürlich nie ungebrochen. Die formidable Haustechnik freilich hat es möglich gemacht, das die kulissenvolle Bühne von Heike Scheele samt der opulenten, stetig sich stilwandelnden Kostüme von Gesine Völlm reibungslos rotierte. Denn Stefan Herheim entfesselt zunächst einen altmodisch anspielungsreichen, nie stillstehenden, barock anmutenden Bilderzauber der Wandlung und Anverwandlung, wie man ihn heute nur noch selten auf den ach so kargen deutschen Trashbühnen zu sehen bekommt. Der sich in den Folgeakten mehr und mehr entschleunigt, sich auf die Hauptpersonen einlässt und konzentriert, ja fast zum Stillstand kommt; so wie der Bayreuth-Debütant Daniele Gatti. Der erste Akt in knapp zwei Stunden Der italienische Maestro sucht – wie hier schon Arturo Toscanini und Giuseppe Sinopoli – die Langsamkeit neu zu entdecken, bei einer Stunde und 56 Minuten erst kommt sein Auftaktakt zum Ende. Das hat wunderschöne, stark strahlende Momente, aber auch gar nicht himmlische Längen. Bisweilen zerfliesen die Akkorde, staut sich der Klang. Im zweiten Akt, wo Mihoko Fujimuras Kundry kalt gleißt, mit sprödem Timbre eisig erotisch, leider textunverständlich klirrt, fehlt die girrende, auch plüschige Sinnlichkeit als klangliches Korrektiv zu den ziselierten Tonsäulen der Gralsmotivik. Der ruhevolle, kontemplativ grüblerische, am Ende aber auch akkordhämmernde dritte Akt gleicht das aus und steigert es - zu eine unverständlicherweise auch missfallenden, dabei originellen Lesart. Dieser „Parsifal" beginnt und endet mit Toten, erst in der Villa Wahnfried, dann im deutschen Bundestag. In Plenarsaal wird dem alten Gralskönig Titurel (Diógenes Randes) im Sarg gedacht. Vorher, in Wagners Wohnhaus, stirbt Parsifals Mutter Herzeleide, betrauert von Butler, Stubenmagd, Arzt und Pastor, die nach dem stummen Vorspiel auf offener Bühne als balsamisch singender, unaufdringlich gelöst gestaltender Gurnemanz (Kwangchul Yun), als wildes Zofen-Weib Kundry und als Gralsritter wiederkehren. Das Bett bleibt zentraler Spielort, hier finden Leben, Liebe und Lebewohl, aber auch Inzest und Intrige statt. Personen versinken und verwandeln sich darin, so wie auch der Knabe Parsifal im Matrosenanzug heranwächst und (schließlich von Christopher Ventris strahlkräftig, aber ohne sphärische Zwischentöne eindrucksvoll gestaltet) sich in Variationen auslöscht und neu gebiert. So wie Wahnfried zugleich Außen und Innenraum ist. Der Saalerker wird zur Gralstempelapsis, die Säulen wachsen, die Kapitele strecken sich, Bäume fahren dazwischen, byzantinischen Kuppeln sinken herab. Unter den Gralsrittern sind Frauen Sogar Wagners efeuumrankte Grabplatte ist über den Souffleurkasten zu sehen. Hierhin flüchtet sich der mutterlose Knabe hinter eine Steinchenmauer, die übergroß als Bild projiziert wird. Die geht in Trümmern, wird aber am Ende für die neue Kunstreligion wieder errichtet. Dann schläft er ein, erlebt das Folgende als aus der Zeit gelösten (Alb-)Traum. Die Gralsritter, auch Frauen sind darunter, erscheinen als wilhelminische Engelsschar mit schwarzen Flügeln. Das mit allem nur möglichen Wagner- wie Glaubenskitsch zelebrierte Abendmahl ist die Wegzehrung der Soldaten für den ersten Weltkrieg. Der führt sie direkt in Klingsors Zaubergarten – ein Armeehospital, bevölkert von Blumenmädchen, die als Krankenschwestern oder Revuegirls beim Wasserbllett-Tanz auf dem Vulkan Ganzkörperbetreuung leisten. Klingsor regiert hier als androgyner Geck in Frack und Strapsen. Als sein Double, Marlene Dietrich nicht unähnlich, verführt Kundry Parsifal, bevor sie sich – fast zwangsläufig – als Mutter Herzeleide entpuppt. Die öde Aue des dritten Aktes ist – wird sind nun auf der nachgebauten Bayreuther Opernbühne - rauchendes Kriegschlachtfeld, Wahnfried nur noch Ruine. Zum Karfreitagszauber schlurfen Trümmerfrauen herein. Im zum Bundestag mutierten Gralstempel redet nun Fraktionsführer Amfortas (der textdeutliche, markant schmerzensreiche Detlef Roth) zu den von Chorleiter Eberhard Friedrich bestens präparierten Volksvertretern, nur noch die Dornenkrone erinnert an seinen vorigen Auftritt als Christus im Kaiserhermelin. Der als Kaulbachs Germania aus seinen Lebenskämpfen zurückgekehrte Parsifal versinkt im Büßergewand als Erlöser mit dem Bundesadler in der heiligen Quelle. Sein Kinderdouble, Gurnemanz im Soldatenrock und die überlebende Kundry gründen das neue Deutschland der Stunde Null. Nach dieser großartig verspielten, gleichwohl unbequemen, bisweilen auch mit ihren Einfällen nicht haushaltenden Inszenierung, die wie schon Katharina Wagner vehement die Bayreuther Festspiel-Geschichte mit einbezieht und die zudem musikalisch wie sängerisch fast durchgehend überzeugt, ist klar: Auch nach dem Abgang von Wolfgang Wagner, der sich mit Tochter Katharina ein letztes Mal auf dem roten Teppich zeigte, wird mit Bayreuth als Ort der innovativen Wagner-Weihe weiter zu rechnen sein |
|
Sturm der Zeichen CHRISTINE LEMKE-MATWEY
Gerade beginnt man sich zu räkeln, als wär’s ein hundsgemeiner dritter Akt „Parsifal", in dem Männer mit Zottelhaaren und Jesus-Gewändern stundenlang andere Männer mit Zottelhaaren und Jesus-Gewändern ansingen, ohne dass man von ihrer Drangsal je ein Wort verstünde – da gehen vorne an der Rampe bunt die Lichtlein an und klappen im Hintergrund zwei Spiegelwände zusammen. Parsifal, der geläuterte, reine Tor, Gurnemanz, der Hüter des Grals, und Kundry, das Weib, ehedem „Urteufelin" und „Höllenrose", nunmehr in Schuld verstummt, spielen Parsifal, Gurnemanz und Kundry auf dieser Bühne auf der Bühne und bitten zum Karfreitagszauber eine Schar Trümmerfrauen zu sich herauf. Ihr Mühseligen und Beladenen, ihr da unten, die ihr mal wieder damit betraut seid, die Welt bewohnbarer zu machen, sagt diese Geste, sollt teilhaben an der hehren, heil’gen Kunst. Und liegt die Villa Wahnfried, in deren Garten das Ganze spielt, auch in Trümmern: Wann, wenn nicht jetzt, in der Stunde Null nach Krieg, Tod und Verderben, sind Richard Wagner, seine Musik, sein monomanisches Selbsterlösungswerk für alle da. Kaum aber sind die Frauen mit ihren Kopftüchern und Zinkeimern der Bitte gefolgt, treten die Protagonisten ihrerseits heraus aus der Kunst, wie drei alte Showhasen nach der letzten Zugabe und gehen grell die Saallichter an. Wundersam unverbrauchter Regie-Effekt: Das Publikum darf sich in den Riesenspiegeln selbst bestaunen, wähnt sich mitspielend, mitleidend, existenziell teilhabend. Zum Raum wird hier der Mensch. Schade nur, dass Stefan Herheim, der Regisseur dieses kurz, aber heftig bejubelten Bayreuther „Parsifals", den gleichen Effekt noch einmal bemüht. Als fürchte er, nicht deutlich genug gewesen zu sein, als könne nicht oft genug gesagt werden, was so banal ist wie wahr und doch leicht in Vergessenheit gerät. Also klappt auch über dem Deutschen Bundestag in Bonn, dem finalen Bild des Abends, der letzten Station dieser fluoreszierenden Reise durch die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Wagnerschen „Bühnen-Weih-Fest-Spiels" (so will Alexander Meier-Dörzenbach, der Produktionsdramaturg, das Gattungsungeheuer notiert wissen) ein Spiegel herunter. Wieder Saallicht, nur dass sich diesmal eine Weltkugel mit im Spiegelbild dreht, wie einst im Logo des „Auslandsjournals". Und dass oben am Bühnenportal statt Reichs- oder Bundesadler, mythischem Schwan oder bösem Hakenkreuz emblematisch nun ein Friedenstäubchen grüßt. Nett, wenigstens einmal leise schmunzeln zu dürfen an diesem auf typisch Herheimsche Weise mit Ikonografischem vollgepumpten Abend. Vorne stehen derweil – „Enthüllet den Gral, öffnet den Schrein!" – Gurnemanz, Kundry und Parsifal als Kind. Unverwandt, wie festgewachsen starren sie geradeaus. Die heilige Familie: Vater, Mutter, Erlöser. So einfach und auf Anhieb wiederum so banal. Sechseinhalb Stunden Wagner in schweißtreibender Schwüle, der übliche B-Promi-Hügelauftrieb (von einer sichtlich gut gelaunten Angela Merkel mal abgesehen) und ein nach wie vor bescheidenes gastronomisches Angebot, vor allem aber viereinhalb Stunden heillos zerdehnte, künstlich-künstelnd sich ausmährende Tempi aus dem Graben und nach Luft schnappende Sängerdarsteller, um am Ende zu erfahren, was Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen ganz ohne Bayreuth und Wagner weiß: Kinder, ach ja, sind Zukunft? Das Ende als Ende indes dürfte signifikant sein. Die BRD in den fünfziger, sechziger Jahren, wir haben es geschafft, wir waren wieder wer. Samt Wagner und Neu-Bayreuth, ja dank Wagner und Neu-Bayreuth. „Parsifal" sei der natürliche Weg vom Überromantischen zur Klarheit, so rekapitulierte schon Wieland Wagner seine legendäre, das Festspielhaus nach dem Krieg wieder aufschließende Inszenierung von 1951: „Wagner, der Hyperromantiker, wird im ,Parsifal’ zum Neutöner." An dieser osmotischen Zeitfühligkeit des Werks ist 57 Jahre später auch Herheim gelegen, nur senkt er das Lot tief in die dunklen Stollen der Vergangenheit und schürft und gründelt und entfacht mithilfe seiner ingeniösen Bühnenbildnerin Heike Scheele (und der erstklassigen Bayreuther Technik unter Leitung von Karl-Heinz Matitschka!) einen Zeichensturm, dass man sich unablässig die Augen und Ohren reiben könnte, vornehmlich im großartigen ersten Akt. Eine Villa Wahnfried, die psychedelisch wächst und schrumpft, mal Inneneinsichten bietet, mal nur Fassade ist, mal gar ins Kathedralische aufschießt. Draußen vor der Tür aber branden Weltenmeere, lodern Weltenbrände (Video Momme Hinrichs, Torge Möller) und marschieren die Soldaten umstandslos vom Ersten in den Zweiten Weltkrieg, aus dem wilhelminischen Spießbürgertum direkt ins Varieté der Zwanzigerjahre. Kundry übrigens – und das ist nur eines von zahllosen Zitaten aus der Filmgeschichte wie aus der Bayreuther Aufführungstradition – verführt Parsifal im Outfit des blauen Engels à la Marlene Dietrich. Eine Szene, die, wie der gesamte zweite Akt, merkwürdig konventionell bleibt. Das liegt sicher auch daran, dass Mihoko Fujimura weder Vamp noch Verführerin ist, noch vom Dramatischen her eine echte Kundry; stimmlich stößt sie mit unschön aufgesetzten, flackernden Spitzentönen (wie schon im Christus-Lachen des ersten Aktes) an ihre Grenzen. Klingsor, der Zauberer, hat einen Transvestiten zu geben, oben Frack, unten Strapse, nun ja. Thomas Jesatko entledigt sich dieser Aufgabe unauffällig, mit eher nobel timbriertem als magisch-mephistophelischem Bariton. Überhaupt mag im Verlauf nicht immer alles aufgehen und dramaturgisch konsequent sein, auch hat man das Prinzip, den Urkonflikt und Sündenfall bald verstanden, dass nämlich Parsifal sich am Tod Herzeleides schuldig gemacht hat und ihren Fratzen und Gesichten fortan nicht mehr auskommt. Sei es, dass sie ihn ins eheliche Bett zwingt, sei es, dass er seine eigene Geburt und gruselige Hostien(=Erlöser)werdung fantasiert. „Parsifal", ein traumatisch-albtraumhaftes Muttermärchen, an dem die Psychoanalyse ihre helle Freude hat. Dennoch: Die Inszenierung besitzt eine enorme handwerkliche Virtuosität und einen reichen Atem. Bisweilen befällt einen gar die höllische Sehnsucht – dem alten Richard zum Entzücken! –, selbst mitzutun im nächtlichen Reigen und Treiben der Gralsritter, sich ein Paar schwarze, dickfedrige Schwingen aufzusetzen und einzutauchen in den Chor der gefallenen Engel. Geschichte, sagt das Regie-Team (Gesine Völlm für die Kostüme, Ulrich Niepel für das Licht, beides exquisit) funktioniert so wenig linear wie das menschliche Gedächtnis oder Unterbewusstsein – gerade die Geschichte der Wagners in Bayreuth. Ihr nachzugehen, die Bunkermentalität der Dynastie zu sprengen, um sich den Gespenstern und Genien der Vergangenheit ästhetisch zu stellen, diese Herheimsche Lust allein sorgt im 57. und letzten Jahr der Ära Wolfgang Wagner auf dem Grünen Hügel für mehr Neuanfang als alle renovierten Internetauftritte, alle Live-Streams, Public Viewings und plexigläsernen VIP-Lounges zusammen. Dass die Musik kaum mitspielt, dürfte allerdings Anlass zur Sorge geben. Eiferte Daniele Gatti, der fünfte Italiener im „mystischen Abgrund", seinem Landsmann Arturo Toscanini nach, er hätte noch zwanzig Minuten langsamer dirigieren müssen. Eine quälende Vorstellung, da Gatti nicht im Ansatz verrät, was er mit seinen gemessenen Zeitmaßen eigentlich bezweckt. Diese stehen in keiner Korrespondenz zum Bühnengeschehen, und verlangen den Sängern, wie gesagt, Lungen ab, die sie nicht haben. Christopher Ventris als Parsifal und Kwangchul Youn als Gurnemanz fehlen darüber hinaus, so ordentlich sie singen, schlicht die Persönlichkeiten für solch tragende Partien, und während Diógenes Randes’ Titurel sich mit drohend sonorem Bass behauptet, machen selbst die Blumenmädchen einen verschreckten Eindruck. Einzig Detlef Roths Amfortas, eine sterbenswunde, jämmerlich sich krümmende Gestalt, wagt den Schritt aus der sängerischen Deckung und zeigt Mut zum Ausdruck, zu nicht nur schönen, balsamischen Tönen. Auch Gattis Pianokultur aber und alles lyrische Weben bleiben letztlich selbstreferenziell und Lichtjahre von jeder Theaterpraxis entfernt. Ein seltener Luxus, gewiss, das Changieren der Musik zwischen Humperdinckschem Märchenidiom und Mahlerscher Häme so minutiös nachvollziehen zu können – doch: wozu? Das neutönerische Innenleben der Partitur, ihre Chemie scheint den Italiener kaum zu interessieren, und so denkt man fast wehmütig an Pierre Boulez’ oft als kaltherzig gescholtene Sezierleistung zurück. Über den Orchestergraben spannt sich an diesem Abend der Grabstein des Meisters, lorbeerumkränzt, ganz wie man ihn aus Wahnfried kennt. Eine vielsagende, makabre Brücke zwischen Bühne und Saal. Wenn Daniele Gatti nach oben blickt, dann sieht er das Grab von unten. Noch ist Richard Wagner, der Erlöser, nicht auferstanden. Aber es rührt sich was. |
|
Festspiele eröffnet Von Friedrich Pohl Die 97. Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth sind am Abend mit einer umjubelten Neuinszenierung der Oper "Parsifal" eröffnet worden. Im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel und viel Prominenz überzeugte der Berliner Regisseur Stefan Herheim mit einer originellen und schlüssig inszenierten Interpretation. Mit der bejubelten Premiere von Richard Wagners „Parsifal" sind am Abend die 97. Bayreuther Festspiele eröffnet worden. Es war ein künstlerisch beachtlicher Auftakt. Die Aufführung begann traditionell um 16 Uhr und endete gegen 22.45 Uhr – dieser „Parsifal" gehört damit zu den längeren Interpretationen des Werks. Am Ende wurde vor allem der Berliner Regisseur Stefan Herheim gefeiert, während das Orchester unter Leitung von Daniele Gatti einige Schwächen offenbarte. DANKESWORTE FÜR WOLFGANG WAGNER Zur Eröffnung hatten Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) und Wolfgang Wagners Tochter Katharina das Lebenswerk des Festspielleiters gewürdigt. Der 88-Jährige hat nach 57 Jahren an der Spitze der Festspiele seinen Rücktritt angekündigt. Nach dem Willen des Stiftungsrates soll die 30-Jährige Katharina Wagner die Nachfolge zusammen mit ihrer Schwester Eva Wagner-Pasquier (63) übernehmen. Die Neuinszenierung des „Parsifal" konnte insgesamt mit seinen großen Bildern faszinieren, dennoch gab es nach dem zweiten Aufzug, in dem Hakenkreuze gezeigt werden, auch heftige Buhs aus dem Publikum. Der neue „Parsifal" von Stefan Herheim löst nach vier Jahren die Inszenierung von Christoph Schlingensief ab. Es ist Herheims erste Regiearbeit in Bayreuth. Der gebürtige Norweger, der in Berlin lebt, gilt als einer der gefragtesten, wenn auch umstrittensten Regisseure seiner Generation. Spätestens seit seinem Debüt bei den Salzburger Festspielen 2003. Damals inszenierte er Wolfgang Amadeus Mozarts „Die Entführung aus dem Serail" als eine aktualisierte Skandal-Revue und zog sich damit den Zorn der Besucher zu. Nun ist er also in Bayreuth, womit Herheim die beiden Fixpunkte eines jeden Opernregisseurs erreicht hätte – in einem Alter von gerade mal 38 Jahren. SCHON HITLER FAND GEFALLEN AN DER OPER Mit „Parsifal" hat man ihm nicht gerade unproblematisches Material überlassen. Denn schon Adolf Hitler fand Gefallen an Wagners „Bühnenweihfestspiel" (Originalbezeichnung des Komponisten) und schrieb einmal: „Aus Parsifal bau ich mir meine Religion." Grob zusammengefasst erlöst in „Parsifal" der Titelheld (der „reine Tor") den an einer unverschließbaren Wunde leidenden Gralskönig Amfortas. Zuvor muss er aber noch weiblichen Verlockungen widerstehen (in Form der ewig verdammten Kundry), „wissend werden" und einen arglistigen Zauberer (Klingsor) besiegen. Zuletzt hatte Christoph Schlingensief das mit rund viereinhalb Stunden Dauer nicht eben längenarme Epos auf die Bayreuther Bühne gebracht. An seiner bildgewaltigen Umsetzung fanden allerdings nur wenige Wagnerianer Gefallen. Weil am Ende ein Video mit einem verwesenden Hasen zu sehen ist, tauften Kritiker die Inszenierung „Hasifal". Herheim inszeniert seinen „Parsifal" als Zeitreise durch die Geschichte. Wobei er die Figur des Parsifal als Sinnbild für das sich zur Demokratie entwickelnde Deutschland interpretiert. Vom Kaiserreich Wilhelms II. Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Bonner Republik im 20. Jahrhundert. Die Zeit schreite innerhalb der Akte beständig fort. Den Spruch des Gralsritters Gurnemanz „Zum Raum wird hier die Zeit" nimmt Herheim offensichtlich ernst. Bezeichnend für Herheims Lust an der Symbolik ist der zweite Akt: Der Zaubergarten sieht aus wie Villa Wahnfried im Jahr 1918. Dort schmiedet Klingsor im Rocky-Horror-Look mit Strapsen und Bundesadler-Flügeln seine Pläne, während sich seine Gefolgsleute – deutlich als verwundete Soldaten zu erkennen – von Krankenschwestern und Huren pflegen lassen. Um Parsifal zu verführen, mutiert Kundry zu Marlene Dietrich. Standhaft bleibt er dennoch. DER REICHSADLER FÄLLT VON DER DECKE Als Parsifal schließlich zum Kampf gegen Klingsor antritt, werden Hakenkreuzfahnen ausgerollt. SS-Truppen marschieren und nehmen den Helden unter Dauerbeschuss. Doch Kundry wirft sich heldenhaft vor ihn, wie einst Winnetou vor Old Shatterhand, und er kann den bösen Zauber beenden. Ein riesiger Reichsadler fällt von der Decke, die Bühne ist ein Trümmerfeld – Deutschland in Schutt und Asche. Da ist aus Schlingensiefs „Hasifal" längst Herheims „Nazifal" geworden. Der Italiener Daniele Gatti, der einen insgesamt sehr pathetisch getragenen „Parsifal" mit einem teilweise leider unsicher intonierenden Orchester dirigierte, konnte auf ein durchweg brillantes Sängerensemble zurückgreifen. In der Titelpartie debütierte Christopher Ventris, gefeiert sahen sich Detlef Roth als Amfortas und Mihoko Fujimura als Kundry. |
|
Bayreuth-Eröffnung mit "Parsifal" Exorbitantes Ausstattungswelttheater am Grünen Hügel: Bei der "Parsifal"-Inszenierung von Stefan Herheim arbeiten die Bühnentechniker mehr als alle anderen, die Sänger geraten in den Hintergrund. Von Reinhard J. Brembeck
"Erlösung dem Erlöser", heißt der letzte Satz in Richard Wagners "Parsifal", sei-nem letztem und gern als schwierig und ersatzreligiös eingestuften Stück. Ein markiger Spruch, der ins Zentrum von Wagners ästhetisch-politischem Denken führt, und der schon immer für Kontroversen gesorgt hat. Stefan Herheim nimmt diesen Satz in seiner diesjährigen Bayreuther Inszenierung ganz konkret ernst. Er führt die Sucht nach Erlösung als eine typisch deutsche, im 19.Jahrhundert entstandene Sehnsucht vor. So begibt er sich auf eine mit Anspielungen, Zitaten und Zusatzhandlungen überfüllte Zeitreise, die, von Wagners auf der Bühne nachgebauter Bayreuther Villa Wahnfried ausgehend, in einer unaufhörlichen Bilderflut die Epochen der deutschen Geschichte durcheilt – bis sie im deutschen Bundestag ihr verblüffendes Erlösungsende findet. Worum geht es im "Parsifal"? Da ist ein angeblich von Gott persönlich eingesetzter Rotary-Club, der auf Menschheitshilfe verpflichtet ist und durch eine Führungskrise gelähmt wird. Zentrum des Clubs ist ein christlich verbrämtes Ritual um einen Kelch, den Gral, der den Mitgliedern die nötige Kraft fürs Gutsein verleiht. Chef Amfortas aber ist bei seinem Kampf gegens Böse zu weit gegangen, er hat die heilige Lanze eingebüßt, hat sich korrumpieren lassen und läuft bei Herheim als blutig angeschlagener Jesus-Bruder herum, im weißen Gewand und mit einer Dornenkrone, die direkt aus dem Gehirn durch die Schädeldecke nach außen wächst. Allerdings sind solch aufschlussreiche Details, derer es hier Myriaden gibt, nicht immer leicht zu erkennen. Denn Ausleuchter Ulrich Niepel hat sich das Halbdunkel und Zwielicht der jüngeren Deutschen Geschichte als Vorbild genommen. Herheim und sein umtriebig aktionistischer Theatervordenkerdramaturg Alexander Meier-Dörzenbach identifizieren nun die Gralsritterschaft mit dem gesamten deutschen Volk im späten 19. Jahrhundert. Kostümfrau Gesine Völlm muss deshalb schon zu Beginn in die Vollen greifen und Professor, Pfarrer, Studentenschaftler, Polizist, Amtsmann und höhere Tochter einkleiden, um den Wilhelminismus auferstehen zu lassen. Dabei wäre nur platter Realismus herausgekommen, wenn Völlm ihrem Personal nicht durchgehend ein Paar recht dunkler Flügel verpasst hätte. Schwarze Engel sind das, auf dem Absprung in ferne Länder, um dort zu missionieren, dort deutschen Geist zu verbreiten – eine zweifelhafte Sorte Mensch. Herheim, dieser genuine Theatermacher, träumt Wagner und Deutschland in hemmungslosen Bilderfluten. So gerät der "Parsifal" zu einem exorbitanten Ausstattungswelttheater, bei der die rückhaltlos zu bewundernden Bayreuther Bühnentechniker offensichtlich mehr arbeiten als alle anderen. Denn Heike Scheeles Bühnenbild verändert sich ständig. Da fährt ein Giebel nach oben, hier verkürzt sich eine Säule, dort weitet sich der Raum nach hinten, Spiegel zeigen dem Publikum die eigenen Gesichter, Filmsequenzen werden eingeblendet, das Bett in der Bühnenmitte verschluckt Personal, spuckt neues aus. Diese Metamorphosen sind sehr viel mehr als die Technikschau einer durchgeknallt selbstverliebten Bühnenfrau. Sie illustrieren die These, dass sich deutsche Geschichte begreifen ließe als Variationenfolge des in Villa Wahnfried ausgebrüteten Erlösungsdenkens. Doch Gott sei Dank ist Bayreuth kein Historikertreffen, sondern pralles Theater, das mit durchaus anfechtbaren, manchmal platten Gedanken immer wieder zu inspirieren, zu verstören, zu überrumpeln, zu betören versteht. So dass man zuletzt wie Zettel im "Sommernachtstraum" gar nicht mehr so genau weiß, wie das alles war – auch wenn Kraft und Sogkraft des Abends stärker nachwirken als seine Verirrungen und Wirrnisse. Bezeichnenderweise wird Herheim und sein Team mit kurzem heftigen Jubel auf der Bühne begrüßt. Dieser Bilderorgie können die Sänger kaum Paroli bieten. Zumal sich Herheim kaum dafür interessiert, plastische Einzelschicksale zu formen. Gerade im zweiten und dritten Akt lässt er sein Personal streckenweise erschreckend traditionell und einfallslos agieren. Vielleicht haben diese Vernachlässigung und die Übermacht der Bilder die Sänger so eingeschüchtert, dass kaum einer sich gegen den visuellen Overkill singend zu profilieren sucht. Denn fast immer wirken sie von der Erscheinung her prägnanter als in ihrem Gesang, der sich zudem gern ein wenig in den Bühnenbildwänden verliert. Am ehesten noch stemmt sich Kwangchul Youn als Erzähler Gurnemanz gegen dieses Verhängnis. Er versucht mit solider Phonation und oft gut verständlich das Portrait eines zutiefst in der Seele verstörten Fürstendieners, dem der Niedergang seines Hauses Usher mehr als an die Nieren geht. Seinem Herrn Amfortas verleiht Detlef Roth zumindest einmal großes, zupackendes Format – dann wenn dieser Heilsversager sich weigert, dem Heilsbringerclub weiterhin zu präsidieren. Meist aber sieht er dem wüsten Treiben auf der Bühne eher unbeteiligt zu und singt dann auch so. Die merkwürdige Unterpräsenz der Sänger begünstigt ein eigenartiges Duett zwischen den Szenenbildern und dem Orchester. Das Bayreuther Festspielhaus erinnert mit dem nicht sichtbaren Orchester sowieso an ein frühneuzeitliches Kino, und dieser Eindruck verstärkt sich in dieser Aufführung, die fast wie ein mit Orchester begleiteter Stummfilm daherkommt. Das liegt auch an Daniele Gatti, der völlig autonom agiert, keine intimere Beziehungen zu den Sängern aufbaut, und konsequent durchgearbeiteten Klang gefunden hat, den er langsam schreitend vorführt – er ist einer der langsamsten, aber durchaus nicht uninteressantesten "Parsifal"-Dirigenten in Bayreuth. Gelassen kommen die Klänge daher, die dunkel und leicht schimmern. Klarheit paart sich bei Gatti mit einer weichen Milde, die selbst heftigste Ausbrüche abfedert. Das entspricht durchaus Wagners Absichten, der im "Parsifal" die Möglichkeit einer glaubhaft heilen Welt komponiert. Das bedeutet Verzicht auf Bombast, Triumph, Behauptung, Lärm. Das meint die Hinwendung zu einfachen Formen, die ihren Reiz aus dem Fehlen eingängiger Melodien beziehen. Formen, die asketisch die Möglichkeiten der nur wenigen Motive konsequent ausschlachten und somit Brückenpfeiler sind zur Moderne. Das macht Gatti mit autochthonem Stolz klar, ohne Kraftmeierei, ohne Hintersinnelei – und wird dafür mit etlichen Buhs belohnt. Zu Beginn stirbt in der Apsis der Villa Wahnfried eine Gestalt, die Parsifals Mutter Herzeleide sein könnte. Aber auch die Verührer-Büßerin Kundry oder Amfortas. Oder sogar Richard Wagner, dessen Grab vor der Villa liegt und Zentralpunkt der Inszenierung wird. Meist steht darüber ein Bett, doch zuletzt verwandelt es sich in einen deutschen Bundesadler, in dessen blutender Wunde Parsifal ertrinkt, wie König Ludwig im Starnberger See.
Ein kleiner Junge, Parsifal im Matrosenanzug, erlebt in dieser Todesnacht die deutsche Geschichte, für die er als Erlöser ausersehen ist. Erst ist er ein großer Raufbold im Matrosenkostüm, der die Not der Deutschen und seiner Führer nicht begreift. Da steht dann Amfortas, hoch über den Kopf erhoben einen kitschig rot leuchtenden Kelch, doch keine hehren Gralsritter sendet er aus, sondern deutsche Soldaten in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Der zweite Akt führt zu Möchtegerngralsritter Klingsor, der es mit Thomas Jesatko - Anzug oben, Strapse unten, und recht ungefährlich vokalisierend - allenfalls zum RTL-Unterhalter bringt. Kaum dass der Vorhang aufgeht, beginnt das Bühnenbild schon wieder eine seiner Mutationen, verwandelt sich in Versail-les Schlossaal, in dem Lazarettbetten mit deutschen Helden stehen, die mit Krankenschwestern und Showstarlets züchtig Sex üben. Vermutlich aber taugt die Weimarer Unterhaltungsmaschinerie zwischen den beiden Weltkriegen nur bedingt als Pendant zu Klingsors generalbösem Zauberreich. Erst recht, wenn sie so wenig Sex Appeal besitzt wie in Bayreuth. Das gilt nun auch für Dirigent Gatti, der seinen für die beiden Außenakte ge-wählten Stil der dezenten Klangveredelung auch hier durchsetzt und auf jede jetzt durchaus angebrachte, keuchende Exaltation verzichtet. Das gilt aber auch für die Kundry der Mihoko Fujimura, die als Blauer Engel erscheint, plötzlich seltsam verinnerlicht sowie recht unbeteiligt singt und dabei das Bett mit Parsifal eher umschleicht als erotisch bestürmt. Solch eine Frau von der Bettkante zu stoßen, muss jedem Mann leicht fallen, und so klingt der bis dahin eher zuverlässige Christopher Ventris nach dem erleuchtenden Kuss tatsächlich befreit und aufgeklärt. Was es allerdings mit Wagners seltsamen Frauenbild und noch seltsameren Verhälnis zum Sex auf sich hat, das erklären weder der Regisseur noch die Musiker. Entsetztes Raunen im Raum, als Hakenkreuzfahnen aufgezogen werden und die SS einmarschiert. Endlich erscheint auch der kleine Bub des ersten Akts wieder, dessen Schicksal Herheim ansonsten nicht mehr interessiert. Der Kleine fährt, man denkt an Hitler, aus Richard Wagners Grab nach oben und wirft die heilige Lanze nach Parsifal. Dass der dabei angewandte Trick genauso sichtbar wird, wie derjenige beim gedoubelten Sprung Parsifals von der Apisibalustrade, gehört zu den erheiternden Pannen dieses Abends. Dass Parsifal nun mit diesem hell leuchtenden Speer den gesamten Nazispuk zusammenkrachen lässt, gehört dagegen in die Kategorie naiven Wunschden-kens. Zumal nach diesem ultimativ altruistischen Tun gar nicht mehr einzusehen ist, warum dieser tolle Heilsmann am Ende verschwinden soll. Aber zuvor quält sich der dritte Akt durch die Ruinen nach dem Zweiten Weltkrieg. Trümmerfrauen treten zum Karfreitagszauber auf, ansonsten aber gibt Kwangchul Youns sängerisch wie szenisch auf Sinn und Stringenz bedachte Gurnemanz seine Erklärungen ab – er könnte es in jeder traditionellen Inszenierung ganz genauso tun.
Amfortas ist mittlerweile deutscher Bundeskanzler, und jeder im Saal würde wohl gerne wissen, ob sich die anwesende derzeitige Bundeskanzlerin manchmal genauso gebeutelt fühlt wie dieser aus seinem Dornenkronenkranz blutende Anzugsträger. Schnell macht Parsifal dem parlamentarischen Debakel ein Ende. Unüberhörbar hat sich Ventris vor allem auf seinen Finalmonolog vorbereitet, aber auch hier trifft er mit seiner nie stetig fließenden Stimme nicht so ganz den Ton des sanft gewaltfreien Gurus mit Allmachtsanspruch. Parsifals finales Verschwinden ist weder durch Stück noch Regie so recht zu erklären. Und doch macht es Sinn. Herrheim inszeniert da die Sehnsucht nach einer Welt, die solche allmächtigen und deshalb utopischen Erlösergestalten gar nicht mehr nötig hat. Wenn zuletzt am Bühnenprospekt statt der bis dahin überdimensionalen Wappen- und Flaggenadler ein kleiner Vogel hell aus sich heraus zu leuchten beginnt, dann scheint der in Naivitäten verliebte Regisseur seinem Publikum zuzurufen: "Deutsche, seid realistischer, versucht nicht immer gleich alle Probleme der Menschheit zu lösen. Backt kleinere Brötchen, hier wie am Hindukusch." Wagner hat das kürzer, provokanter und poetischer ausgedrückt: Erlösung dem Erlöser. |
|
Wir sind Gral von Markus Thiel
Bayreuth - Knappertsbusch wäre selig gewesen. Nur unter einer Bedingung wollte er, der Gralshüter des Bayreuther Dirigierpults, seinerzeit zurück in den Graben: ohne finale Heilig-Geist-Taube kein „Parsifal". Wieland Wagner zeigte den Vogel zähneknirschend, doch allein sichtbar für den traditionalistischen „Kna".Und Anno 2008? Erstrahlt das Tier gleißend am Bühnenportal, erhellt das Haus, auf dass sich die Premieren-Gemeinde im riesigen runden Spiegel, der sich auf die Szene gesenkt hat, erblickt. Der Spiegel wird zur langsam rotierenden Weltkugel, schickt Strahlen ins Parkett, während die Chöre vom „höchsten Heiles Wunder" künden. Und noch ehe der Schlussakkord verklingt, platzt der Jubel los und wird nach Schnäuztüchern gekramt. Wir sind Gral: Ist es das also, das Bayreuther „Parsifal"-Wunder? Fast alle hat er sie herumgekriegt. Und das, obwohl Regisseur Stefan Herheim ja der Ruf des Berserkers vorauseilt. In Salzburg etwa musste er Mozarts „Entführung" auf Intendantenbefehl nachbessern - das Infarktrisiko im Publikum schien zu hoch. Zum Start der Bayreuther Festspiele bietet der Norweger nun „Parsifal" mit allem. Mit Vorgeschichte, mit Zeitgeschichte, mit Religionsgeschichte, mit Inszenierungsgeschichte. Und natürlich: mit Bayreuther Geschichte. Wahnfried ist der mythische und doch so reale Spielort dieses „Weihfestspiels". Zwischen Richards Grab, das über den Bühnenrand in den Graben ragt und den Gralskelch beheimatet, und einem Bett, auf dem Mutter- und allerlei andere Komplexe ausgelebt werden, sowie dem kreisrunden Brunnen entwickeln sich diese knapp fünf Musikstunden. Fünf, weil Daniele Gatti einen der langsamsten „Parsifals" der Festspielgeschichte dirigiert. Mit lähmenden Tempi schleppt sich die Interpretation dahin. Anfangs unterlaufen dem weltweit erfahrensten Wagner-Orchester sogar Unschärfen. Die Bläser bringen mit Mühe und Piano-Tricks ihre Phrasen über die Runden, die (wie immer famosen) Chöre treiben ständig an, doch Gattis Deutung tritt selbstverliebt und profilarm auf der Stelle. Was andernorts und ohne Schalldeckel besser funktionieren mag, diese entspannt-druckfreie, nie schwitzende Lesart, kann sich im Festspielhaus nicht entfalten. Zumal „Parsifal" eben auch ein Konversationsstück bleibt: Wenn Gurnemanz mehrfach nachatmen muss, um einen Satz zu Ende zu bringen, wird der Sänger zur Vokalbeilage. Immerhin werden alle kaum zum Forcieren gezwungen. Wie sich dieser „Parsifal" überhaupt durch schlanke, durchwegs kultiviert geführte Stimmen auszeichnet: Kwangchul Youn, als Gurnemanz ganz typengerecht gezeigt als höflicher Butler, singt mit schönem, dezentem Raufaser-Bass. Mihoko Fujimura gibt eine kühle, sehr dunkel gefärbte und in den Höhen verknappte Kundry abseits des Salonschlangen-Klischees. Auch Christopher Ventris (Parsifal) verlässt sich auf die lyrischen Qualitäten seines hellen, offenen Tenors: ein sympathischer, zurückhaltender Held, in dessen Singen sich stets ein zärtlicher Beiklang mischt. Thomas Jesatko wiederum bietet eine plastische, nie zu grelle Klingsor-Studie - und die genaueste Diktion des Abends. Gattis Leerstellen-Dirigat setzt Herheim szenische (Über-)Fülle entgegen. Beginnend beim Vorspiel, in dem die sterbende Herzeleide und damit Parsifals Muttertrauma gezeigt wird, fächert sich die Regie vieldimensional auf. Herheim beginnt im Wilhelminismus, lässt zur Gralszeremonie Landser des Ersten Weltkriegs aufmarschieren, siedelt den zweiten Akt im Lazarett an, in dem der bestrapste Klingsor und Kundry als Marlene-Dietrich-Zitate erscheinen, und schreitet voran ins Neu-Bayreuth der 50er. Immer wieder auch tauchen Anspielungen auf Grüner-Hügel-Inszenierungen auf. Am deutlichsten im Gralstempel der Uraufführung, dezenter in der „Bayreuther Scheibe" und im Finalbild des Bundestags, der an Wieland Wagners „Meistersinger" erinnert. Doch im Fortgang der Zeitläufte gibt es Kontinuitäten. Die Engelsflügel etwa, die den Figuren eine poetische Aura verleihen. Auch die messianische Figur des Amfortas, der von Detlef Roth mit starker expressiver Prägnanz gestaltet wird. Der Matrosenanzug des Titelhelden, der in mehrfacher Gestalt - als Kind und reifer Held - auftritt. Oder das Tier überm Portal: anfangs ein Schwan, dann Reichsadler, später Nazi-Vogel, der krachend zu Boden stürzt. „Warum?", das wäre die falsche Frage in Herheims Inszenierung. Denn der arbeitet weniger mit eindeutigen Kausalzusammenhängen, sondern assoziativ. Ein Alleserklärer, Allesberücksichtiger, der mit der Erlösung und anderen Themen, Träumen und Traumata spielt, sie mitschwingen lässt, anstatt sie auszuführen. Am stärksten im Vorspiel und im ersten Akt, am faszinierendsten im dritten Aufzug. Aber fünf Stunden, das scheint für Herheims Zeitreise in den phänomenalen Bühnenbildern von Heike Scheele und den kongenialen Kostümen von Gesine Völlm doch zu wenig: Das „Dritte Reich" wird mit Hakenkreuzfahnen schnell abgehakt, erschöpft sich im hastigen, platten Realismus. Und irgendwann passiert das, was jeder Fotograf kennt: zu viele (thematische) Überblendungen - das Bild wird unscharf. Dass die Aufführung dennoch eindrücklich ist, dass sie fast Buh-frei gefeiert wird, liegt nicht nur am dritten Akt, bei dem Deutschlands „Stunde null" und das Tasten in die neue Zeit unter dem Bundesadler bestens mit Gestus und Inhalt des Stücks harmonieren. Es liegt auch an Herheims Stil, der trotz aller Querverweise nie dramaturgisch dürr wird. Dieser „Parsifal" ist ein unerhört theatrales und sinnliches, intelligentes und oft sehr berührendes Ereignis. Eine Inszenierung, modern und zugleich verführerisch, die Orthodoxe oder Regietheaterjünger zusammenführt. Nicht nur um Erlösung kreist daher diese Aufführung, sondern auch um Versöhnung. „Parsifal" mit allem - und für alle. |
|
Bayreuther Geschichts-Erlebnispark Marlene Dietrich war doch in der Partei, lautet die verstörendste Neuigkeit vom Grünen Hügel. Zur Verführung Parsifals erscheint sie als wasserstoffblondierter blauer Engel in Frack und Zylinder.
Der reine Tor bleibt standhaft, und so ruft sie die SS, um seinen Widerstand zu brechen. Blutrote Hakenkreuzfahnen werden aufgezogen, und weil in jedermann ein Nazi steckt, bedroht Parsifal als Hitlerjunge sein erwachsenes Alter Ego mit dem heiligen Speer, während der bestrapste Klingsor auf dem Balkon der Wagner-Villa Wahnfried mit der gleichen Waffe herumfuchtelt. Solcher Nazigrusel wirkt immer und posaunt Bayreuths neue Liberalität in die weite Welt hinaus. Stefan Herheim hat die kritische Wagner-Literatur von Adorno über Bermbach oder Carr bis zu Zelinsky hineingefressen und weitgehend unverdaut der Bühne übergeben. Innere Logik stiftet allein die unerbittliche Achse der Zeit. Weil nach dem letzten Liebesmahl die feldgrauen Gralsritter in den Ersten Weltkrieg ziehen und die Stahlgewitter in Klingsors Lazarett-Alptraum wiederkehren, ist am Ende des zweiten Akts der nächste deutsche Untergang einfach fällig. Eine platte Geschichtsstunde Die Inszenierung des 38-jährigen Norwegers behauptet viel und begründet wenig. Über Bayreuths Folgen für die deutsche Misere lassen sich kluge Bücher schreiben. Auf die Bühne aber wird fuchtelndes Thesentheater daraus, dessen historische Bilderflut unweigerlich an Katharina Wagners Münchner „Waffenschmied" erinnert. Technisch ist die Aufführung noch aufwendiger als Christoph Schlingensiefs vorzeitig abgesetzter „Hasifal". Manches bleibt ebenso unverständlich, aber während der Aktionskünstler auf den Spuren von Joseph Beuys der Kunstreligion von Wagners Bühnenweihfestspiel nachspürte und den Zuschauer mit postmodern-mehrdeutigen Rätseln konfrontierte, kommt Herheims Geschichtsstunde platter daher: Statt Schlingensiefs Voodoo-Umwegen stellt er lieber gleich Richard Wagners efeuumranktes Grab auf die Vorbühne. Das mit kinematografischer Effizienz wie am Schnürchen heruntergespulte Verhängnis beginnt noch während des Vorspiels in der Apsis von Wahnfried. Als erste Lesefrucht kommt der von Wagner vorweggenommene Ödipus-Komplex an die Reihe: Parsifal träumt sich ins Bett seiner eben verstorbenen Mutter Herzeleide. In einer technisch brillanten Verwandlung wächst Heike Scheeles Bühnenbild dabei ins Riesenhafte. Später finden wir uns im Garten der Wagner-Villa wieder, die mit dem Gralstempel aus der Uraufführung von 1882 überblendet wird, während Amfortas den heiligen Kelch aus dem Grab des Meisters herkramt. Keine Assoziation bleibt in dieser Bild- und Tonshow zur deutschen Geschichte im Spiegel Bayreuths ungezeigt: Die Ritter opfern Parsifal, der im mütterlichen Bett einen Akt später auch von Klingsor vernascht wird. Gurnemanz' Erzählung veranschaulicht ein Speerkampf zwischen Amfortas und dem bösen Zauberer, im zweiten Akt erscheint der als Doppelgänger Herzeleides gedeutete Gralskönig auf Stichwort, wenn sich Parsifal an den Gralsritus erinnert. Auch sonst hält der Regisseur das Publikum für begriffsstutzig: Wenn der Held im Matrosenanzug seine „Knabentaten" erwähnt, stößt er ebenso überdeutlich ein Schaukelpferd um, wie bei jeder Erwähnung von Wasser ein Video plätschert. Die Bitte von 1951 Vor lauter Bildern blieb Herheim keine Zeit für Personenregie: Fußwaschung, Salbung und Taufe erinnern an Wolfgang Wagners unfreiwillige Komik, nur dass damals beim Karfreitagszauber keine Trümmerfrauen über die Bühne schlurften. Zur Verwandlungsmusik wird die Bitte von 1951 projiziert, auf dem Grünen Hügel von politischen Debatten Abstand nehmen zu wollen. Amfortas hält noch eine Leichenrede im Bundestag, bevor Parsifal im Herz der fetten Henne verschwindet und der deutsche Sonderweg vom Segen der Globalisierung erlöst wird. Das Herz der kritischen Wagnerianer jubelte: Herheim bekam weniger Buhs als Dirigent Daniele Gatti, der Langsamkeit mit Boulez'scher Leichtigkeit und klangschöner Streicherkultur versöhnte. Der zweite Akt wirkte stark heruntergekühlt. Von ein paar stumpfen Stellen in den Verwandlungsmusiken abgesehen, kam der Bayreuth-Debütant mit der heiklen Akustik gut zurecht. Gesungen wurde besser als in der Premiere der Schlingensief-Inszenierung von 2004, was noch nicht viel bedeutet: Kwanchoul Youn (Gurnemanz) präsentierte üppiges Bass-Material mit wenig Ausdruck. MihokoFujumuras trockene Kundry entsprach dem eckigen Parsifal Christopher Ventris, der nur bei den Amfortas-Rufen und im Finale richtig aufdrehte. Der helle, tenoral-schneidende Bariton Detlef Roths (Amfortas) passte zum Schmerzensmann der Inszenierung, könnte aber gestalterisch zulegen. Singen und die Musik ist aber das letzte, worauf es im Geschichtserlebnispark Bayreuth ankäme. Und, ach ja, der böse Bube Schlingensief wird in den Pausengesprächen schon verklärt. Robert Braunmüller |
|
BAYREUTH Stefan Herheim inszeniert den „Parsifal" als konsensfähiges PsychodramaDer Held ist ein Familienmensch Von Holger Noltze In der Mitte steht ein Bett. Man kann es schon sehen, während Daniele Gatti diesen neuen Bayreuther „Parsifal" sehr langsam, sehr subtil beginnen lässt. Der Ort könnte der Salon der Wagnervilla Wahnfried sein. Im Bett stirbt eine Frau mit langen blonden Haaren, ein kleiner Junge mit Matrosenanzug bemerkt es kaum, bald läuft er hinaus in die weite Welt. Herzeleide stirbt, der kleine Parsifal hat noch einen weiten Weg vor sich bis zum Erlöseramt als Gralskönig. Ein bisschen auch wie die greise Cosima wird sie aufgebahrt in diesem Gralstempel der Wagner-Welt, aber wer immer stirbt an diesem langen Abend, kann jederzeit wiedergeboren werden: Als Familiendrama beginnt Stefan Herheims „Parsifal"-Inszenierung, gesehen aus der Perspektive eines geängstigten Kindes. Mal geht der Blick in den Wahnfried-Garten, mal vom Garten ins Haus. Hier baut Klein-Parsifal aus Steinen eine kleine Gralsburg, etwa an der Stelle, wo im wirklichen Wahnfried die große Granitplatte das Wagner-Grab deckt. Da sich die Welt inzwischen mehr für den „Wagner-Clan" interessiert als für die Wagneropern, liegt es nahe, auch die Gralsgeschichte bei Wagners spielen zu lassen. Als magischen Illusionsraum hat Heike Scheele die Bühne gebaut, der Salon kann wachsen bis zum Gralstempelbild der Uraufführung, und so wie die räumlichen Koordinaten wundersam verschoben werden können, so traumhaft frei geht Herheim auch mit der Chronologie um. Das ist konsequent bei einem Stück, in dem wenig „passiert", aber viel davon erzählt wird, was einmal war. Wie Parsifal seine Mutter verließ, wie Amfortas den heiligen Speer in Klingsors Zauberreich verlor, wie Titurel den Gral empfangen hatte: Immer tiefer geht es in die ferne Vergangenheit, bis zu Kundrys Begegnung mit dem Erlöser Christus. Diese Geschichte ist eine Abfolge von Verwundungen und Traumata. Herheim inszeniert sie als konzentriertes Psychodrama. Auf dieser Ebene und im ersten Akt zeigt der norwegische Regisseur, wie genau er Abläufe aus der Musik zu entwickeln versteht. Herheim ist ein intelligenter Bilderfinder. Er will aber auch Historienmaler sein. So zeigt er die Gralsritterschaft von Wahnfried als buntes Abbild der deutschen Gesellschaft im Kaiserreich. Deren kollektive Sehnsüchte nach Erlösung erfahren ein böses Erwachen im Weltkriegshorror.
muss sich der Blumenmädchen erwehren. FOTO: BAYREUTHER FESTSPIELE/NAWRATH Als am Ende des ersten Akts in den Krieg gezogen wird, kann man schon ahnen, wie das weitergeht. Im zweiten Teil, Klingsors Zauberreich, werden folgerichtig Hakenkreuzfahnen gehisst. Und weil Hitler immer funktioniert, gibt es hier auch das einzige Buh des Abends. Am Ende liegt Wahnfried in Trümmern, also ziehen Trümmerfrauen durchs Bild, während Groß-Parsifal den heiligen Speer zurückbringt und zum Erlöser gesalbt wird. Doch es wird noch mal umgezogen, jetzt in den deutschen Bundestag. Mit einer Geste des heiligen Speers beendet Superpräsident Parsifal alles parlamentarische Gezänk. Verschwindet im Boden, dazu senkt sich ein großer Spiegel und lässt das Bayreuther Publikum sich selbst erkennen. Man kann es sinnreich finden, dass hier am Eröffnungsabend die tatsächliche politische Prominenz ins Bild rückt. Merkwürdig aber gerät das Ende: Vor dem Gralsburg-Steinhaufen stehen Ritter Gurnemanz und Frau Kundry, mit Klein-Parsifal stellt man sich, alles politische „Gedöns" hinter sich lassend, zum Gruppenbild der Kleinfamilie auf. Ganz oben leuchtet, während der famose Chor „Erlösung dem Erlöser" singt, die Gralstaube. Maestro Gatti unternimmt mit dem Orchester die letzten Dehnübungen des Abends. Vorhang, donnernde Zustimmung vor allem für die Regie. Konsensfähig auch die musikalische Seite: Gatti zaubert stimmlich allerhand Betörendes hervor, bleibt aber auch liebreizend, wo es entschieden dramatische Akzente braucht. Mihoko Fujimura, mit eindrucksvoller Tiefe, manchmal scharfen Höhen, lässt für eine Kundry noch etwas sinnliche Präsenz vermissen. Christopher Ventris setzt seine vor allem lyrischen Qualitäten als Parsifal klug ein. Prächtig, dabei wunderbar wortverständlich der Gurnemanz von Kwangchul Youn. |
|
Bayreuther Festspiele eröffnen spektakulär mit Parsifal Bayreuth macht munter weiter bei der Entmythologisierung des "Parsifal", seines heiligsten Stücks. Nachdem Christoph Schlingensief vier Jahre lang mit seinem wild wuchernden Bilderkosmos eines multireligiösen Todesrituals die Abstraktions-Erstarrungen der alten Wolfgang-Wagner-Inszenierung aus dem Festspielhaus vertrieben hatte, lädt Stefan Herheim zur kollektiven Psychotherapie. Thomas Heinold Der "Regisseur des Jahres", 38 Jahre jung und gebürtiger Norweger, kennt die gegenseitigen Durchdringungen von Religion, Kunst und nationalen Mythen: In Essen hat er Mozarts "Don Giovanni" mit der katholischen Liturgie verschmolzen, in Bayreuth nun machte er zur Eröffnung der 97. Festspiele am Freitag die Villa Wahnfried zum Traumraum und Spiegelkabinett für Parsifal-Kult und Erlöser-Suche in der deutschen Nationalgeschichte. Der Ankerpunkt seiner Deutung ist das bebilderte Vorspiel: Parsifal erlebt im großen Saal des repräsentativen Anwesens, in dem Richard Wagner und seine Nachkommen viele Jahre lebten, als kleines Kind den Tod seiner Mutter mit. Diese traumatische Erinnerung vergräbt er im zur Grabplatte verbreiterten Soufflierkasten - sein persönlicher Gral befindet sich damit symbolisch an jener Stelle, wo im Garten der realen Villa Richard und Cosima Wagner beerdigt sind. Danach gibt er sich im Traum der inzestuösen Umarmung mit seiner toten Mutter hin - was zum Auslöser eines tiefen Schuldgefühls und einer fieberhaften Suche nach Mutter- und Erlöserfiguren wird. Deutsche Nationalgeschichte und Parsifals Reifung sieht Herheim als Parallelen: Im ersten Akt gelingen ihm bedrückend-betörende Phantasmagorien des späten Kaiserreichs. Im düsteren Prunk Wahnfrieds und der feinen Bayreuther Gesellschaft wuchern kindliche Ängste und Wünsche. Kundry, die einzige, vielfach gebrochene Frauenfigur dieser Oper, prägt als Amme und Bedienstete Parsifals kindlich-erotische Sehnsüchte. Gurnemanz ist ein distanzierter Hauslehrer, seine Erzählungen vom Leiden des Amfortas, den Herheim zur Jesusfigur mit Dornenkrone stilisiert, lösen beim kleinen Parsifal alptraumhafte Identifikationen aus: Alle Figuren werden zu geflügelten, engelartigen Wesen; der Wundschmerz des Amfortas ist Parsifal gerade groß genug für seinen Mutter-Schmerz. Herheim gelingt hier sehr bildstarkes, sinnliches Theater. Man erspürt förmlich das Milieu aus bürgerlicher Doppelmoral, verschwiegenen Schmerzen und Ängsten, in denen ein Werk wie "Parsifal" zur Sumpfblüte jener nationalen Erlösungssuche wurde, die auf dem politischen Parkett mit Radikalisierung und Krieg einherging: Beim Gralsritual holen sich die Soldaten die letzte Stärkung, bevor sie in die Schlachten des Ersten Weltkriegs ziehen. Immer wieder beweist Herheim seine Meisterschaft im Arrangieren mehrdeutiger, sich spiegelnder Personenkonstellationen. Nicht möglich wäre das ohne Heike Scheeles furiosem Bühnenentwurf eines sich stetig verändernden, die Technik auf das Äußerste fordernden Kunstraums, der Elemente der Villa Wahnfried, des Festspielhauses und eines Gralstempels verschmilzt. Im zweiten Akt treibt Parsifal durch die Wirren der Pubertät, Wahnfried wird zum Lazarett, in dem die Revuegirls der Wilden 20er Jahre den verwundeten Soldaten letzte feuchte Träume bescheren. Herheims Bildfindungen werden schriller, greller, plakativer, die These der Parallelität von Parsifals Entwicklung und der Nationalgeschichte beginnt zu ächzen.Wenn Parsifal von der Wahnfried-Veranda ins erotische Vergnügen springt, hat der Nürnberger Stuntman Matthias Schendel seinen kurzen Auftritt, spektakulärer ist aber Kundrys Verführungsversuch als Blauer Engel à la Marlene Dietrich. Doch wo die Lust erwacht, wird auch das alte Schuldgefühl in Parsifal reaktiviert: Klingsor tritt als Ungeist auf, das Böse trägt erst Strapse und bald darauf SS-Schwarz, vor Wahnfried flattern Hakenkreuze, dann zerspringt Klingsors Zauberreich der sündigen Allmachtsfantasien unter den Bomben des Zweiten Weltkriegs. Damit hat auch Herheim sein bestes Pulver verschossen: Im dritten Akt ragen die Trümmer des zerbombten Wahnfried in das kitschig romantisierte Idyll wolkenumwaberter Ruinenreste, während die Brüder Wieland und Wolfgang Wagner bei den ersten Nachkriegsfestspielen die Erinnerung an Bayreuths braune Zeiten hinter einer Mauer des Vergessens verschließen. Dass die Gralsritter brave Bonner Parlamentarier geworden sind und die Demokratie auch Amfortas, Parsifals und Kundrys Seelenwunden zu heilen mag, ist eine zu steile These Herheims. Dass er dem Bayreuther Festspielpublikum von heute zwecks Selbsterkenntnis einen riesigen Spiegel vorhält, der dann auch noch zur Discokugel zeitgeistigen Event-Verlangens mutiert, lässt einen sehr bildstarken und über weite Strecken gelungenen Regieentwurf dann doch ein wenig vage enden - nach dem Motto: "Der Vorhang zu und alle Fragen offen." Beantwortet wurden jedoch einige andere Fragen: Der italienische Dirigent Daniele Gatti konnte bei seinem Bayreuth-Debüt noch nicht überzeugen. Langsame Tempi und ein gerade im ersten Akt oft wenig markanter Klang brachten die musikalische Struktur dieses "Parsifals" des öfteren ins Wanken. Das Finale war dann, einschließlich der bis dahin sicher agierenden Chöre, so sehr verwackelt, dass es keine Freude mehr war. Verneint werden muss die Frage nach großen sängerischen Entdeckungen: Mihoko Fujumura schlug sich als Kundry wacker, klang in den hohen Lagen aber zu scharf; Kwangchul Youn verfügt als neuer Gurnemanz zwar über ein breites stimmliches Fundament, könnte aber die langen erzählenden Passagen noch lebendiger gestalten. Erfreuliche Leistungen zeigten Detlef Roth als Amfortas und Thomas Jesatko als Klingsor. Christopher Ventris verfügt mit seinem Tenor über sehr gutes Potenzial, agierte für die vielfältigen Anforderungen der Titelpartie aber noch zu unausgewogen. Zum Schluss litt Ventris, wie die Inzsenierung und die musikalische Gestaltung insgesamt, unter Konditionsschwächen. Das Publikum begrüßte diesen reflexionsfreudigen "Parsifal" mit Euphorie. Die Buhrufer des ersten und zweiten Akts waren beim Schlussapplaus verstummt. Der Wunsch nach Neuem am Grünen Hügel ist spürbar, Stefan Herheim konnte ihn zumindest ein gutes Stück weit erfüllen.
|
|
Todgeweihte auf dem Weg in die Katastrophe Jens Voskamp BAYREUTH - Aufatmen im Bayreuther Festspielhaus: Seit Claus Guths Einrichtung des "Fliegenden Holländers" ist keine Inszenierung mehr so gefeiert worden wie die bilddichte Adaption des "Parsifal" durch den Norweger Stefan Herheim. Er deutet die jüngere deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis zu den frühen Wirtschaftswunder-Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg anhand des wechselvollen Schicksals der "Villa Wahnfried", dem Stammsitz des Wagner-Clans. Gegen den Willen Richard Wagners, seine Vorspiele zu bebildern, öffnet sich der "Wahnfried"-Salon bereits mit den ersten Kreuzschlägen des der Dresdner Liturgie "entliehenen" Amen-Motivs, das bis zum "Karfreitagszauber" oft wiederholt durch das Bühnenweihfestspiel wabert. Denn Herheim hat viel, fast zu viel zu erzählen: Seine beflügelten Erdenbewohner sind Todgeweihte, deren Biografien automatisch in die Katastrophe zweier Weltkriege münden. Exkurs über Bußfertigkeit Dazu thematisiert er die pseudo-religiöse Stimmung des Erlösungsdramas als immerwährende musizierende Eucharistie, problematisiert die komplexen Schuldgefühle vom sterbenden Gralskönig Amfortas und der zwischen Himmel und Hölle irrenden Botin Kundry bis zum Kindheitskomplex des Titelhelden. Dazu ein Schuss Über-Sexualisierung, ein Exkurs über Bußfertigkeit und im - leider allzu kitschig geratenen Schlussbild im alten Bonner Bundestag - ein Abgesang auf die zerbrechliche Pflanze Demokratie. Das ist starker Tobak, evoziert aber mehr Deutebilder als die vollgeramschte Drehbühne bei Christoph Schlingensief, der mehr morbide Kunstphilosophie zeigte, als dass er die Mitleids-Thematik im "Parsifal" wirklich aufgriff. Dieser Weg zur szenischen Realistik, den Bühnenbildnerin Heike Scheele detailreich auslebt, spricht für die Regie Herheims. Ob man die Mutation des Brandenburger Adlers über einen Schwan zum Reichsadler, Nazi-Emblem und Bundeswappen in eine Taube (Sinnbild des Heiligen Geistes) für nachvollziehbar oder allzu willkürlich hält. Ob es die Ambivalenz ist, mit der Parsifals Mutter Herzeleide, Amfortas, Kundry und am Schluss auch Parsifal die gleiche nazarenerhafte Robe und Haartracht tragen. Oder ob der Regisseur die Gralsritter-Sippe als exklusiv ausgerichtetes, alles Unkonventionelle als Bedrohung empfindendes Bürgertum entlarvt: Herheim hält dem Betrachter den Spiegel vor. Und das ganz wörtlich. Mehrmals leuchtet er in den Zuschauerraum, macht via Riesenspiegel die Festspielgemeinde zum Akteur. Ein bequemes Zurücklehnen, ein Schwelgen in der Sakralität von Richard Wagners problematischer Kunstreligiösität kann es damit nicht geben. Wagner ist eben immer vor den allzu gläubigen Wagnerianern zu schützen. Da verzeiht man gerne die Vielzahl der Verwandlungen in den beiden ersten Akten. Auch die überflüssigen szenischen Verdoppelungen, etwa wenn Gurnemanz Parsifal vom Ur-Konflikt, der Feindschaft zwischen dem pietistischen Grals-Gründer Titurel und dem lustbetonten Gegenprinzip Klingsors berichtet. Da dürfen Titurel (Diógenes Randes) und Klingsor (Oben Frack, unten Strapse: Thomas Jesatko) den Kampf um Christi Abendmahlskelch und die Lanze, die ihm die Kreuzeswunden schlug, zum verbalen Bericht pantomimisch nachstellen. Bei Klingsors Zaubermädchen sind Herheims Geschichtslektionen in den frühen Zwanzigern angelangt. Sie, die die Lende des Naivlings Parsifal in Wallung bringen sollen, sind Rotkreuzschwestern, die sich im Lazarett um traumatisierte Verwundete kümmern, oder Revuegirls in Flitterglanz. Hier schlägt die Sekunde des Fürther Stuntman Matthias Schendel, der vom Wahnfried-Balkon in die versammelte Weiblichkeit plumpsen darf. Wie kaum eine andere Familie waren die Wahnfried-Bewohner mit der Hitlerei verbandelt. Und so ziehen am Ende des 2. Akts Hakenkreuzflaggen auf, patrouilliert eine Ledermantel-Soldateska. Aber das wirkt in der Kürze doch operettenhaft grotesk, deutet schuldhafte Verstrickung an, wirkt aber doch zu harmlos. Gesungen wird auf hohem Niveau, was vor allem auf Christopher Ventris in der Titelpartie, Kwangchul Youns wortgezeugten, gar nicht salbadernden Gurnemanz und Detlef Roth als Dauerverwundeten Amfortas zutrifft. Mihoko Fujimura kompensiert als verfluchte Botin Kundry darstellerisch manches, was ihre Stimme vor allem in der Höhe schuldig bleibt. Wieder lohnen die Chöre einen Aufführungsbesuch (Einstudierung: Eberhard Friedrich). Provozierende Frage Bayreuth-Debütant Daniele Gatti, erst der fünfte Italiener am Festspiel-Pult, machte es den Sängern nicht leicht. Er entwickelte mit dem Festspiel-Orchester sehr viel Sinn für die zelebrale Stimmung der Partitur, dehnte aber die Tempi nicht selten über die Schmerzgrenze hinaus. Von einzelnen Buhs abgesehen, verdächtig einmütige Zustimmung im Festspielhaus. Herheim, der Mann der Zukunft und 2007 zum "Regisseur des Jahres" gekürt, hat in Bayreuth zweifellos eine seiner besseren Arbeiten abgeliefert. "Weißt Du, was Du sah’st?" raunt Gurnemanz dem ahnungslosen Parsifal einmal zu. Ja, einen anregenden, weit gespannten Bilderbogen, der nicht zu Unrecht fragt, ob der Adler auf der D-Mark nicht der Ersatz-Fetisch für das Hakenkreuz wurde... Solche Fragen darf, muss, soll Kunst thematisieren. Wie meinte schon Ahnvater Richard? "Hier gilt’s der Kunst!" |
|
Wir sind Gralsritter Von Volker Milch
BAYREUTH "Sehr langsam" wünscht sich Richard Wagner immer wieder in seiner "Parsifal"-Partitur, "schwer", "noch einmal so langsam" oder gar "immer feierlich": Das 1882 in Bayreuth uraufgeführte Werk ist auch eine auskomponierte Geduldsprobe, ein pseudosakrales Adagio-Exerzitium, das nicht nur von den Interpreten, sondern auch vom Publikum einen langen Atem fordert. Da können gut sechseinhalb Stunden Aufführungsdauer bis zum erlösenden Weizenbier ganz schön lange werden. Vor allem, wenn die Gralsritter so gravitätisch schreiten wie in den früheren Inszenierungen des nun scheidenden Hausherrn Wolfgang Wagner. Schlimmstenfalls ist "Parsifal" die ideale Oper zum Abgewöhnen, wobei der rechte Wagnerianer beim Stichwort "Oper" aufschreien müsste wie in der frommen Handlung die gequälte, zur Verführung abgerichtete Kundry: Ein Bühnenweihfestspiel ist´s ja, das Richard ganz bewusst dem profanen Opern-Alltag entgegensetzen und für sein Festspielhaus reservieren wollte. Vielleicht ist das keusche Werk ja auch eine Kompensation oder Bußübung, weil der Meister es selbst mit den ehelichen Reinheitsgeboten nicht so genau nahm und gerade für die junge Judith Gautier entbrannt war. Muss seine Gemeinde also deshalb seit 1882 kollektive Buße tun, bei gefühlten 40 Grad im Festspielhaus schmachten? Urdeutsche Zeitreise Dieses Schmachten war allerdings trotz Daniele Gattis gedehnter, allerlei Steigerungsformen für "langsam" findender Tempi selten so kurzweilig wie nun in Stefan Herheims Neuinszenierung, die nach nur vier Jahren Christoph Schlingensiefs verwesenden Hasen (im Bayreuth-Slang kursierte seine Interpretation auch schon als "Hasifal") abgelöst hat. Herheim erzählt Wagners letzte Erlösungsgeschichte als urdeutsche Zeitreise aus dem Uraufführungs-Jahr 1882 bis in die Jahre der Bonner Republik. Sein Handlungs-Ort ist ein Kristallisationspunkt deutschen (Un-)Wesens: Die Wagner-Villa "Wahnfried" nebst Garten und Wagner-Grab, und der letzte Aufzug rückt dann die Erlösungsgeschichte in die Distanz eines Theaters auf dem Theater. Die Bühne des Festspielhauses höchstselbst erscheint auf der Bühne des Festspielhauses, während das Publikum mit einem riesigen Spiegel eingemeindet wird: Wir sind also nicht nur Papst, sondern auch Gralsritter! Das finden die Premierengäste überwiegend toll, selbst wenn der böse Zauberer Klingsor in Strapsen nicht bei allen gut ankommt und auch die Hakenkreuz-Episode für lautstarke Entrüstung sorgt. Beim Gang durch die Geschichte darf diese für Wahnfried natürlich nicht unwichtige Epoche nicht fehlen - dass sie dann mit Klingsors Zaubergarten als böser Spuk ganz flott entsorgt wird, lässt sich als ironische Randnotiz zur Psychohygiene der Wagners lesen. Manchmal hat man den Eindruck, dass der junge Norweger Herheim ein bisschen zu viel auf einmal will und zeigt. Amfortas´ Sündenfall muss man auf dem zentralen Bett nicht unbedingt auch noch gesehen haben. Die Bilderflut, die sich aus der märchenhaften Entwicklungsgeschichte von Klein-Parsifal im Matrosenanzug, aus kollektiver deutscher Identitätssuche und aus der Installation einer Kunstreligion zusammensetzt, wirkt mit ihren Regietheater-Versatzstücken gelegentlich wie entfesseltes deutsches Stadttheater. Herheim stößt mit seiner opulenten Vergangenheitsbewältigung in der Bayreuther Umbruchzeit am Ende der Ära Wolfgang Wagners jedenfalls auf offene Augen und Ohren. Man kann im Detail gewiss viel gegen seine Inszenierung einwenden, aber sie ist voller großartiger Momente, in denen deutsche Zeit auf wundersame Weise zum Theater-Raum wird - und der schier erschlagende szenische Beziehungszauber als dem musikalischen abgelauscht erscheint. Abmarsch an die Front Die starke Wirkung ist auch Verdienst von Heike Scheele, die ein immer wieder faszinierend zwischen Wahnfried-Villa und patiniertem Uraufführungs-Sakralraum changierendes Bühnenbild geschaffen hat. Klingsors Zaubergarten ist eine herrlich skurrile Weltuntergangs-Revue mit kopulierenden Krankenschwestern im Lazarett. Durch die Fenster der Wagner-Villa schaut man auf Kriegsprojektionen, und der Ritterchor steht am ersten Aufzug martialisch bereit zum Abmarsch an die Front: "Treu bis zum Tod", wie Wagners Text ganz im Einklang mit wilhelminischer Weltkriegs-Rhetorik betont. Daniele Gattis Dirigat ist das Gegenteil von martialisch. Der italienische Debütant auf dem Grünen Hügel sucht das Heil im delikat ausgeloteten Piano-Bereich und in extrem gedehnten Tempi, die von den Sängern sicher nicht leicht zu bewältigen sind. Zur Kunst der Nuance, zu der gerade im dritten Aufzug auch der Parsifal des Christopher Ventris findet, müsste sich noch mehr orchestrale Innenspannung einstellen. Im Gegensatz zu Kwangchul Youns beeindruckend flexiblem Gurnemanz kann Mihoko Fujimuras auch in der Artikulation unklare Kundry nicht durchgehend befriedigen. Neben Thomas Jesatkos Klingsor gehört Detlef Roths Amfortas zu den starken Stimmen der Premiere. Kundry mit Kleinfamilie Ein blutiger Dornenkranz zeigt seine Leiden an, und die Wundmale einer überindividuellen Erlösungsgeschichte trägt auch der gealterte Parsifal als Geißelungs-Striemen auf dem Rücken. Die Identitäten der Figuren überschneiden sich auch auf weiblicher Seite: Im Vorspiel sehen wir Parsifals Mutter auf dem Sterbebett in Wahnfried, und Kundry wird später die Gestalt dieser Mutter annehmen. Kundry findet am Schluss übrigens nicht den ewigen Frieden im Tod, sondern gründet mit Gurnemanz eine Kleinfamilie, während der Reichsadler offenbar zum guten deutschen D-Mark-Symbol mutiert und die zeitgemäße Erlösung im Wirtschaftswunder-Konsum signalisiert. |
|
Die politische "Parsifal"-Korrektur Peter Vujica aus Bayreuth
Vor dem Festspielhaus das Wagnerbanner, auf der Bühne die Hakenkreuzflagge: Bayreuth übt sich in Geschichtsbewältigung - Stefan Herheims "Parsifal" ist platt und musikalisch wenig attraktiv Während der ersten Bayreuther Aufführungsserie des Parsifal, im Sommer 1882, durchbrach Richard Wagner nach der Blumenmädchenszene im zweiten Akt zum Befremden des Publikums das von ihm selbst verhängte Applausverbot mit Bravo-Rufen. Sie galten insbesondere dem dritten Blumenmädchen, Carry Pringle mit Namen, der letzten Liebe des damals bald Siebzigjährigen. Als ihm Carry Pringle im Februar darauf nach Venedig nachreiste, enttarnte Cosima die Beziehung und machte ihm am Morgen des 13. Februar eine Eifersuchtsszene, an deren Folgen er noch am selben Nachmittag starb. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Meister, wäre er Zeuge von Stefan Herheims in diesem Jahr erstellter szenischer Parsifal-Version geworden, sich im zweiten Akt jeglicher Beifallskundgebungen enthalten hätte. Anstatt eines Zaubergartens sieht man ein Lazarett, in dem es die zu Krankenschwestern umfunktionierten Blumenmädchen unter dem Kommando eines Strapse tragenden Transvestiten, der sich als Klingsor entpuppt, mit den gefaschten, oft mühselig auf Krücken humpelnden Verwundeten treiben. Und - neuerdings ja politisch ganz korrekt - mit sich selbst. Am Ende des ersten Aktes erweisen sich die Gralsritter ja auch schon zur Homophilie neigende Militaristen, die sich, bevor sie, wie auf Videos angedeutet, in den Krieg ziehen, auffallend lange herzen. Und aus dem sie, wie angedeutet, in beklagenswertem Zustand zurückkehren und durch die unkonventionellen therapeutischen Interventionen durch das Krankenhauspersonal wieder ein bisschen aufrichten lassen. Als dann am Schluss dieser Szene Hakenkreuzfahnen gehisst wurden, ist - für Bayreuth unüblich - im Publikum Unmut laut geworden, der jedoch nach Aktschluss durch das Bravo-Gebrüll einer im Zuschauerraum nistenden Claque im Keim erstickt wurde und sich im lauten Jubel, der zur sichtlichen Freude des Regisseurs nach Ende der Vorstellung aufbrandete, gar nicht mehr zu artikulieren wagte. Herheim hat also ziemlich plakativ auf die Nazi-Karte gesetzt, die nach wie vor in allen Kunstspielen als unbesiegbares Atout alles sticht und die auszuspielen vor allem in Bayreuth nur allzu große Berechtigung hat. Andererseits ist ja auch wieder schade, dass man nach Schlingensiefs ins chaotische Zentrum der Mythen vordringende Version, die nicht den Text, sondern - ganz in Adornos Sinn - die Noten in Bilder verwandelt, nun eine so kulinarisch gelackte und nur künstlich verrätselte Parsifal-Version präsentiert. Denn Stefan Herheim ist natürlich ein perfekter, in seinen besten Augenblicken brillanter Illusionist. Dies hat er in diesem Parsifal vor allem im Vollzug einer nun schon allgemein gepflogenen, gleichwohl un- wenn nicht gar antimusikalischen Unsitte der szenischen Gestaltung eines Vorspiels wieder bewiesen. Im vorliegenden Fall hat man sich von dessen langweilig zäher Gestaltung durch Daniele Gatti gerne in von den Reizen einer perfekten Optik auf tröstliche Weise verwöhnen lassen. Heike Scheele als Herheims Bühnenbildnerin hat nämlich den Salon des Hauses Wahnfried auf fast surreal suggestive Weise nachgebaut, den Ulrich Niepel in changierendes Farblicht getaucht hat. So konnte Herheim mit seinen Rätseln loslegen: Wer ist die Frau, die da auf einem Raum beherrschenden Bett liegt? Bald händeringend, bald verführerisch, bald im Sterben, bald mit einem Knaben in Matrosenanzug kuschelnd? Herzeloide, Kundry oder gar Cosima? Im Bedarfsfall natürlich alle drei. Das ist natürlich Futter für Exegeten und Interpreten. Sodass diese ganz übersehen, dass Stefan Herheim, weil auch in Bayreuth die Probenzeit begrenzt ist, selbige hauptsächlich mit dem überflüssigen Vorspiel vergeudet und das Spiel in abnehmenden Ausmaß an Eindringlichkeit und Präzision verliert. Das Licht funktioniert ungenau, und das Gerumpel auf der Bühne ist einem Bayreuther Festspielhaus unangemessen. Auf der Karfreitagswiese herrscht dann vor einem plätschernden Springbrunnen nur noch das übliche Wagnergefummel. Und das Schlussbild zeigt den Deutschen Bundestag, wo sich die Abgeordneten im Unterschied zu den Gralsrittern, weil sie ja, durch wen auch immer, erlöst sind, ganz züchtig verhalten. Schrill und ungenau Schließlich geht man aber noch immer auch wegen der Musik und nicht nur einer Inszenierung wegen in eine Aufführung. Die in Rede stehende ist nur bedingt empfehlenswert. Nicht nur, dass Daniele Gatti, sich von seinem Tempo- und auch Dynamikphlegma nicht und nicht erholt, ist ein Parsifal ohne Kundry kein Parsifal. Mihoko Fujimura wird bei Tönen, die Kopfresonanz erfordern, schrill und ungenau. Damit ist das musikalische Kraftzentrum des gesamten Werkes erheblich irritiert. Was nützt es dann, wenn Kwangchul Youn einen geradezu schneidend klaren Gurnemanz abliefert und Detlef Roth als Amfortas das zweite R in seinen "Erbarmen"-Rufen auf bewundernswerte Weise zu einem zwischen Es und D liegenden zu Schleifton vokalisiert. Christopher Ventris tut und singt als Titelheld das Übliche, und Thomas Jesatko zieht mit Todesverachtung seine Strapse an und singt so, als wäre er tatsächlich ein Klingsor von besonderer musikalischer Nachdrücklichkeit. |
|
Neuer "Parsifal" in Bayreuth' VON WILHELM SINKOVICZ Den neuen Bayreuther „Parsifal" führen „der Irrnis und der Leiden Pfade" direkt in den Bundestag. Jubel für Stefan Herheims Rätselspiel der jüngeren deutschen Geschichte. Einhellige Begeisterung, Jubel beim Erscheinen des Regieteams vor dem Vorhang: Die Neuinszenierung des „Parsifal" durch Stefan Herheim befriedigte offenbar alle Sehnsüchte des Bayreuther Festspielpublikums. Heftige Buhrufe musste diesmal lediglich der Dirigent, Daniele Gatti, einstecken. Eine richtungsweisende musikalische Neudeutung ist ihm tatsächlich nicht gelungen. Dazu stand ihm wohl auch eine allzu unausgewogene Sängerbesetzung zu Gebote. Neben dem rollendeckenden, sehr kraftvollen Christopher Ventris in der Titelpartie glänzte lediglich der neue Gurnemanz, Kwangchul Youn, der seinen balsamisch weichen Baß in langen Legatobögen ebenmäßig schön, und doch wortdeutlich artikulierend verströmte. Umgeben waren die beiden von zum Teil unauffälligen braven Kollegen wie Thomas Jesatko als Klingsor, zum Teil jedoch auch von ärgerlich überforderten Protagonisten wie der im Mittelakt nur noch angestrengt forcierenden Kundry Mihoko Fujimuras oder dem schmalspurig tönenden Amfortas von Detlef Roth, dessen liebenswerte Bemühung um Prägnanz und Espressivo mehrheitlich doch bereits in der Öffnung zum unsichtbaren Orchesterraum zu versickern drohten. Lähmende Tempi, Andachts-Bilder Ob dringlichere Vokalgestaltung der lähmenden Wirkung vorgebeugt hätten, die von Gattis überzogen langsamen Tempi ausging, darf allerdings bezweifelt werden. Von dem „Parsifal" ging zunächst zwar ein durchaus eigentümlicher, durch dauernden Intensitäts-Druck ausgelöster Reiz aus. Doch verbrauchte sich diese rasch, denn die Klangereignisse standen unverbunden, ohne dramaturgische Konsequenz nebeneinander. Den langen Entwicklungs-Bögen von Wagners letztem Drama fehlte die Konsistenz, aber auch die klanglich Differenzierung. Eine allzu monochrome Palette wirkt rasch ermüdend. Besonders deutlich wird ein solcher Mangel dort, wo auch Herheims Vokabular, im ersten Aufzug noch von überbordernder, schier undurchdringlicher Bilderfülle, sich ausdünnt, wo die Geschichte des „Parsifal" schlicht, zuweilen regelrecht altmodisch erzählt wird. Da ließe sich ein Decrescendo szenischer Intensität verzeichnen, das im ersten Bild des dritten Aufzugs gar in Tableaus mündet, die von Führich gemalt sein könnten: Parsifal und Kundy als Christus und Maria Magdalena aus dem Andachts-Büchel. Erst die Trümmer-Frauen, die zum Karfreitagszauber plötzlich mit Hacke, Spaten, Besen und Kübel aufmarschieren, erinnern uns angelegentlich daran, dass die Regie an diesem Abend nicht nur Devotionalien- sondern auch deutsche Historienmalerei betreiben will. Kaiser Wilhelm, Hitler und der Bundestag Stellt sie den „Parsifal" doch in ein Zeitkontinuum vom wilhelminischen Preußentum über das Dritte Reich bis zur Gegenwart. Die Gralsritter marschieren in den Ersten Weltkrieg, machen als Verwundete Zwischenstopp in Herrn Klingsors Anti-Walhall - erstmals sieht man da die Ritter, die der arglose Parsifal besiegt, um zu den Blumenmädchen (hier Krankenschwestern und Revue-Girls der Dreißigerjahre) vorzudringen. Zuletzt sitzen alle miteinander im Bundestag und lassen sich vom Heilsbringer noch einmal vormachen, wie das ist, wenn der Gral enthüllt wird. Wollte Herheim damit die Absurdität jeglicher metaphysischen Lehre, jeglichen Verweises auf kulturelle Urgründe in zivilisiert-globalisierten Zeiten wie den unsern decouvrieren, dann wäre ihm das vielleicht geglückt. Sollte die Operetten-Illumination eines „Bühnenweihfestspiels" angesichts der über die Generationen fehlgeleiteten Sehnsucht nach realen Erlöserfiguren nachdenklich stimmen, dann ist das Gelingen der Übung zu hinterfragen: Zwar regte sich während des zweiten Aufzugs leiser Widerstand gegen das Hissen überdimensionaler Hakenkreuz-Flaggen, doch zerbricht die falsche Nazi-Herrlichkeit ohnehin sogleich unter Parsifals segensreichen Speer - so schnell ist wieder alles politisch korrekt und die Festspiel-Ruhe während des Sektempfangs in der zweiten Pause bleibt gewahrt. Insgesamt, so schien es, genoß das Publikum die Bilder- und Assoziationsströme dieser Produktion, die zu Beginn einer wahren Flutwelle glichen. Vexierspiel der Wagner-Assoziationen Schon das Vorspiel wird zum Vexierspiel. Wir finden uns in der Villa Wahnfried, erleben die erotischen Begehrlichkeiten einer Mutter angesichts ihres Sohnes und ihren Verzweiflungstod, weil der lieber in den Garten läuft, um am Grabe Richard Wagners mit seinem Pfeil, Bogen und seinem Hutschpferd zu spielen. Herzeleide, die späteren Verführungskünste der Kundry, die ja ganz und gar auf die Erinnerung an mütterliche Geborgenheits-Sehnsüchte rekurrieren, viele Aspekte verfließen in diesem Kaleidoskop. Auch in der Folge erscheinen die handelnden Figuren wie Jupiter selig, in tausend Gestalten. Der Regisseur hat Verwendung für jede: Ist die Dame Kundry, die Mutter, das Dienstmädchen? Ist der Herr Amfortas, Christus oder doch der Kaiser Wilhelm bei einer Scharade? Sensationell, was die Bayreuther Technik leistet, die Beleuchtungs-Magie dieser Inszenierung ist stupend, die Verwandlungen sind von atemberaubend Virtuosität: Gleich sehen wir den Park der Villa Wahnfried, gleich ein Remake des Uraufführungs-Gralstempels mit seinen maurischen Säulen und Kuppeln, gleich weitet sich das Bild vom Krankensaal zur vielfach verspiegelten Parklandschaft. Mag sich die musikalische Komponente der Premiere einförmig ausnehmen, die optische beruhigt sich erst während der zentralen Auseinandersetzung zwischen dem Titelhelden und Kundry, die dann übrigens nicht, wie man vielleicht angenommen hätte, als jene Mutterfigur aus dem Vorspiel wiederkehrt, sondern, getreu dem selbstgewählten Zeit-Kontinuum Herheims, als Marlene-Dietrich-Kopie, ein „blauer Engel". So spielt die Regie mit Erwartungshaltungen, zeithistorischen Assoziationen, vor allem aber mit Wagners Text, aus dem unzählige Anregungen paraphrasiert, oder sogar eins zu eins übernommen werden, vor allem die Betrachtungen des Gunemanz, ob da Kundry demonstrativ „anders schreitet als sonst", oder der Sündenfall des Amfortas als Grottenbahn-Schaustück nachgestellt wird. An vielfältig-anschaulicher Libretto-Exegese mangelt es an diesem Abend jedenfalls nicht. Soviel zum Fortschritt, den die Bayreuther Aufführungs-Geschichte hiermit gegenüber dem vorletzten „Parsifal"-Inszenierung durch Christoph Schingensief erzielt hat. Damals stacksten die Sänger ratlos über eine Müllhalde. Dass Wagner seine Mitstreiter einst vor allem um „Deutlichkeit" gebeten hat, lassen wir daher fürs erste beiseite. Dieses Festival versteht seine Produktionen schließlich als Work in Progress. Auf Wiedersehen im Juli 2009 also. Kann sein, da wird noch Beachtliches draus!
|
|
"Parsifal": Wirr und genial Zum letzten Mal verantwortet Wolfgang Wagner, seit 1951 im Amt, die Bayreuther Festspiele. Ende August will sich der Komponisten-Enkel mit dann 89 Jahren zurückziehen und den Gral an seine Töchter Eva und Katharina übergeben. Aufhören, wenn’s am schönsten ist? So gut war Bayreuth jedenfalls schon seit Jahren nicht mehr. Was aber, geradezu typisch für Bayreuth, nicht an der musikalischen Leistung liegt, sondern an der Regie. Er kann’s Stefan Herheim hat Wagners Bühnenweihfestspiel "Parsifal" ganz weihelos, aber dafür sehr bühnentauglich (bei einer Nicht-Handlungs-Oper wie "Parsifal" eine hohe Kunst) inszeniert. Es ist dabei auch vieles misslungen. Aber Herheims Regie ist selbst in den übelsten Momenten um Klassen besser als alles, was Christoph Schlingensief zuletzt in Bayreuth abgeliefert hatte. Jener hatte sein opernfeindliches Etwas oder Nichts über "Parsifal" gestülpt, Herheim setzt sich mit dem Werk auseinander. Intensiv. Handwerklich erstklassig. Was man ihm vorwerfen kann, geradezu muss, ist, dass er wieder einmal viel zu viel an Ideen, Gedankensprüngen, Schichten in seine Regie packt und nicht genügend abstrahiert. Das war schon in Salzburg bei der "Entführung" so gewesen. Diesmal geht das Konzept aber immerhin in Teilen auf. Herheim erzählt "Parsifal" indivualpsychologisch: Als Traum vom kleinen Kind, das Ritter spielt und große Probleme mit seinen Eltern hat. Politisch: Als Erlösergeschichte vom Nazitum (wieder einmal muss es Hakenkreuze und NS-Uniformen geben), die im Bundestag in Bonn endet. Soziologisch: Wie sehr die Massen nach einem Führer gieren. Historisch: Montsalvat ist anfangs ein prachtvolles Schloss mit grandiosen Kostümen, später kommen Erster und Zweiter Weltkrieg. Wagner-kritisch: Er hinterfragt den Bayreuther Kult, indem er das Festspielhaus selbst und die Villa Wahnfried auf die Bühne stellt. Märchenhaft und in Endzeitstimmung: Gurnemanz und viele andere sind Todesengel. Und als Kritik am Spießertum: Beim Finale sind Kundry und Gurnemanz die Eltern von Parsifal und eine typisch deutsche Familie. Ein seltsamer gedanklicher Hakenschlag. Vieles ist wirr, manches unverständlich, weniges banal, das meiste überfrachtet, einiges genial. Wagner zum Mitdenken. Auf höchstem ästhetischen Niveau. Die Bilderpracht (Bühne: Heike Scheele) ist verblüffend. Nicht so die musikalische Umsetzung: Daniele Gatti sorgt im ersten Aufzug, der 20 Minuten länger dauert als bei der letzten "Parsifal"-Premiere unter Boulez, noch für hinreißende Farben. Mit Fortdauer der knapp sieben Stunden (inklusive Pausen) geht aber die Spannung verloren, und das Dirigat wird recht zäh und langatmig. Nicht alle können es Auch die sängerischen Leistungen setzen keine Maßstäbe. Christopher Ventris als tolpatschiger Titelheld hat eine feine Höhe, nicht die größte Stimme und phrasiert elegant. Detlef Roth, der leidende Amfortas, singt Wagner wie einen Liederabend. Kwangchul Youn bewältigt den Gurnemanz profund, tapfer und ist um vieles besser als Mihoko Fujimura als schrille Kundry. Thomas Jesatko, der Klingsor in Strapsen und Frack als Marlene-Dietrich-Parodie, besticht nicht nur szenisch. Schlimm wird es bei kleineren Partien wie bei den Blumenmädchen. Toll agiert der Chor. Am Sonntag wird in Bayreuth erstmals eine Oper ("Meistersinger") live übertragen: Im Internet um fast unverschämte 49 Euro und auf Leinwand zum Public Viewing im Ort. Oper meets Fußball. Kein Wunder. Amfortas und die Wunde: |
|
Jubel für plakative Bilder in Bayreuth
Von Stephan Maurer WZ Online / dpaAls Zeitreise durch die Irrungen und Wirrungen der deutschen Geschichte inszeniert der norwegische Regisseur Stefan Herheim den "Parsifal" bei den Bayreuther Festspielen. Die subtile Interpretation, die mit plakativen Bildern und einer exakten Personenregie besticht, erntete bei der Premiere zum Festspielauftakt am Freitagabend einhellige Zustimmung und wurde mit großem Applaus gefeiert, der auch die glänzend disponierte Sängerriege einschloss. Dagegen musste der italienische Dirigent Daniele Gatti für seine pathetisch-feierliche Auslegung der Partitur einige Buhrufe einstecken. "Parsifal" hat schon immer eine besondere Rolle in der Bayreuther Festspielgeschichte gespielt, denn Richard Wagner hat sein Spätwerk speziell für das Festspielhaus geschrieben, wo es 1882 uraufgeführt wurde. Herheim knüpft an diesen Mythos an und verortet seinen "Parsifal" direkt in Bayreuth: Als Kulisse dient im Bühnenbild von Heike Scheele Haus Wahnfried, einst Richard Wagners Bayreuther Villa. Bayreuth wird so zum Stellvertreter-Ort für deutsche Geschichte schlechthin. Schon zur Ouvertüre hebt sich der Vorhang, und man sieht Parsifal als kleinen Jungen, der den Tod seiner Mutter Herzeleide mit ansehen muss. Sie stirbt in einem großen weißen Bett in der Bühnenmitte, das zentrale Bedeutung in der Inszenierung bekommen soll: Später wird hier die Mutter den Sohn gebären und Gralskönig Amfortas den Reizen Kundrys verfallen. Geschickt spielt Herheim mit verschiedenen Ebenen und Identitäten, zeigt in Rückblenden und Zeitsprüngen die Entwicklung des "reinen Toren" Parsifal, der vom Kind zum Mann und schließlich zum Erlöser reift. Die Handlung ist - auch über filmische Einblendungen - verwoben mit den Stationen der oft unheilvollen deutschen Geschichte. Im Wahnfried-Garten versammelt Herheim eine bunte, geflügelte Gesellschaft des Wilhelminischen Kaiserreichs. In ironischer Brechung spiegelt der Regisseur die Erlösungssehnsucht der feinen Damen und Herren, die unschwer als Wagnerianer zu erkennen sind, Pilger zu ihrem "Heiligtum" - dem Grab des Meisters Richard Wagner. Klingsors Zauberreich im zweiten Akt ist ein Lazarett aus dem Ersten Weltkrieg, wo Krankenschwestern und Blumenmädchen es auf Feldbetten mit den Verwundeten treiben. Der Zauberer selbst ist eine skurrile Gestalt in Frack und Strapsen. Ausgestattet mit aufwendigen, farbenfrohen Kostümen und fantastischem Kopfputz (Kostüme: Gesine Völlm), umschwärmen seine Mädchen den stattlichen Parsifal, der - von einem Stuntman gedoubelt - von Wahnfrieds Balkon sogar sechs Meter in die Tiefe springt. Später werden - unwillig begleitet von einem Buh-Rufer im Zuschauerraum - Hakenkreuzfahnen aufgezogen, die Blumenmädchen marschieren als SS-Trupp auf. Doch der Spuk dauert nur kurz - dann brennt Wahnfried, von Bomben getroffen, und der Adler mit dem Hakenkreuz in den Krallen wird gesprengt. Vor den Ruinen der Villa ziehen Trümmerfrauen auf, und Regisseur Herheim entbietet in kurzer Botschaft Wieland und Wolfgang Wagner seinen Gruß, die die Festspiele 1951 wieder ins Leben gerufen haben. Die letzte Verwandlung führt - als Sinnbild der schließlich siegreichen Demokratie - in den alten Bonner Bundestag, mit Amfortas am Rednerpult und dem weiß gekleideten Parsifal als Erlöser. Im fast schon kitschig wirkenden Schlussbild erscheint die Weltkugel als Symbol der Vereinten Nationen, darüber schwebt die Friedenstaube - oder ist es der Heilige Geist? -, und in einem Spiegel im Bühnenhintergrund sieht das Publikum sich selbst. Herheim ist - auch dank einer exzellenten Lichtregie - eine weitgehend stimmige, weihevolle Inszenierung gelungen. Manche Symbolik freilich wirkt allzu dick aufgetragen, eine Nummer kleiner hätte manches Mal auch gereicht. Doch zweifellos hat das Bayreuther Publikum nach Christoph Schlingensiefs höchst umstrittener Bilderflut nun wieder einen "Parsifal", an dem es sich über Jahre freuen wird. Das dürfte weniger für die musikalische Auslegung durch Daniele Gatti gelten. Positiv fällt zwar auf, wie gut Musik und Szene aufeinander abgestimmt sind; auch führt der Maestro das auf hohem Niveau musizierende Festspielorchester zurückhaltend und sängerfreundlich. Doch Gatti zerdehnt den "Parsifal" in schleppenden, getragenen Tempi und langen Pausen auf satte vier Stunden und 40 Minuten - da mag sich manch ermüdeter Besucher ein wenig mehr italienisches Temperament wünschen. Das Sängerensemble präsentierte sich ausgezeichnet geführt und verband große Spielfreude mit nuanciertem Gesang und guter Textverständlichkeit. Die beiden Bayreuth-Debütanten Christopher Ventris als schmerzlich gereifter, "durch Mitleid wissend" gewordener Parsifal und Detlef Roth als leidender Amfortas gefielen mit variabler Stimmführung und Ausdruckskraft. Kwangchul Youn wurde für seine emotionale Darstellung des Gurnemanz gefeiert. Thomas Jesatko gab einen schmeichlerisch-herrischen Klingsor, Mihoko Fujimura eine sphinxhafte, ungemein wandelbare Kundry, die sich mal als braves Dienstmädchen, dann wieder als blonder Marlene-Dietrich-Verschnitt zeigt. Aus der Tiefe überzeugte Diógenes Randes als Titurel. Bravorufe galten dem von Eberhard Friedrich bestens vorbereiteten Chor. |
|
Bayreuther Festspiele Wie Stefan Herheim die Erlösungsbotschaft von "Parsifal" versteht Die Bayreuther Festspiele stehen vor dem Ende einer Ära. Mit der letzten Aufführung dieses Sommers, am 28. August, wird Wolfgang Wagner zwei Tage vor seinem 89. Geburtstag sein Amt als Festspielleiter abgeben und aller Voraussicht nach in die Hände seiner Töchter Katharina und Eva legen. Während 57 Jahren stand er an der Spitze des von seinem Grossvater gegründeten und von ihm und seinem Bruder Wieland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ins Leben gerufenen Festspielunternehmens. Allein schon in Zahlen ein beispielloses Lebenswerk. Doch Wolfgang Wagner hat nach dem frühen Tod Wielands 1966 als Alleinverantwortlicher am Grünen Hügel auch künstlerisch Bedeutendes geleistet, vor allem mit der Öffnung der Wagner-Festspiele für neue szenische und musikalische Interpretationsweisen. Das ist ob den Querelen um seine Nachfolge in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Jetzt ist die Zeit, sich wieder darauf zu besinnen, nicht im Sinn einer Bilanz, sondern weil der greise Festspielchef für die letzte Neuproduktion seiner Intendanz mit dem Regisseur Stefan Herheim und der Bühnenbildnerin Heike Scheele nochmals ein Team von überwältigender Kreativität verpflichtet hat. Bayreuth als Spiegel Herheim und Scheele rekapitulieren mit dem Bühnenweihfestspiel "Parsifal" Epochen der deutschen Geschichte vom Wilhelminismus bis zur Bundesrepublik, gespiegelt in der Geschichte der Bayreuther Festspiele, der Familie Wagner und des Hauses Wahnfried. Im Ansatz erinnert das an Katharina Wagners letztjährige "Meistersinger"-Inszenierung. Während sich diese aber auf die ästhetische Wirkungsgeschichte der "Meistersinger" beschränkte, liest Herheim "Parsifal" unter politischen und psychologischen Vorzeichen. Die Parallelität zwischen "Parsifal"-Handlung, deutscher und Wahnfried-Geschichte ergibt sich für ihn daraus, dass sich diese Nation immer wieder Erlöserfiguren verschrieben habe. Aus dieser Prämisse resultiert die Vielschichtigkeit seiner Inszenierung. Es beginnt beim Vorspiel. Da liegt in einem gründerzeitlich prunkvollen Raum unter dem Emblem des Reichsadlers eine Frau auf dem Sterbebett, neben ihr ein Knabe im Matrosenanzug. Während er mit Holzpferd und Pfeilbogen spielt, lockt sie ihn zu sich heran, immer dringlicher, bis er widerstrebend gehorcht und sich von ihr umarmen lässt. So fängt die Geschichte von Parsifal an, er ist der Knabe, die Sterbende seine Mutter Herzeleide. Aber es könnte auch die greise Cosima sein, die ihren Enkel umarmt. Später erscheint diese Gestalt immer wieder als Verkörperung der mütterlichen, dienenden Inkarnation Kundrys, wie auch der Knabe bis zuletzt in die Handlung integriert ist, während der eigentliche Parsifal dem Matrosenanzug nach und nach entwächst. Schon in dem von Herheim erfundenen Vorspiel bündeln sich verschiedene Leitmotive der Inszenierung: die Umsetzung des im Text umständlich Erzählten in greifbare szenische Handlung – darauf versteht sich Herheim mit seiner barocken Fabulierlust meisterhaft –, sodann die Mehrdeutigkeit, das Schillern insbesondere Kundrys zwischen verschiedenen Existenzformen – sie ist hier nicht nur Dienerin und Verführerin, Heilige und Höllenrose, sie nimmt auch die Züge des leidenden Amfortas und des als Transvestit auftretenden Zauberers Klingsor an. Auch der Raum ist steter Verwandlung unterworfen – die Bayreuther Bühnentechnik leistet dabei Wunderdinge. Aus dem Reichsadler, dessen Flügel die Bewohner der Gralsburg als Attribute auf dem Rücken (Kostüme Gesine Völlm) tragen, wird unversehens der Schwan, auf den der unwissende Tor Parsifal zielt, das Zimmer der Wahnfried-Villa mutiert zum Gralstempel der "Parsifal"-Uraufführung. Und dann dringt die Aussenwelt ins Heiligtum ein: der Aufmarsch des Heeres, das in den Ersten Weltkrieg zieht, der Fahneneid als Pendant des Gralrituals, dessen lebenspendende Kraft konkretisiert wird in der Geburt eines Kindes – Bilder von albtraumhafter Suggestivität. Der erste Akt endet denn auch damit, dass der Knabe Parsifal im Bett der Mutter erwacht – da kommt eine inzestuöse Beziehung ins Spiel. Doch was das Kind gesehen hat, war kein Traum. Der zweite Akt spielt in einem Lazarett, Klingsors Blumenmädchen sind Krankenschwestern und Variété-Tänzerinnen. Die Verführungsszene Kundrys fällt allerdings erstaunlich konventionell aus, vielleicht weil Mihoko Fujimura mit der Partie stimmlich hörbar überfordert ist. Möglicherweise wollte Herheim aber auch eine Ruhepause vor dem grossen Eklat: Die "Wehr", die Klingsor, auf dem Balkon von Wahnfried stehend, Parsifal entgegenstellt, marschiert in Uniform unter Hakenkreuzfahnen auf. Und wie die echte Villa Wahnfried wird ihre Bühnenkopie zerbombt. Gurnemanz, Kundry und Parsifal finden sich zu Beginn des dritten Aufzugs wieder zwischen Ruinen, Trümmerfrauen ziehen vorbei. Doch die Mauern werden, Stein für Stein, wieder aufgebaut, der Aufruf, mit dem das Publikum 1951 bei der Wiedereröffnung der Festspiele gebeten wurde, von politischen Gesprächen abzusehen, leitet über zum Schlussbild. Aus dem Gralstempel ist der Bonner Bundestag geworden. In weissem Gewand vollzieht Parsifal seinen Erlöserdienst. Dann senkt sich eine Weltkugel über die Szene, zurück bleiben an der Rampe Gurnemanz, Kundry und der Knabe, vereint zur bürgerlichen Kleinfamilie. Nach so viel szenischem Feuerwerk ein irritierend leeres, vages Bild. Musikalische Defizite Die musikalische Wiedergabe spielt in dieser Aufführung eine allzu untergeordnete Rolle. Dies erklärt sich allerdings nicht allein mit der (Über-)Fülle des szenischen Geschehens, und ebenso wenig liegt es am Festspielorchester und am Chor, sie bilden nach wie vor ein enormes Kapital. Wenn dessen Wertschöpfung in dieser Einstudierung klein bleibt, so deshalb, weil Daniele Gatti einen Interpretationsansatz pflegt, der mit jenem von Herheim kaum kompatibel ist: breite, weihevolle Tempi, einen erdigen, weichen Mischklang, ein breites melodisches Strömen, nicht Schärfung und Strukturierung. Auch den Sängern macht er es damit schwer. Christopher Ventris allerdings verfügt in der Titelpartie über den erforderlichen Atem und die Kraft zu strahlender klanglicher Expansion. Doch Kwangchul Youns Gurnemanz wirkt wenig gestaltet und im Timbre monochrom, Detlef Roth gewinnt als Amfortas mit Nietzsche-Zügen und Dornenkrone erst gegen Schluss vokale Kontur, und Thomas Jesatkos Klingsor prägt sich vorab durch seine Strapse ein. Im Bereich der Sänger-Engagements besteht jedenfalls für die künftige Festspielleitung einiger Handlungsbedarf. Was jedoch die Regie-Seite betrifft, so hat Wolfgang Wagner mit der Verpflichtung Herheims nochmals sein Entdeckertalent bewiesen. MARIANNE ZELGER-VOGT |
|
Wagner-Festspiele Eine erfolgreiche Eröffnungspremiere am Grünen Hügel: Christoph Herheim schuf dem Bayreuther Publikum einen "Parsifal", an dem es sich noch viele Jahre erfreuen kann Von Stephan Maurer Eine Zeitreise durch die Irrungen und Wirrungen der deutschen Geschichte – so sieht der norwegische Regisseur Stefan Herheim den Parsifal in seiner Neuinszenierung bei den Bayreuther Festspielen. Die subtile Interpretation, die mit plakativen Bildern und einer exakten Personenregie arbeitet, wurde bei der Premiere zum Auftakt der 97. Bayreuther Festpiele mit großem Applaus gefeiert, der auch die glänzend disponierte Sängerriege einschloss. Dagegen musste der italienische Dirigent Daniele Gatti für seine pathetisch-feierliche Auslegung der Partitur einige Buhrufe hinnehmen. Parsifal hat schon immer eine besondere Rolle in der Bayreuther Festspielgeschichte gespielt, denn Richard Wagner hat sein Spätwerk speziell für das Festspielhaus geschrieben, wo es 1882 uraufgeführt wurde. Herheim knüpft an diesen Mythos an und verortet seinen Parsifal direkt in Bayreuth: Als dient in Heike Scheeles Bühnenbild die Villa Wahnfried, einst Richard Wagners Bayreuther Villa. Bayreuth wird so zum Spielort der deutschen Geschichte schlechthin. Schon zur Ouvertüre hebt sich der Vorhang, und man sieht Parsifal als kleinen Jungen, der den Tod seiner Mutter Herzeleide mit ansehen muss. Sie stirbt in einem großen weißen Bett in der Bühnenmitte, das eine zentrale Bedeutung in der Inszenierung bekommen soll: Später wird hier die Mutter den Sohn gebären und der Gralskönig Amfortas den Reizen Kundrys verfallen. Geschickt spielt Herheim mit verschiedenen Ebenen und Identitäten, zeigt in Rückblenden und Zeitsprüngen die Entwicklung des "reinen Toren" Parsifal, der vom Kind zum Mann und schließlich zum Erlöser reift. Die Handlung ist – auch über filmische Einblendungen – verwoben mit den Stationen der oft unheilvollen deutschen Geschichte. Im Wahnfried-Garten versammelt Herheim eine bunte, geflügelte Gesellschaft des Wilhelminischen Kaiserreichs. In ironischer Brechung spiegelt der Regisseur die Erlösungssehnsucht der feinen Damen und Herren, die leicht als Wagnerianer zu erkennen sind, Pilger zu ihrem "Heiligtum", dem Grab des Meisters Richard Wagner. Klingsors Zauberreich im zweiten Akt ist ein Lazarett aus dem Ersten Weltkrieg, wo Krankenschwestern und Blumenmädchen es auf Feldbetten mit den Verwundeten treiben. Der Zauberer selbst ist eine skurrile Gestalt in Frack und Strapsen. Ausgestattet mit aufwendigen, farbenfrohen Kostümen und fantastischem Kopfputz (Kostüme: Gesine Völlm), umschwärmen seine Mädchen den stattlichen Parsifal, der – von einem Stuntman vertreten – von Wahnfrieds Balkon sechs Meter in die Tiefe springt. Später werden – begleitet von einem Buh-Rufer im Zuschauerraum – Hakenkreuzfahnen aufgezogen, die Blumenmädchen marschieren als SS-Trupp auf. Doch der Spuk dauert nur kurz. Dann brennt Wahnfried, von Bomben getroffen, und der Adler mit dem Hakenkreuz in den Krallen wird gesprengt. Vor den Ruinen der Villa ziehen Trümmerfrauen auf, und der Regisseur Herheim entbietet in kurzer Botschaft Wieland und Wolfgang Wagner seinen Gruß, den beiden Brüdern, die die Festspiele 1951 wieder ins Leben gerufen haben. Die letzte Verwandlung führt – als Sinnbild der schließlich siegreichen Demokratie – in den alten Bonner Bundestag, mit Amfortas am Rednerpult und dem weiß gekleideten Parsifal als Erlöser. Im fast schon kitschigen Schlussbild erscheint die Weltkugel als Symbol der Vereinten Nationen, darüber schwebt die Friedenstaube – oder ist es der Heilige Geist? In einem Spiegel im Bühnenhintergrund sieht das Publikum sich selbst. Herheim ist eine weitgehend stimmige, weihevolle Inszenierung mit exzellenter Lichtregie gelungen. Manche Symbolik freilich wirkt allzu dick aufgetragen, eine Nummer kleiner hätte manches Mal auch gereicht. Doch zweifellos hat das Bayreuther Publikum nach Christoph Schlingensiefs höchst umstrittener Bilderflut nun wieder einen Parsifal, an dem es sich noch viele Jahre erfreuen kann. Das dürfte weniger für die musikalische Auslegung durch Daniele Gatti gelten. Positiv fällt zwar auf, wie gut Musik und Szene aufeinander abgestimmt sind; auch führt der Maestro das auf hohem Niveau musizierende Festspielorchester zurückhaltend und sängerfreundlich. Doch Gatti zerdehnt den Parsifal in schleppenden Tempi und langen Pausen auf satte vier Stunden und 40 Minuten. Da mag sich manch ermüdeter Besucher ein wenig mehr italienisches Temperament wünschen. Das Sängerensemble präsentierte sich ausgezeichnet geführt und verband große Spielfreude mit nuanciertem Gesang und guter Textverständlichkeit. Die beiden Bayreuth-Debütanten Christopher Ventris als schmerzlich gereifter, "durch Mitleid wissend" gewordener Parsifal und Detlef Roth als leidender Amfortas beeindruckten mit variabler Stimmführung und Ausdruckskraft. Kwangchul Youn wurde für seine emotionale Darstellung des Gurnemanz gefeiert. Thomas Jesatko gab einen schmeichlerisch-herrischen Klingsor, Mihoko Fujimura eine sphinxhafte, ungemein wandelbare Kundry, die sich mal als braves Dienstmädchen, dann wieder als blonder Marlene-Dietrich-Verschnitt zeigt. Aus der Tiefe überzeugte Diógenes Randes als Titurel. Bravorufe galten dem von Eberhard Friedrich bestens vorbereiteten Chor. |
|
"PARSIFAL" IN BAYREUTH Von Werner Theurich, BayreuthFestspiele mit Nazis und Strapsen, Wagemutige zwischen Kitsch und Tiefsinn - und ein Patient namens Deutschland: "Parsifal" ist in Bayreuth 2008 ein plakatives Theater der Nation. Mit großer Geste, großer Wirkung, großer Show. Das Bett im Mittelpunkt: Stefan Herheim knallt in seinem neuen Bayreuther Regiedebüt "Parsifal" das zentrale Möbelstück seines Konzeptes umweglos auf die Bayreuther Bretter. Sex und Kuscheln, Ruhe und Verführung: Das Bett ist das Epizentrum der gesellschaftlichen und privaten Veränderungen. Als Erkenntnis nicht neu und eher als 68er-Mythos bekannt - doch deshalb nicht weniger tauglich als Ausgangspunkt großflächiger Untersuchungen zum Thema Schmerz und Erlösung. Und als könnte er es kaum erwarten, seine Ideen über die Bühne zu fluten, bebildert Herheim sogar das orchestrale Vorspiel zum ersten Aufzug, das von Richard Wagner autonom gedacht war, als Quasi-Ouvertüre und Themenpräsentation. Die Zeichen dieser Inszenierung stehen von Beginn an auf Zeitgeschichte. Background und Ausgangspunkt ist das Bürgertum des 19. Jahrhunderts. Drama in der Familie, mit Stummfilmästhetik: Die Mutter stirbt, das Kind leidet, das gesellschaftliche Ambiente dünstet Umbruch und Gefahr aus. Man ahnt es - dies ist Parsifals von ihm selbst vergessene Herkunft. Erfahrungen, die einen Helden erst möglich machen. Der Patient heißt Deutschland Und ein Held wird gebraucht - denn der todkranke Patient, der später versorgt werden muss, heißt zwar Amfortas, aber eigentlich ist es Deutschland. Die Wunde, die den jungen König Amfortas foltert und gleichzeitig am Sterben hindert, wurde in der klassischen "Parsifal"-Geschichte von einem heiligen Speer geschlagen, doch die Wunde dieser Inszenierung beginnt mit der deutschen Reichsgründung 1871. Regisseur Herheim lässt statt Gralsrittern und Höflingen die junge aufbruchsselige Gesellschaft auftreten: fröhliche Korpsstudenten, Geschäftsleute, herausgeputzte Damen, Klerus und Wissenschaft. "Wir sind jetzt wer", scheinen sie zu sagen, und das verleiht ihnen buchstäblich Flügel: Allesamt sehen aus wie euphorische Engel, mit schicken dunklen Federn. Herheims erster "Parsifal"-Aufzug ist der Auftakt zu einer Deutschland-Reise durch die Zeit, die das abklappert, was das immer wunde Land an einschneidenden Schmerz- und Wendepunkten zu bieten hat. Die Suche nach der Heilung für den König Amfortas, die Gralsmystik verkleinert sich zum roten Faden, der die Spur legt - die Spur Deutschlands, die Spur der dauerhaft offenen Wunde des schwierigen Landes. Und immer ist Deutschland an der Bayreuther Villa Wahnfried plaziert, Deutschland einig Wagnerland. Kitsch mit Nazis und Strapsen Herheim spielt lustvoll mit den "Parsifal"-Figuren, macht sie zu Protagonisten des jeweiligen Zeitgeistes: Kundry, zwiespältige Gehilfin des bösen Königs Klingsor, wechselt Outfit und Rollen am Fließband. Sie bezirzt als sexy Kammerzofe, schockt als düsteres Hitchcock-Wesen à la "Rebecca" oder übernimmt als bleiche Mutter die Deutschland-Rolle, weiblicher Part. Im zweiten Aufzug setzt sie als forsche Marlene Dietrich mit Frack und Perücke vergeblich zur Parsifal-Verführung an. Amfortas, sehr griffig als leidtragender Jesus-Verschnitt, wird am Schluss gar mitleiderregender Parteiführer in einer Bundestagsszene. Dem Zaubermeister Klingsor spielt Herheim übel mit: Nicht allein, dass er den "Finsteren" mit antiquierten Strapsen und Netzstrümpfen auftreten lässt - die "Rocky Horror Show" lässt grüßen. Er stellt ihm auch noch ein Ledermäntel-Nazi-Ballett zur Seite, das in den Weltkriegsuntergang tanzt. Das ist dann wirklich Provinzkabarett, der Tatsache geschuldet, dass bei unserer Zeitreise ja auch die NS-Zeit vorkommen muss. Zuvor schon war Klingsors Zaubergarten vom Weltkriegslazarett mit lüsternen Krankenschwestern zur Revueshow für den eindringenden Parsifal mutiert, samt Esther-Williams-Wasserballett und sexy Tänzerinnen mit Federn und Korsagen. Die Bayreuther Bühnentechnik leistet mal wieder Beachtliches. In diesen natürlich gewollten, aber erdrückend platten Kitschmomenten schmerzt der überambitionierte Herheim-Zugriff. Umso liebevoller geht er mit dem rechtschaffenen Gurnemanz um, der als gebeutelter Überlebender aller Kriegs- und Umbruchserlebnisse am Schluss wie ein Sieger in seinen abgerissenen Combat-Klamotten aussieht. Er erwacht nach den zweiten Weltkriegswirren im nun zerstörten Bühnenbett: ein schlichtes, klares Bild der "Stunde Null". Der Speer ist ein Speer Parsifal selbst bleibt immer hübsch "außen vor": Ständig wird er als Kind wiedergeboren, als lebende Metapher der ständigen Erneuerung, ob von der eigenen Mutter, Kundry oder Amfortas zu weiterem Treiben verführt. Er bleibt als einziger "zeitlos". Hat weder Flügel noch Uniform, er ist der ausgewiesene Ritter des lauteren Sinnes. Sein Speer ist ein Speer, der Gral ist ein schlichter Kelch: Wo andere Spielleiter bildmächtig wüten, bleibt Regisseur Herheim einfach und klar am Ball, ganz wie sein Parsifal. Am Schluss ein herrlich plakativer, reiner Tor im weißem Gewand, der im zeitgenössischen Bundestag mit seinem überdimensional großen Speer endlich den Amfortas erlöst, damit Deutschland leben kann. Böser kann man den Kitsch kaum übertreiben. Über der Bühne prangt eine monströse, runde Spiegelfläche, die als Schlussbild erst die Weltkugel bildet, dann mit raffinierter Drehung das Saalpublikum und die Darsteller abbildet: Ja, wir alle sind gemeint. Große Geste, große Wirkung, großes Kino. Das Deutschland-Theater rundet sich zunächst in Frieden. Eine Wunde wurde geschlossen, aber das Leben geht ja bekanntlich weiter. Keine wirklich frohe Botschaft, aber ein starker Schluss. Frisches Rauschen auf dem Grünen Hügel Den meisten Sänger-Beifall erhielten zu Recht der Bayreuth-Veteran Kwangchul Youn (Gurnemanz) und Bayreuth-Neuling Detlef Roth für seinen ausdrucksvollen Amfortas. Beide spielten souverän ihre Rollen, ein Glücksfall für diese plakative Inszenierung. Christopher Ventris, seit zehn Jahren "Parsifal"-erfahren, debütierte ebenfalls erfolgreich - sein stählerner Erlösertenor strahlte etwas kalt, aber druckvoll kräftig. Mihoko Fujimura war eine wandlungsfähige und stimmlich biegsame Kundry, manchmal allerdings etwas hart und kantig, wie auch Thomas Jesatkos Klingsor. Für diese Rollenversionen der beiden sperrigsten Figuren des "Parsifal"-Personals allerdings nicht schlecht geeignet. Eberhard Friedrichs Chor brillierte wie gewohnt mit überlegener Fülle und Klangmacht. Noch ein Bayreuth-Debütant: Daniele Gatti dirigierte mit selbstbewusstem Zugriff und meist guter Kontrolle des opulenten und schwierigen Klanggewebes. Seine sehr breiten Tempi hatte er stets spannungsbewusst im Griff. Als ein einziger erntete er ein paar verhaltene Buhs, ansonsten umbrandete Sänger wie Regieteam tosender Schlussbeifall. Als Abschluss der Ära Wolfgang Wagner rauschte es noch einmal frisch auf dem Grünen Hügel - aber eigentlich regiert ja schon Katharina. |
|
Ein deutsches Epos Kritik von Toni Hildebrandt‘Zum Raum wird hier die Zeit’ – Wagners ebenso prophetisches, wie poetischstes Aperçu im Parsifal – hat in der neuen Bayreuther Inszenierung von Stefan Herheim eine erneute Wendung erfahren. Wagners sakral-mythologischer Raum wird zur deutschen Zeitreise, die uns vom wilhelminischen Kaiserreich bis zur Bonner bzw. Berliner Republik führt, und am Ende dabei auch eine humane, wenn auch äußerst fragwürdige Zukunfts(er-)lösung bietet. Die Überraschung beginnt bereits im Vorspiel, das Herheim entgegen der Intention Wagners szenisch kommentiert. Symbolik, Ödipuskomplex und politische Dimension werden hier subtil vorgestellt und als Material der Handlung ebenso eingeführt, wie die Leitmotive in der Musik. Kaulbachs ‘Germania’ hängt als böses Omen bereits an der Wand, und leiht später sowohl der Königin Herzeleide, als auch Kundry ihre rotblonde Haarpracht. Daniele Gattis Dirigat dehnt vom Vorspiel an stark die Tempi und passt dennoch in seiner bombastischen Schwere zu dem was in der Folge kommt. Das erste Bild ist grandios und wird Festspielgeschichte schreiben. Gleichsam zwischen Dekadenz und Feierlichkeit angesiedelt, liegt in pastellfarbenem Licht die Villa Wahnfried – Symbol der größten deutschen Hybris, wie größten deutschen Katastrophe, ist sie gleichsam Locus amoenus und Locus horribilis. Die Hauptfiguren werden majestätisch eingeführt und spätestens mit Amfortas (Detlef Roth) tritt die zentrale Tragik in persona in Erscheinung. Dessen Dornenkrone wirkt zwar zunächst befremdlich, erzeugt aber ein einprägsames Bild, das bis zum Finale das traurige Attribut des Königs bildet. Herheim, der prämierte Schüler von Götz Friedrich, zeigt sich als großer Theatermann und Bilderfinder. Seine Perspektiven und Bildwechsel sind überragend. Dabei muss er in Kauf nehmen, dass seine Opulenz immer wieder zum horror vacui neigt. Seine Inszenierung ist dadurch ohne Frage eine der komplexesten Parsifal-Deutungen geworden, da Herheim auf keine auch noch so marginale Bedeutungsebene verzichten wollte. Dabei lebt sein ikonologisches Bildfeuerwerk natürlich vor allem von visuellen Assoziationen und symbolischen Leitmotiven. Hier widerspricht er sich nicht mit Wagner, der ja letztlich das imaginär Bildliche als letzte, von ihm nur vorsorglich zu konzipierende, Stufe, im Auge hatte. Herheims simple, wie fantastische Idee, die deutsche Geschichte als Zeitebene den Raum konstitutiv begleiten zu lassen, funktioniert erstaunlich gut. Nur wenige Buhrufe stören sich nach dem ersten Akt an der Politisierung des Mythos. Auch wenn im zweiten Akt, die Hakenkreuz-Banner im Publikum zu Empörung, wie Gelächter führen, ist der Ausdruck im Einklang mit der Dramaturgie überzeugend. Wer hier wegsieht oder lacht, verspielt die Konfrontation mit der eigenen Geschichte, oder will nicht im sanften Symbolismus von Gralsmythos und sakralem Weihegeschehen gestört werden. Herheim ist darin konsequent und zieht seine Ideen durch, auch wenn sie notgedrungen Schwächen und Antipathien hervorruft. So überzeugt die Figur des Klingsor im Prinzip nur in ihrem ersten Auftritt, und auch das cineastische NS-Massaker hätte man intelligenter lösen können. Großartig ist bei aller unmittelbaren Skepsis der finale dritte Akt, in dem Herheim das Geschehen in den Bundestag verlegt. Zwischen dem grandios opulenten Chor von Eberhard Friedrich, der sowohl stimmlich massiv tönt, als auch szenisch eine gewaltige Spannung aufbaut, steht isoliert ein Amfortas als politischer Redner, nun etwas ungewohnt im Nadelstreifenanzug. Er ist der tragisch gezwungene Orator inmitten Wagners klassischem Chor. Wie schon Carl Dahlhaus erinnert auch Herheim daran, dass Wagner das Christentum rein philosophisch und das Theater antikisierend verstand. Hier sehen wir nun die zeitgeschichtliche Apotheose. Der ‘reine Tor’ Parsifal kommt hinzu und erlöst inmitten der ‘heutigen’ Politik den leidenden Amfortas, das gebeutelte Deutschland und das längst miteinbezogene Publikum. Macht sich da nicht Skepsis breit? Herheims Parsifal ist zum Ende scheinbar seltsam perfekt, sodass selbst die vereinzelten Buhrufer verstummen. Gesanglich und schauspielerisch bietet der Parsifal 2008 sowieso kaum Raum zur Kritik. Detlef Roth ausdruckstarker Gesang und seine fesselnden Blicke bannen den Betrachter und sorgen für die spannungsgeladensten Momente. Auch Christopher Ventris singt einen sehr guten Parsifal und spielt in herrlicher Metamorphose den ‘reinen Tor’ der ‘aus Mitleid wissend’ erwachsen wird. Kwangchul Youn als Gurnemanz erntet den meisten Applaus und auch Mihoko Fujimura überzeugt durchweg als eine Kundry, die in ihrer puppenhaften Zerbrechlichkeit, zunehmenden Verletzlichkeit und abnehmenden Rätselhaftigkeit, zur eigentlichen Sympathieperson des Stückes avanciert. Allein Thomas Jesatko bleibt mitsamt seiner Rolle als Klingsor eher blass. Danielle Gattis gedehnte Tempi und übermäßigen Generalpausen wurden viel kritisiert und bleiben letztlich wohl auch Geschmackssache. Für die Bayreuther Inszenierung erzeugen sie eine bedeutungsträchtig, tiefe Schwere, die der Dramaturgie immer wieder zu Gute kommt. Vergleichbar ist Gattis Ansatz dabei am Ehesten mit dem von James Levine (1982-1998). Die entscheidende Frage von Herheims Parsifal bleibt letztlich die nach der politisch-humanen Botschaft seiner Inszenierung. Die historische Konzeption hat doch in all ihrem Pathos einen entscheidenden Haken. Denn wem ist Parsifal am Ende eigentlich der Erlöser? Dem geeinten Deutschland, dem Status quo der Großen Koalition unter Angela Merkel oder gar der Zukunft unserer Erde – Fakt ist, dass Herheims glorreicher Optimismus in der Wirklichkeit kein adäquates Spiegelbild findet. Wenn im letzten Bild der symbolische Spiegel als Weltkugel auf den Zuschauerraum geworfen wird, sind es dann wirklich wir, die erlösen können oder erlöst werden? Und wovor? So grandios Herheims Finale auch inszeniert seien mag, die Utopie seiner humanen Botschaft ist nah am Kitsch. Bei Nietzsche, Schopenhauer und Wagner mögen solche Utopien noch vorstellbar gewesen, sein, doch nach dem Ende der großen Metaerzählungen, gilt doch ein Denken vielmehr einem differenzierteren Dialog – ein Denken, das diesem Parsifal fremd ist. Ist es nicht naiv zu glauben, ein Deus ex machina wie Parsifal könnte in der heutigen pluralistischen Welt zur Erlösung führen? Auch ein Barack Obama – der vielleicht eine solche Figur verkörpern möge – ist schließlich wahrhaft kein ‘reiner Tor’ und wird bei allem Wahlkampf nicht ernsthaft an seine selbstinszenierte Erlöserrolle glauben. |
|
Prachtvoll sinnliches Teatrum Mundi
Dass der deutsche Teufel mit einem norwegischen Beelzebub ausgetrieben wird - das befürchteten etliche Wagnerianer wohl nach dem "Parsifal" von Christoph Schlingensief. In den letzten vier Jahren hatte der Filmemacher und Performance-Künstler das Publikum schwindelig gemacht mit seinem auf der Drehbühne permanent rotierenden Geschehen, das alle Kulturen und Religionen auf vollgemüllter Bühne umfasste - wie geschaffen für einen Messie, weniger für einen neuen Messias. Doch die Bilderflut, die Stefan Herheim, Sohn eines Norwegers und einer Deutschen, mit seiner Bühnenbildnerin Heike Scheele erfunden hatte, war von anderer Qualität und Sinnfälligkeit. Sie überwältigte das Publikum bei der Eröffnung der diesjährigen Bayreuther Festspiele derart, dass es am Ende - noch in den Schlussakkord hinein - einhellige, lautstarke Zustimmung auch für das Regieteam gab, ohne ein einziges Buh! Dabei hatte es der Regisseur, der am 4. April nächsten Jahres an der Lindenoper in Berlin seine "Lohengrin"-Deutung präsentieren wird, den Zuschauern keineswegs leicht gemacht. Denn er beschränkte sich nicht auf die Schauplätze, die Wagner für sein "Weltabschiedswerk" vorgesehen hat, sondern erfand getreu dem Motto "Zum Raum ward hier die Zeit" für den ?Parsifal"-Kosmos eine großartige Reise durch die Geschichte - der Familie Wagner, Bayreuths und Deutschlands, vom Bau der Villa Wahnfried 1873 über ersten und zweiten Weltkrieg bis zur Eröffnung der ersten Nachkriegs-Festspiele 1951 und einer Plenarsitzung im deutschen Bundestag als Finale. Drei zentrale Orte überlagerten oder wechselten sich ab, die immer wieder - durch einen Zwischenvorhang abgetrennt - als Theater auf dem Theater funktionierten: das Gartenrondell der Villa Wahnfried samt Brunnenanlage - von innen wie von außen; ein herrschaftliches Schlafzimmer mit großem Bett sowie einem Kaminfeuer mit Spiegelkonsole und einer riesigen Flügeltür; dazu der Gralstempel, wie er 1882 bei der Uraufführung ausgesehen hat. Vor allem im ersten Akt wurden diese Schauplätze virtuos überblendet, bevölkert von Großbürgern beiderlei Geschlechts, allesamt mit den schwarzen Schwingen diverser Raubvögel auf dem Rücken, als seien sie gefallene Engel. Das ergab immer wieder magisch beleuchtete Situationen und Räume, in denen die von Gurnemanz erzählten Ereignisse Ereignis wurden. So betritt Klingsor durch den Spiegel die Bühne und attackiert Amfortas; seine Verführung durch Kundry wird ebenso gezeigt, wie Parsifal als Knabe, der der Mutter davonläuft. Stefan Herheim illustriert aber nicht nur die Rückschau von Gurnemanz, sondern antizipiert auch das Geschehen und zeigt etwa den kindlichen Parsifal erdrückt vom Hermelin des Amfortas - als würde er unter der Bürde als neuer Gralskönig bereits zusammenbrechen. Das alles muss der Zuschauer nicht Szene für Szene deuten, sondern kann sich der immer wieder zu großartigen Tableaux gerinnenden Bilderflut hingeben, zumal Herheim auch die Personen präzise führt. Schon das Vorspiel bebildert er eindrucksvoll und führt auf wundersam rätselhafte Weise in das Geschehen ein: Denn die sich vor Schmerzen windende Frau im Bett und der Knabe im Matrosenanzug könnten genauso der Schlusszene von Debussys "Pelléas et Mélisande" entsprungen sein - eine Oper, die sich musikalisch dezidiert auf den "Parsifal" bezieht -? wie das hier dargestellte Geschehen die Vorgeschichte von Wagners Bühnenweihfestspiel illustriert. Der zweite Akt begann in einer Art Krankenstation, wo Schwestern und leicht(bekleidet)e Mädchen die Wunden der verletzten Soldaten kühlten, später fleischgewordene Blüten Parsifal bedrängten, sich schließlich aber Herheim auf den großen Dialog zwischen Kundry und Parsifal konzentrierte. Dann aber ließ er zum Fluch der von Wagner als "Höllenrose" bezeichneten Kundry Hakenkreuzfahnen ausrollen und Nazis aufmaschieren. Das Kreuzzeichen, von Parsifal mit dem Speer geschlagen, machte diesen Spuk freilich zunichte, wie es den Reichadler zerschellte und das in der Luft liegende Buh des Publikums im Keim erstickte. Leider war der dritte Akt vergleichsweise konventionell inszeniert, abgesehen von wunderschönen Ideen, wie dem aus der Tiefe des Brunnens emporwachsenden Speer, der die heilige Quelle zunächst verschließt und dann frei sprudeln lässt. Dass aber Trümmerfrauen auf die Bühne gebeten werden und zum Karfreitagszauber bunte Lämpchen kitschig an der Rampe erstrahlen, zählte zu den wenigen Schwachpunkten der Inszenierung. Eigenartigerweise harmonierte Daniele Gattis extrem langsame, aber fast immer vom Bayreuther Festspielorchester spannungs- und klangvoll getragene Deutung mit diesen stetig im Fließen befindlichen Bildern, gab sie dem Zuschauer als Hörer die nötige Zeit zur Reflexion und zur Kontemplation und ermöglichte ihm, die Bilder in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Hervorragend der Festspiel-Chor. Der Abend ist mit etwa 3 ¾-Stunden reiner Spielzeit einer der längsten der Aufführungsgeschichte des "Parsifal" und doch erschien kaum etwas allzu gedehnt oder gar zerfasert. Nur die Sänger kamen manchmal an ihre atemtechnischen Grenzen wie auch - bei einigen allzu langen Fermaten -- die Musiker im Graben. Dabei sind die Protagonisten durchweg großartig besetzt: Allen voran Kwangchul Youn, dessen Gurnemanz sängerisch enorm vielschichtig und vital angelegt ist: kein alter, sondern ein gleichsam zeitloser Mann, der das Gewissen einer ganzen Gesellschaft verkörpert und doch fühlender Mensch geblieben ist. Er ist auch der Einzige, dessen Erscheinung im Verlauf des Stücks nicht variiert. Detlef Roth ist ein nicht minder überzeugender - wie vielfach in der Aufführungsgeschichte -- lyrisch und weich timbrierter Amfortas, der beim letzten Aufbäumen des siechen Gralskönig, der mit dem Leben abgeschlossen hat, mutig an die Grenzen des Sing- und Darstellbaren geht. Auch Mihoko Fujimura verkörpert eine großartige Kundry - mal Femme Fatal im roten Kleid oder Verführerin in Männer-Frack und silbernen Locken bis hin zur Büßerin in weißem Hemd und roten (!) langen Haaren. Stimmlich wirkt Fujimura allerdings etwas unausgeglichen, eine schöne Mittellage kontrastiert zur manchmal etwas schrillen Höhe und der etwas künstlich abgedunkelten Tiefe. Christopher Ventris ist ein eher heldischer Parsifal, der im Matrosen-Anzug des ersten Akts doch etwas seltsam wirkt, aber im Laufe des Abends an szenischer und musikalischer Glaubwürdigkeit gewinnt. Den spannendsten Theater-Coup behält sich Herheim für die letzten Minuten vor, wenn der große Spiegel über dem stilisierten Rund des Bundestags sich zum Publikum dreht und das Parkett wie den Dirigenten spiegelt, während hoch über dem Portal eine Taube gleissend zu leuchten beginnt - wie von Wagner gewollt - und das "Erlösung dem Erlöser" der Chöre in das Auditorium des amphitheatralischen Zuschauerraums zurückgeworfen wird: Vielschichtiger, aufregender und sinnlicher hat wohl niemand in Bayreuth den "Parsifal" je gedeutet. Klaus Kalchschmid |
|
Live aus Bayreuth, Rezension Stefan Herheim vollbringt ein Bayreuther Wunder zur Eröffnung der Festspiele 2008 – mit der Erlösung von Wagners Bühnenweihfestspiel aus seiner Rezeptionsgeschichte Von Barbara Winterstetter Endlich wissen wir, was „Erlösung dem Erlöser", die vieldiskutierten Schlussworte des Wagnerschen „Parsifal" bedeuten! Es geht um die Erlösung von unserer Bayreuth-Erwartung, um die Erlösung derjenigen, die seit Generationen dorthin auf der Suche nach dem Gral pilgern, auf der Suche nach der Ersatzreligion „Parsifal". Nun waren ja die Erwartung jener Pilger schon in den vergangenen vier Jahren einigermaßen gestört, als Christoph Schlingensiefs höchst assoziativer „Parsifal"-Deutung hier zur Selbstbeweihräucherung des Regisseurs mutierte. Doch weil Schlingensief als Ersatzgral viele eben nicht akzeptieren wollten, konnten die Gralssucher immer noch die Augen schließen und sich musikalisch erlösen lassen. Nur an Stefan Herheim kommt seit der Festspieleröffnung 2008 am vergangenen Freitag niemand mehr vorbei. Denn Herheim und sein Team stellen die Rezeptionsgeschichte des „Parsifal" inhaltlich wie optisch fesselnd auf die Bühne und verpacken ihre Erlösungsbotschaft am Schluss so raffiniert, dass alle begeistert sind. Nicht nur, weil es am Schluss eine Glaskugel als Globus gibt mit einer leuchtenden Friedenstaube drüber, die uns globale Erlösung offeriert, sondern auch, weil anstelle des Grals am Schluss ein Kind auf die Bühne tritt: Das Leben siegt über die Kunst, das unverdorben Neue über das Bühnenweihfestspiel! Vielleicht haben viele der enthusiastischen Klatscher dabei gar nicht gemerkt, dass das in Bayreuth eine ganz schön mutige Botschaft ist: Die Erlösung kommt nicht aus Wagner, nicht aus dem Bühnenweihfestspiel, nicht aus Parsifal (der mitsamt Speer nach unten abfährt), sondern aus dem neuen Leben. „Kinder macht Neues" rief Wagner selbst enthusiastisch. Endlich passt dieser Satz so richtig. Aber fangen wir von vorne an: Herheim hat die Auseinandersetzung mit „Parsifal" und der Festspielgeschichte zum Grundthema einer runden, vielschichten, tiefsinnig durchdachten Deutung gemacht, die seit Chéreaus „Ring" 1976 das Beste ist, was das Regietheater in Bayreuth hervorgebracht hat. Pralles Theater, aber auch Stoff zum Nachdenken und Nachwirken lassen. Das Schöne dabei: Herheim erlöst nicht nur die pilgernden Fangemeinde von überkommenen Grals- und Heilsvorstellungen, sondern auch die Festspiele von der Patina der letzten Jahre, von (mit wenigen Ausnahmen) oft mühsamen Versuchen, hier neue Dimensionen im Werk Wagners zu erkennen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem auch der Wechsel in der Festspielleitung klar auf dem Tisch liegt und ein spürbar frischer Wind über den Hügel fegt. Dabei setzt Herheim auf drei Ebenen: Aus der psychologisch dichten Geschichte des reinen Toren Parsifal, der zu Selbstreflektion fähig ist und sich immer wieder neu erschafft, wird die Geschichte der deutschen Nation, die ihre verschiedenen Erlöserfiguren aufzuarbeiten hat. Optischer Rahmen und Kern der Deutung aber ist Bayreuth selbst: Auf der Bühne steht – übrigens in atemberaubenden Bühnen-und Kostümvisionen (Heike Scheele und Gesine Völm) – Richard Wagners Wahnfried, mal von innen, mal von außen, was eine geniale Bühnentechnik ermöglicht (technische Leitung: Karl-Heinz Matitschka). Hier in Wahnfrieds Saal stirbt schon zu Beginn des Vorspiels Parsifals Mutter Herzeleide. Oder ist es die greise Cosima? Im Vordergrund prangt das ganze Stück über Richard Wagners Grab, aus dem bezeichnenderweise der heilige Gral geholt wird und zum Schluss das neue Leben geboren wird. Im Gralstempel begegnen wir dann – zugegebenermaßen gerührt – dem Uraufführungs-Bühnenbild Paul von Joukowskis wieder, jener wunderbar mediterranen Eingebung, die vom Dom zu Siena beeinflusst war. Soviel also zu den Zitaten aus Bayreuths höchst erfolgreichen Festspiel-Anfänge im Jahr 1882, die man nach dem umstrittenen und finanziell misslungenen „Ring" 1876 dringend brauchte . Die geniale Idee, den Parsifal als Testament zu deklarieren und als „Bühnenweihfestspiel" einzig an die Bayreuther Bühne binden zu wollen (was trotz Cosimas Eingabe im Reichstag misslang), war nichts als die eigennützige Idee, die Festspielidee als Institution etablieren zu wollen. Den „Parsifal" aber als erstarrte Ersatzreligion – das hätte auch Wagner mit seinem „Werk von göttlicher Wildheit" nicht gewollt. Herheim geht geschichtlich aber noch weiter: Er zeigt das Festspielhaus auch als Ort der „Kunstentweihung", was noch heute in der Literatur nur sehr schwer zu finden ist. Im zweiten „Parsifal"-Aufzug begegnen uns nicht nur verwundete Krieger (die hier in den letzten Kriegsjahren zu finden waren), sondern auch bunte Revuegirls als Blumenmädchen. Sie erinnern an die Zeit der Festspielhaus-Beschlagnahmung, an Puccini und amerikanische Revuen zur Unterhaltung der GIs. Hier setzt sich Herheim auch kurz mit dem dritten Reich auseinander und zieht Hakenkreuz-Fahnen auf, was eben auch zum dunklen Teil der Festspielgeschichte gehört. Der dritte Aufzug konfrontiert uns folgerichtig mit dem zerstörten Wahnfried, mit Trümmerfrauen zum Karfreitagszauber und mit dem Neubeginn durch Wieland und Wolfgang im Jahr 1951, dem ersten Versuch, dem weihevollen „Testament" des Großvaters zu entkommen – was bei Herheim beeindruckend durchs Einmauern von Wagners Totenmaske via Projektion geschieht. Das Schlussbild erinnert nicht umsonst an die klaren Wieland-Bauten etwa für die „Meistersinger"-Festwiese. Eigentlich aber befinden wir uns hier im Bundestag: Die Gralsritter, die sich im ersten Aufzug zu den Soldaten des 1. Weltkriegs gewandelt hatten, begegnen uns wieder als diskutierende Parlamentarier unserer Demokratie, von der uns Herheim schließlich auch noch mit seinem globalen Schlussbild erlöst – und das vor versammelter Premieren-Politprominenz. Dieser Durchlauf durch die deutsche Geschichte, den das Regie-Team ausgehend von der Parsifalgeschichte als Ausweitung von der individuellen zur kollektiven Identitäts- und Heilsuche begreift, ist höchst raffiniert ins Werk eingebaut, ohne jemals aufgesetzt zu wirken. Hier begegnen wir dem wilhelminischen Zeitalter in einem Rauch aus Kostümen (angelehnt unter anderem an Wagnersche Familienfotografien), der dem ersten Aufzug schon fast heitere Dimensionen gibt und keinesfalls abgestandenen Weihrauchgeruch. Auch weitere historische Zitate – wie etwas die Aufarbeitung der Hitler-Zeit – geschehen hier knapp, aussagekräftig und dabei angenehm unbelehrend. Das größte Kunststück dieser Produktion: Sie ist in ihrer Fülle aus Denkansätzen, in ihren überbordenden Bühnenbildern niemals dezidiert auf Botschaft und den erhobenen Zeigefinger bedacht. Im Gegenteil: Man darf das pralle Spiel an sich auch immer wieder in seinen vielen Details genießen, darf sich über das Amfortas-Bild mit dem Hermelinmantel Ludwigs II. ebenso freuen wie über den Fantasy-reifen Auftritt Klingsors im ersten Akt zur Gurnemanz-Erzählung. Dass in dieser Inszenierung die Musik ein wenig in den Hintergrund tritt, liegt indes nicht am Regie-Team. Daniele Gatti macht zwar mit extrem gedehnten Tempi auf sich aufmerksam, ohne sie jedoch wie einst James Levine mit berstender Spannung zu füllen. Auch wenn Gatti so manch italienische Kantilene entdeckt und das wunderbare (in den Bläsern allerdings nicht hundertprozentig intonationssichere) Festspielorchester exakt dirigiert, bleibt seine Interpretation doch zu brav. Aus der Sängerriege gibt es Hochs und Tiefs zu vermelden. Wunderbar der perfekt artikulierende und seine Stimme modulierende, niemals laute oder pathetische Gurnemanz von Kwangchul Youn. Und Detlef Roth als Amfortas singt mit Kunstlied-geschulter Stimme trotz chromatischer Schmerzzerrissenheit auch klangschön, rund und frisch. Beide Interpretationen eignen sich perfekt, um das Weihespiel auch sängerisch von so manch triefendem Pathos einstiger Interpretationen zu erlösen. Christopher Ventris schließt sich dem als Parsifal an: Er gestaltet sicher auch in der Höhe, auch wenn seinem Tenor noch Glanz und das unverkennbare Timbre fehlt. Darstellerisch gut, aber stimmlich zu sehr bellend: Thomas Jesatko als Klingsor. Und leider zeigte sich auch Mihoko Fujimura der Partie der Kundry nicht gewachsen. Sie kann mit ihrem Körper unglaublich ausdrucksstark agieren, doch die Stimme ist zu, die Einzeltöne wirken zu sehr (und in der Höhe auch zu mühsam) fokussiert, um für den zweiten Akt die große Linie zu finden. Schade – nach ihren Bayreuther Glanzstunden mit Fricka und Erda. Nicht zu vergessen: Blumenmädchen, Knappen, Gralsritter und der ausgezeichnete Festspielchor – allesamt auf hohem Niveau. Ein Abend, der bleiben wird in der Geschichte der Festspiele, weil er uns fordert, anregt, bewegt. Endlich! |
|
Abroad By MICHAEL KIMMELMAN
Waltraud Meier topped a remarkable cast in Wagner’s "Tannhäuser" in Baden Baden the other night, although the current talk of the opera season in Europe is the promiscuous new production of Wagner’s "Parsifal," not too far away, that opened the Bayreuth Festival on Friday: it comes a jackboot shy of "Springtime for Hitler," but its ambitions soar, and so do many of the voices. You may recall that the festival ended last year with the aged Wolfgang Wagner (grandson of Richard) still clutching the reins of power after more than 50 years while plotting the succession of his young daughter, Katharina. Her Bayreuth debut as director, of "Die Meistersinger," was a spectacular flop, overstuffed with ridiculous ideas, that opened and closed the season. The indelible image was of the would-be heiress, a tall blonde in a slinky gown, waving imperturbably to an angry mob. Now the curtain is up on a new season, and the same "Meistersinger" was broadcast live on Sunday outdoors to thousands of sweltering people in town, a first for this notoriously exclusive festival. The possibility has lately arisen of Katharina collaborating with her older half-sister, Eva, after Wolfgang steps down. Meanwhile she has been named director of a "Tristan und Isolde" to open in 2015, with Christian Thielemann conducting. For "Parsifal," the usual opening-night crowd — it included the German chancellor; various graying, midlevel Bavarian celebrities; and assorted shlumpy journalists — sat rapt for more than four and a half hours (this was one of the slowest "Parsifal" ’s on record), then applauded rapturously. Gary Smith, the executive director of the American Academy in Berlin, afterward likened the reaction to the German swoon over Barack Obama last week. Wolfgang Wagner being on the way out at the end of August, everyone clearly is ready to move on and embrace whatever’s next. The production is about change, as a matter of fact. Stefan Herheim, the 38-year-old Norwegian director, liberates this Christian saga about purification from its nasty associations with anti-Semitism and remakes it into a metaphor for modern Germany. This is not in itself a new tack for a country that for decades has been wrestling on opera stages with its history, but simultaneously Mr. Herheim has reconceived "Parsifal" as an allegory for Bayreuth itself. The opera unfolds at Wahnfried, Wagner’s home there, with the prompter’s box turned into the composer’s grave and site of the Holy Grail. A bed, placed center stage, where Parsifal’s mother dies and Kundry fails to seduce our boyish hero, is the locus of more comings and goings than a bedroom in a French farce, and it’s the obvious symbol of birth and death. Gone are the long Wagnerian stretches of inaction. Sets and singers are in constant motion. Scenes of Wilhelminian Germany vanish before filmed backdrops of World War I, then yield to orgies of Weimar decadence, with Flower Maidens cast as copulating showgirls, nursing convalescing troops of Grail knights. The evil Klingsor wears fishnet stockings and high heels; Parsifal, a child’s sailor suit. You have to admire the singers’ sang-froid. Most startling was to hear straight-faced, seasoned Bayreuth fans during intermission express surprise at the sight of Wehrmacht soldiers and Nazi banners during Act II, recalling old days at the festival. It all seemed so inevitable. Postwar ruin, gorgeously imagined, then morphs in the finale into the Bundestag in Bonn, with torpid knights as politicians, and Wagner’s death mask, projected, floating in a ghostly ether. By this point, it’s hardly worth troubling yourself to parse how, precisely, Parsifal — having gone on his quest of sacrifice and knowledge, to return weathered and wise and save the day — serves the metaphor of a newly reunited German democracy and a refreshed Bayreuth. Redemption, suffice it to say, rewards those who, having squandered glory to false idols, face squarely the past. A large mirror turns toward the audience, implying our own obligations to history. Or some such. Mr. Herheim’s production, with dreamlike sets by Heike Scheele, arrives after a pilloried "Parsifal" by the provocateur Christoph Schlingensief, and after many years before that of modernist performances that skirted the opera’s less tasteful narratives. The new version clearly signals deliverance from all that, its solipsism well suited to Bayreuth’s insular culture. In the end, it is moving. Directors get away with half-baked ingenuities because opera plots already require suspended judgment — and because of the music. Under Daniele Gatti’s baton, the score unwinds in grave and luxurious fashion. The Bayreuth chorus is peerless, as always. Christopher Ventris, as an ardent Parsifal; Detlef Roth, the touching Amfortas; and Kwangchul Youn, a brooding Gurnemanz, make for unexpected stars. Mihoko Fujimura, notwithstanding the straining in her upper reaches, is the desperate, heartbreaking Kundry. If someone at Bayreuth could sift through Mr. Hernheim’s bounty of ideas, this might yet become a great production. That task presumably will fall to whoever succeeds Wolfgang Wagner. Anticipating this new day at Bayreuth is lovely, but ultimately the temple of German art should be held only to the highest standard. A German critic during intermission, reflecting the general view among his native colleagues, waved off reservations about the inchoate parts of this "Parsifal" by remarking that novelty gives him something to write about and is obligatory in the German opera world today, where directors are the headliners. He dismissed the production of "Tannhäuser" at the Festspielhaus in Baden-Baden as a consolation prize for rich people who couldn’t get tickets to Bayreuth. Not really novel, he said. How the German scene got itself into this pickle is a long story. Nikolaus Lehnhoff, who decades ago at Bayreuth assisted Wieland Wagner, Wolfgang’s brilliant brother, directs "Tannhäuser" in the vein of a traditional modernist. His concept is as spare and inert as Mr. Herheim’s "Parsifal" is delirious and mesmerizing. Action is kept to a minimum. Gestures are measured. The set, a legacy of Wieland’s aesthetic, consists of a black box studded with a grid of pinpoint lights and a wide ramp, like the Guggenheim’s spiral, suggesting sensuality and spirituality, nature and consciousness entwined. The effect is dour, severe, but attention is thereby turned toward the singers and the music, which, after all, are the point. The Deutsches Symphonie-Orchester Berlin outdid itself under Philippe Jordan on Sunday. Robert Gambill handled the title role’s exhausting demands with energy and élan. Stephen Milling’s bass (Mr. Milling is Herrmann) filled the enormous Festspielhaus, and Roman Trekel brought unusual poise to the subtle part of Wolfram. These days, "Tannhäuser" seems a creaky affair, but you can say its mix of religious fervor and desire happens to be a timely parable for Bayreuth now. Its performance comes down to the female antagonists. Camilla Nylund excelled as the chaste Elisabeth, and Ms. Meier, a musician with deep reserves of force and a gift for madness, was the perfect Venus. |
|
FINANCIAL TIMES Transformations of a nation By Andrew Clark More than 60 years after their last official appearance, Nazi banners returned to the Bayreuth stage on Friday in the middle of the Wagner festival's new Parsifal. After a moment of shock you could sense the first-night audience (led by German Chancellor Angela Merkel) breathing a collective sigh of relief. In the late 1930s and early 1940s swastikas bedecked the Festspielhaus. Getting into bed with Hitler was Bayreuth's darkest hour - something it has hitherto refused to acknowledge, partly for fear of jeopardising its commercial success, partly because the Wagner family's support for Hitler is a can of worms. The sense of atonement on Friday, in an opera about redemption, was palpable. At last the festival could talk openly about what had for so long been taboo.
The show unfolds on a set of the composer's townhouse, Wahnfried, with his grave front-of-stage (it actually lies in Wahnfried's garden). The house symbolises not just Wagner's dreams but the ideals of the 19th-century fledgling German state. Herheim turns it into a projection-screen on which are traced the parallel transformations of Wagner's legacy and the German experience. Act One starts as a fascinating pantomime of birth and death - the past and present uniting in Parsifal's eyes - while the knights of the Grail metamorphose from an angelic bourgeoisie into a nation bent on expansion. The original 1882 Temple of the Holy Grail, calcified by Wagner's followers, provides a backdrop for first world war footage. Act Two portrays the "perversions" of Weimar Germany - Klingsor as a transvestite, the Flowermaidens as showgirls/nurses copulating with wounded soldiers - before the arrival of Wehrmacht troops and Nazi banners, the most powerful ammunition Kundry can throw at Parsifal's purity. Act Three unfolds against a bomb-shattered Wahnfried and the ban on political discussion at the first postwar festival. The knights are Bonn politicians debating Germany's frustrated quest for wholeness. The finale turns a gaze on the audience: only by coming to terms with our past can we make something of the present. As a portrait of a nation that has repeatedly sold its soul to figures promising redemption, it's an interpretation of enormous daring. You can't help being impressed by its technical finish: the designs by Heike Scheele, Gesine Völlm, Ulrich Niepel and video company fettfilm draw on all sorts of 19th- and 20th-century cultural iconography. Sceptics should be reassured by Herheim's ultra-musical direction of his cast, led by Christopher Ventris's boy-like Parsifal, Mihoko Fujimura's intense Kundry, Diogenes Randes's noble Amfortas, Kwangchul Youn's Gurnemanz and Thomas Jesatko's Klingsor. Daniele Gatti conducts a wonderfully flexible reading, distinguished by long cantilenas. Herheim may occasionally overload, but everything is thought through and the swastikas are onstage only long enough to make their point. The performance works on so many levels that you emerge challenged and stimulated: Bayreuth at its best. |
|
Parsifal
Bayreuth's Wagner productions no longer set the standard as they once did. But Stefan Herheim's production of Parsifal, which opened this year's Bayreuth festival, redresses the balance at a stroke. Herheim's production continually poses the direct question of whether Wagner's own Bayreuth legacy - like the decaying world of the Grail knights in Parsifal - can ever be morally cleansed. In pursuit of an answer, Herheim takes us on a formidably ambitious journey through a dazzlingly inventive theatrical deconstruction of Parsifal, of German history, of Wagner and, above all, of the way they are woven together in Bayreuth itself. The curtain rises, to the accompaniment of the prelude, on black-winged angels surrounding a morbidly erotic deathbed scene in Wagner's own Wahnfried house in Bayreuth, from which a young but traumatised boy in a sailor suit flees out into the world. This is the first step in an unfailingly fascinating path through a forest of symbols and allusions, including to Parsifal's own stage history, that takes us from Wagner's lifetime, through the first world war and the Third Reich and on to postwar Germany and the present day. The journey ends with the audience, which on the opening night contained not just several generations of the Wagner family but Chancellor Angela Merkel and the captains of German politics and industry, staring itself in the face in a gigantic stage mirror as the survivors look out at them from beside Wagner's grave. The answer to Herheim's question is that the solution lies in Bayreuth's own hands. Daniele Gatti conducted a very deliberate reading of the score, with stalwart performances by Kwangchul Youn as Gurnemanz, Mihoko Fujimura as Kundry, Christopher Ventris as Parsifal and Thomas Jesatko as Klingsor. But this was overwhelmingly Herheim's evening. |
|
Swastikas Fly, Nazis Parade Again at Bayreuth Swastika banners unfurl over the stage, Nazi SS officers goose step in formation. It has been awhile since Bayreuth looked like this. Scattered boos from the audience augment the score of Richard Wagner's "Parsifal". A new era is dawning at Bayreuth's annual Wagner festival. And parts of it look unnervingly like the old one. That is Stefan Herheim's whole idea. The Norwegian stage director tells ``Parsifal'' as an image-laden trip through German history. The opera becomes a narrative of Wagner's reception, from the composer's troubled youth to the political wrangles of the German republic in Bonn and Berlin. Most of the action plays out in Bayreuth itself, the living room of Villa Wahnfried, Wagner's house, mutating with the passage of time. In the end, Herheim holds up a mirror to the audience itself. Literally. The booers numbered only a handful amid an enthusiastic public. The July 26 opening of the Bayreuth Festival drew a glittering crowd. Chancellor Angela Merkel; former Foreign Minister Hans-Dietrich Genscher; Guido Westerwelle, the head of Germany's Free Democrats; and an elite selection of television and stage personalities drew gaping onlookers in the afternoon bustle before the six-and-a-half-hour performance began. Tottering on the arm of his statuesque daughter Katharina, 30, who is tipped to take over the festival together with half- sister Eva Wagner-Pasquier, 63, in August, 88-year-old Wolfgang Wagner welcomed the big-name visitors. The Bayreuth public, exhausted by years of family dramas and power struggles, is ready for a change. That was evident in the warm response to Herheim's frenetically didactic ``Parsifal.'' Nazi Legacy Not all of Herheim's gestures are new. Indeed, many have become almost obligatory for provincial German houses dutifully working through a post-1968 approach to the Nazi's legacy of dubious Wagner interpretation. But the richness and psychological depth of Herheim's images and the seamless musicality with which he and his team have knitted them together add up to an evening of breathtaking impact. Wagner's tale -- the ignorant Parsifal meets the knights of the Holy Grail, sets out on a quest, resists temptation, vanquishes the evil Klingsor, wins wisdom, redeems and replaces the ailing King Amfortas -- is layered with complex reflection. The course of history, the nature of death and birth, the role of sexuality and eroticism in society, and the question of individual identity are all explored. It could be tedious if it were not so exquisitely wrought. Seduction Scene At the center of the stage is a bed, deathbed of Parsifal's mother, place of his birth, scene of seduction. The prompt box is Wagner's grave, or the home of the Holy Grail, a place of mysterious magnetism. Herheim's handiwork is dazzling, Heike Scheele's sets are a work of genius. Hours of stage magic unfold with dazzling skill. Italian conductor Daniele Gatti makes his Bayreuth debut memorable for what may be the slowest "Parsifal" on record (4 hours and 40 minutes, not counting the intervals). To his credit, it seldom drags, and the high points burn with focused intensity. The Bayreuth orchestra does not play its best for Gatti, and neither transparency nor sharp edges feature prominently. Instead, he opts for organic development, lush curves and whispered pianissimi. Gatti listens attentively to his singers, and makes sure that we hear their every word. Animal Power These singers are worth hearing. In the title role, Christopher Ventris offers no-holds-barred heroism and seductively effortless sounds delivered with charisma and command. Detlef Roth's Amfortas is worldly wise and rich in detail, Kwangchul Youn's Gurnemanz makes every word of his marathon monologues grippingly emotional, and if Mihoko Fujimura occasionally screeches a top note or slurs her diction, her performance as Kundry has such animal power and psychotic diversity that it's worth a small vocal trade-off. For Katharina Wagner, who is plowing ahead with the business of marketing her own image to the universe as Bayreuth's blonde savior, this is a promising start to an era that is already her own in all but official terms. Whether one successful staging is enough to baptize herself a world-class festival director is open to debate. Half-sister Eva was conspicuously absent from the opening-night celebrations, and the degree to which she will play a role in Katharina's festival is equally open to speculation. Plenty is wrong in Wagnerian Bayreuth, but after Friday it is clear that some things can still be entirely right. Rating: **** Shirley Apthorp is a critic for Bloomberg News. The opinions expressed are her own. What the Stars Mean: |
|
Un Parsifal politiquement correct De notre envoyé spécial à Bayreuth Pour la 97e édition du Festival de Bayreuth,le Norvégien Stefan Herheim évoque la rédemption de l'Allemagne à travers la nouvelle production du chef-d'œuvre de Wagner. Fidèle au rituel, le 97e Festival de Bayreuth, qui devrait être le dernier dirigé par l'inamovible Wolfgang Wagner (lire ci-dessous), s'est ouvert à 16 heures vendredi. Les badauds s'étaient massés à l'entrée du Festpielhaus en haut de la " colline verte " pour assister au ballet des voitures officielles amenant les personnalités vers ce lieu mythique de la culture allemande. Autour de la chancelière Angela Merkel et son mari Joachim Sauer, vrais mélomanes, se pressaient hommes politiques (les élections approchent en Bavière) et célébrités en tout genre. Si cette édition doit marquer la fin du " règne " du petit-fils du compositeur, qui fêtera ses 89 ans l e 30 août, deux jours après la fin du festival, elle constituait les débuts à Bayreuth du chef italien Daniele Gatti et du metteur scène norvégien Stefan Herheim, qui présentaient leur version de l'œuvre ultime de Richard Wagner. Achevé un an avant la mort du compositeur, Parsifal a été créé au Festpielhaus en 1882. Testament lyrique du maître des lieux, l'œuvre a été sacralisée par sa veuve, Cosima, qui en avait interdit la représentation sur d'autres scènes et a ensuite banni de Bayreuth les chanteurs ayant osé l'interpréter ailleurs, après que New York a, en 1903, passé outre le diktat. Autant dire que s'attaquer à Parsifal à Bayreuth n'est pas une mince affaire, d'autant plus que le message de l'œuvre, à la confluence de plusieurs légendes, le Juif errant, le mythe du Graal, et inspiré de sources aussi diverses que le bouddhisme ou Schopenhauer sans oublier bien entendu Chrétien de Troyes , fait l'apologie de la race pure. En tout cas, c'est ainsi que le Reich, ses dirigeants et une partie de la famille Wagner l'avait en compris. " Ici prévaut l'art " Avec une provocation tout à fait calculée et un rien démagogique, Stefan Herheim a décidé de se servir de l'opéra pour en faire une saga de l'histoire de Bayreuth en particulier et de l'Allemagne en général. Dans des décors réplique de la " Wahnfried ", la maison des Wagner à Bayreuth, le jeune Norvégien se lance dans une chevauchée héroïque à travers l'histoire transformant Parsifal en restaurateur de la démocratie face aux nazis qui déploient le drapeau à croix gammée sur scène. Au premier acte, l'accent est lourdement mis sur les rapports névrotiques qu'entretiendraient les personnages, dans une lecture freudienne assez sommaire et très romancée du livret qui se situe à la frontière du rêve (les personnages ayant été affublés d'ailes) et de la réalité. Le tout s'appuie sur une mise en scène multipliant les mouvements de décors et l'utilisation de trappes au détriment de l'attention que l'on pourrait porter à la musique et au chant. Le deuxième acte, c'est devenu un cliché, se déroule dans un hôpital, moitié lupanar, moitié boîte de nuit, où le chevalier déchu Klingsor en porte-jarretelles sert de meneur d'une revue très Folies-Bergère. Nietzsche estimait que " Parsifal était une trame pour une opérette ". La mise en scène semble adopter ce point de vue. La rédemption spirituelle oubliée, le troisième acte est celui de l'avènement de la démocratie bénie par un Parsifal qui apaise les maux d'Amfortas mais aussi les querelles au Bundestag. Une soupe théocratique qui enthousiasme un public, auquel le metteur en scène a servi le brouet politiquement correct qu'il attendait, en inscrivant en surimpression sur le décor la devise " Ici prévaut l'art ". Formule habilement trouvée par Wieland et Wolfgang Wagner en 1951 pour la réouverture d'un Bayreuth dénazifié. Daniele Gatti, en revanche, a reçu sa, petite, part de huées. Il est vrai que le nouveau chef de l'Orchestre national de France a semblé se laisser guider plus qu'il n'a imposé une véritable tension. Il a choisi des tempi très longs, son Parsifal dure près de 4 h 40, une heure de plus que celui de Boulez, sans vraiment transformer cette durée en émotion. La distribution est de bonne qualité, notamment Detlef Roth qui campe un roi Amfortas douloureux et humain, et Kwangul Young un Gurnemanz noble. Mihoko Fujimura est un peu moins convaincante, le timbre est magnifique mais la voix un peu trop petite pour le rôle de Kundry. Christopher Ventris est un Parsifal sombre et très expressif, avec cependant des aigus un peu difficiles. Reste que ce Parsifal est loin, très loin, du " Bühnemenweihfestpiel ", " le festival scénique et sacré " voulu par son auteur.
Neuf ans d'attente pour une place à 132 € La succession de Wolfgang Wagner alimente toujours les conversations alors que le festival s'entrouvre à un autre public. J.-L. V.
Quelques nouveautés, cette année à Bayreuth, pour le 97e festival qui se tient traditionnellement depuis 1989 du 25 juillet au 28 août. Comme chaque année, les 58 000 tickets ont été vendus à des heureux élus venant de 80 pays. Près de 450 000 demandes (447 240 pour être précis) ont été reçues. L'attente peut ainsi durer neuf ans pour les amateurs qui veulent entrer dans l'enceinte mythique du Festpielhaus. Cette salle comporte 1 974 places dont les prix s'échelonnent entre 208 et 13 €, pour une moyenne de 132,40 €, ce qui reste modeste par rapport à Salzbourg ou même Aix où les places les plus chères pour écouter Wagner s'élevaient cette année à 350 €. Cette année, le festival tente une petite ouverture. Hier, 15 000 personnes pouvaient suivre gratuitement la reprise des Maîtres chanteurs de Nuremberg mis en scène par Katharina Wagner sur un écran géant près de l'hôtel de ville de Bayreuth. Une opération payante et limitée à 10 000 mélomanes préinscrits permettait également de se connecter sur Internet, pour une retransmission également en direct. Une autre porte étroite pour assister aux représentations consiste à se syndiquer. Depuis 1951, le festival organise pour le DGB, la principale centrale syndicale allemande, deux séances privées au tarif préférentiel de 80 €. Mais le taux de syndicalisation élevé rend cette voie aussi difficile que le parcours normal. Cette année, outre Parsifal et LesMaîtres chanteurs, les autres productions reprises au Festspielhaus sont Tristan et Isolde dans la mise en scène du Suisse Christoph Marthaler et Le Ring dans celle de l'Allemand Tankred Dorst. Comme chaque année encore, le feuilleton sur la succession de Wolfgang Wagner alimente les conversations. Ses deux filles, nées de deux mariages différents, Eva, 63 ans, et Katharina, 29 ans, devraient lui succéder puisqu'il a enfin consenti à se retirer après cinquante ans de règne. Nike, la fille de Wieland, frère décédé de Wolfgang, reste cependant en embuscade. Évincé de l'arrangement concocté par son oncle, elle a appelé à un débat public. Imperturbable, Wolfgang Wagner a offert aux photographes et aux cameramen son visage habituel sous son fameux casque de cheveux blancs, comme si de rien n'était. |
|
Opéra. Festival de Bayreuth Nicolas Blanmont Stefan Herheim met en scène une version foisonnante et kaléidoscopique de l'ultime opéra de Wagner. La direction de Daniele Gatti séduit et trouble. On en oublierait presque d'écouter la musique. Parsifal" symbolisa longtemps la tradition à Bayreuth : l'ultime opéra de Wagner, qui allait disparaître un an plus tard, fut créé ici en 1882 et, jusqu'en 1914 (la protection du droit d'auteur était alors de trente ans), interdit de représentation ailleurs. Hormis l'exception de Götz Friedrich en 1982, on ne confia l'ouvrage qu'à des membres de la famille, jusqu'à ce que Wolfgang Wagner, après avoir laissé sa (deuxième) production à l'affiche pendant douze ans, décide sans crier gare de confier le graal à un cinéaste peu connu, vierge de tous états de service lyriques mais provocateur patenté. Ce fut, en 2004, le scandale Schlingensief, un "Parsifal" animiste, mondialiste mais surtout extraordinairement confus, éculé et puéril : sa seule vertu était de ne pas durer trop longtemps, Pierre Boulez étant dans la fosse et enfilant ses trois actes en trois heures cinquante là où certains en prennent presque une de plus. Boulez parti, on termina d'amortir la chose puis, à la demande générale, après seulement quatre ans de mauvais et déloyaux services, on l'évacua aux oubliettes pour confier "Parsifal" à... Wolfgang ? Katharina ? Nenni. Stefan Herheim, jeune metteur en scène norvégien dont le principal titre de gloire international jusqu'ici était un "Enlèvement au sérail" quelque peu coquin voire franchement trash à Salzbourg et qui, en décembre prochain, montera "Rusalka" à la Monnaie. Inventif mais - trop - chargé Alors, on hue ? On hue, on siffle, mais on applaudit aussi, car Herheim signe un spectacle encyclopédique, foisonnant, polysémique, kaléidoscopique, coloré, inventif, technologique, assurément trop chargé - cela devient une tendance lourde à Bayreuth, après Schlingensief et Katharina - mais brillant. Impossible de raconter tout ce qui, dès le prélude, se passe sur scène. Cela commence avec la mort d'Herzeleide au milieu du salon d'une maison bourgeoise (la villa Wahnfried de Wagner, bien sûr), veillée par un couple de serviteurs (Gurnemanz et Kundry) sous les yeux du médecin et du prêtre (deux chevaliers du Graal), et d'un Parsifal de dix ans habillé en petit baigneur, qui préfère aller jouer avec son arc au jardin que d'être confronté à ce moment pénible, et cela se termine avec un immense miroir rond qui vient refléter le public dans la salle (et même, furtivement, l'orchestre invisible). Entretemps - quatre heure vingt de musique - on aura raconté l'histoire allemande, de la guerre de 1870 jusqu'au Bundestag (discours d'Amfortas devant les chevaliers) en passant, bien sûr, par la boucherie de 14-18 (le château de Klingsor est un hôpital de campagne), l'époque nazie et le mur, on aura multiplié les références à divers aspects de l'oeuvre wagnérienne et, dans le lit d'Herzeleide (cachant une trappe), on aura vu défiler à peu près tout le monde, avec ou sans elle. Entre Parsifal adulte habillé en enfant et Parsifal enfant, entre Kundry qui prend l'apparence d'Herzeleide ou de Klingsor, on décline les lectures à tous niveaux : freudien, historique, politique, religieux, artistique et tout le reste. Le public s'accroche à ses jumelles, rit parfois, s'agace ça et là et se pose des questions tout le temps. Les tenants de la tradition détestent, évidemment, les autres oscillent entre admiration et adoration. Seul défaut majeur : ce flot d'images, même s'il se ralentit au fil de la soirée, ferait presque oublier d'écouter la musique. Dommage, car la direction de Daniele Gatti, pour n'être pas dramatique, séduit par sa noblesse, sa douceur venimeuse, ses silences et sa façon d'onduler. Bon plateau, crédible et solide à défaut d'être exceptionnel : Kwangchul Youn (Gurnemanz), Detlef Roth (Amfortas), Mihoko Fujimura (Kundry) et, dans le rôle titre, Christopher Ventris. 57 ans de règne Ce "Parsifal" éminemment germanique sera donc l'ultime production du règne de Wolfgang Wagner, le plus long de l'histoire du festival de Bayreuth. Nommé en 1951 pour relancer avec son frère le festival dénazifié, resté seul aux commandes depuis la mort de Wieland en 1966, Wolfgang sera parvenu à se maintenir, réussissant un grand écart assez étonnant entre ses propres mises en scène, assez conservatrices et souvent même banales, et celles des metteurs en scène les plus novateurs, voire provocateurs, qu'il aura invités et défendus dans le temple du culte familial : Chéreau pour le Ring du centenaire en 1976, mais aussi Harry Kupfer, Heiner Müller ou, plus récemment, Christoph Schlingensief, Claus Guth, Christoph Marthaler et, aujourd'hui, Stefan Herheim. Après des années de résistance aux pouvoirs de tutelle, le petit-fils du compositeur, 89 ans le 30 août prochain, a finalement décidé de passer la main. La disparition l'an dernier de sa deuxième épouse, Gudrun, a sans doute précipité son isolement et, partant, sa décision. Cela, et aussi l'alliance surprise de deux des trois candidates à la succession : ses filles Eva et Katharina, demi-soeurs qui se vilipendaient jusque-là par médias interposés. L'une, née du premier lit, a 63 ans et une belle carrière de responsable du casting pour plusieurs maisons, notamment le festival d'Aix-en-Provence. L'autre, 29 ans, est la fille de Gudrun et, après avoir appris toutes les facettes du métier avec son père, s'est lancée dans une carrière de metteur en scène, essentiellement dans le répertoire familial, couronnée l'an passé par une assez intelligente production des "Maîtres chanteurs de Nuremberg" à Bayreuth, retransmise cette année sur grand écran et même par Internet. Indice d'une modernité à venir ? |
|
[Scène] Lyrique Festival de Bayreuth Parsifal II, le retour … par Pierre-Jean TribotCinq ans après la sulfureuse production due au tandem Pierre Boulez et Kristof Schliengensief, le vénérable festival wagnérien se paye un nouveau Parsifal. Certes, la scénographie du provocateur allemand avait de quoi secouer les méninges, mais elle était au moins intéressante dans sa manière de voir l’opus wagnérien devenir un acte fondateur des religions et de l’art. La réalisation de ce cru 2008 est à mettre au crédit du chef italien Daniele Gatti et du jeune metteur en scène norvégien Stefan Herheim. De ce dernier, on avait beaucoup aimé l’horripilant Enlèvement au Sérail du festival de Salzbourg 2006. Certes, le propos était osé, mais cette production témoignait du brio et du culot de ce scénographe. Timidité ou envie de trop bien faire, son Parsifal fait l’effet d’un coup d’épée dans l’eau. Le propos est simple, Parsifal est une sorte de rédempteur de l’Allemagne : on commence à la fin du XIXe dans la villa Wahnfried (la résidence des Wagner à Bayreuth) pour traverser les deux guerres mondiales avec un Parsifal boutant les nazis hors du plateau dans une scène assez grotesque pour déboucher sur le triomphe de la démocratie lors de l’ultime acte : Parsifal faisant irruption dans l’enceinte du parlement. Forcément caressé dans le sens du poil par tant de démagogie et de clins d’œil racoleurs, le public réagit avec enthousiasme. Se greffant sur ce thème du héros rédempteur, Herheim en ajoute une couche dans l’exploration au scalpel et bistouri de l’inconscient des personnages ce qui nous vaut un acte I à la limite du lisible. Le tout étant agrémenté d’images des plus faciles : Klingsor en porte jarretelle, maître de cérémonie d’une revue de music hall ou des femmes laborieuses émergeants des ruines post 1945. La direction d’acteur est hachée et perd souvent tout effet directeur avec des gesticulations de foule sans grand intérêt. Techniquement, il faut saluer le talent de l’équipe scénique du festival qui doit maîtriser un décor gigantesque et en perpétuel mouvement (les ingénieurs de la maison on dut s’arracher les cheveux pour mettre au point certaines parties). Fort heureusement, la représentation était portée par un niveau musical digne de ces lieux mythiques. Dans la fosse, Daniele Gatti peine encore un peu à unifier son Wagner. La gestion des tempi est assez curieuse : l’acte I est assez lent, l’acte II, semble raisonnablement enlevé, mais l’acte III est très très lent. La lenteur n’est pas un problème car le maestro réussit, aux actes I et III à habiter cette décantation du temps, seul l’acte II sonne de manière plus survolée et moins engagée. L’ultime acte prend alors des couleurs automnales avec les teintes d’un orchestre absolument impérial par le velours de ses cordes ou la précisions des cuivres. Lors des saluts, Gatti se prend une belle volée de huées, ce qui est amplement ridicule : on a tellement entendu dans cette fosse de médiocres routiniers (Adam Fischer ou Peter Schneider en tête) que l’on doit se réjouir d’y retrouver un chef de premier plan qui galvanise l’orchestre. La distribution est composée de valeurs sûres du chant wagnérien actuel : Christopher Ventris est l’un des Parsifal du moment : la voix est héroïque et la conduite du chant parfaite même si certains aigus manquent légèrement d’éclat. Mihoko Fujimura est une Kundry vaillante, assez charismatique mais elle peine aussi aux limites extrêmes du rôle. Kwangchul Youn assure un Gurnemanz magistral autant par la beauté de la voix que par le vécu du rôle ; au fil des ans, ce chanteur s’impose indubitablement comme un grand artiste. Detlef Roth impose un Amfortas très humain alors que Thomas Jesatko dévore le personnage de Klingsor. Mais comme souvent à Bayreuth, le triomphateur de la soirée c’est le chœur. Autant en terme de couleurs, de puissance et d’homogénéité, la formation festivalière assure aisément son statut de " meilleur chœur du monde ". Un Parsifal musical avant tout …. Bayreuth . Festspielhaus. 3-VIII-2008. Richard Wagner (1813-1883) : Parsifal, festival scénique en trois actes. Mise en scène : Stefan Herheim, décors : Heike Scheele ; Costumes : Gesine Völlm ; Lumières : Ulrich Niepel ; Vidéo : Momme Hinrichs et Torge Moler. Avec : Detlef Roth, Amfortas ; Diogenes Randes, Titurel ; Kwangchul Youn, Gurnemanz ; Christopher Ventris, Parsifal ; Thomas Jesatko, Klingsor ; Mihoko Fujimura, Kundry ; Arnold Bezuyen, 1. Gralsritter ; Friedemann Röhlig, 2. Gralsritter ; Julia Borchert, 1. Knappe ; Ulrike Helzel, 2. Knappe ; Clemens Bieber, 3. Knappe ; Thimothy Oliver, 4. Knappe. Chœur du festival de Bayreuth, direction : Eberhard Friedrich ; Orchestre du festival de Bayreuth, direction : Daniele Gatti. |
|
REPORTAJE: ópera Un ambicioso y fascinante montaje de 'Parsifal' inaugura el Festival de Bayreuth J. A. VELA DEL CAMPO BAYREUTH. Wolfgang Wagner, nieto del compositor, 89 años a finales de agosto, 57 al frente del Festival de Bayreuth, se puede retirar tranquilo. La última nueva producción de su reinado está tocada por el sello de la genialidad. Precisamente en Parsifal, la ópera emblemática por excelencia del teatro de la verde colina, la misma en la que él era abucheado año tras año por su concepción escénica conservadora y anodina, la que le hizo cambiar de aires estéticos e iniciar una huida hacia delante invitando al enfant terrible Christoph Schlingensief para hacerse cargo del "festival escénico sacro" -como llamaba Wagner a Parsifal- sin obtener, por los excesos del director teatral, el efecto revulsivo esperado, a pesar de la magnífica dirección de Pierre Boulez. Wolfgang Wagner, nieto del compositor, Wolfgang Wagner le echó valor y propuso para su producción de despedida al noruego Stefan Herheim, nacido en 1970, y cuya concepción de El rapto en el serrallo, en el Festival de Salzburgo hace cinco años, fue abucheada sin piedad por mucha riqueza de pensamiento e impecable realización tecnológica que tuviera en su compleja realización teatral sobre la fidelidad y el amor a partir de la ópera mozartiana. Complejidad no le falta a su enfoque de Parsifal, pues, a través de la ópera, se cuenta la historia de Alemania, la del propio Wagner y la del teatro de Bayreuth, en una pirueta colosal que desde las escenografías originales del estreno llega a integrar en escena, a través de la tecnología, al público que asiste a la representación actual en una magistral esfera de reconciliación. Decía Kant que tres cosas ayudan a soportar las penas de la vida: la esperanza, el sueño y el humor. Las tres figuran ampliamente en la dramaturgia de Herheim y su equipo. Pero no para soportar ningún tipo de pena, sino para desvelar desde una mirada actual los entresijos más ocultos de una ópera como Parsifal. Bien es verdad que la música expresa los dramas internos de los personajes, lo cual da cartas de libertad al director de escena para señalar líneas de reflexión paralela que, sin ninguna duda, enriquecen la contemplación y escucha de la obra. Todo ello se puede hacer si la realización teatral es extraordinaria, y en este caso lo es. Más aún, hay una profunda identificación con la dirección musical de Daniele Gatti y también con la acústica vertical de un teatro como el de Bayreuth. Las referencias visuales a la parte posterior de la casa de Wahnfried son constantes. Incluso hay una asociación de la tumba de Wagner con la cama de Amfortas. Simultáneamente, en el primer plano del escenario se hacen alusiones a la construcción del teatro, y en el tercer acto, unas columnas de la sala ya se reproducen en escena en un juego dentro del propio teatro desde una perspectiva arquitectónica. Los tiempos de la vida privada se funden y la imagen de inocencia de Parsifal se remite a la infancia jugando con un caballito vestido de marinero, ropa que conserva en el primer acto e incluso en el segundo, con la visita al castillo encantado de Klingsor, donde el sentido del humor es evidente en la escena de las muchachas-flor y en las referencias a Marlene Dietrich, evolución en azul de los ángeles negros del primer acto. La fantasía convive con el psicoanálisis, la ingenuidad con el fatalismo histórico, los recuerdos con el camino hacia la madurez de conciencia. Pero la esperanza siempre está en primer plano y la utopía de un mundo mejor se vislumbra. Wagner es redimido desde el teatro. Redención al redentor. La referencia al Wagner de posguerra, en el verano de 1951, con las puestas en escena abstractas y apolíticas de Wieland Wagner es genial por lo que supone de antecedente necesario, y también porque hay un puente tendido con esta realización de Herheim. Sin embargo, ahora la Historia se asume y los militares entran al final del primer acto, en el que es necesaria la presencia simbólica del Graal para mantener la fe espiritual, y las esvásticas se despliegan al final del segundo con un minidesfile sobrio y medido teatralmente de los nazis, y las huellas de la destrucción llenan un tercer acto poético que concluye con Parsifal transmitiendo su mensaje de paz a un Parlamento enfrentado, la familia del futuro con un niño al lado de Gurnemanz y Kundry, y los espectadores de la sala reflejados en el escenario como cómplices imprescindibles de un mundo nuevo. Christopher Ventris, Mihoko Fujimura, Detlef Roth, Kwangchul Youn y Thomas Jesatko encabezaron un reparto coherente, que fue aplaudido en su totalidad. Sensacional el coro y excelente la orquesta a las órdenes de Gatti, debutante en la plaza. Se preveía bronca para el equipo escénico, pues ya había habido algún amago por algunos que no respetaron el silencio tradicional después del primer acto, y por un espectador al que le dio un ataque de abucheo con la breve aparición de las esvásticas. Pero la gran mayoría del público captó que se encontraba ante un momento excepcional, y obsequió a Herheim y los suyos con grandes aclamaciones. Es sin empacho la más inteligente e imaginativa dirección de escena que ha visto nunca en Bayreuth. Bayreuth ha apostado por el talento. Que sea para largo. |
|
OPERA E le nipotine di Wagner mettono Parsifal sul lettino GIANGIORGIO SATRAGNI Daniele Gatti ha debuttato al Festival di Bayreuth, quinto italiano dopo Toscanini, De Sabata, Erede e Sinopoli a ricevere l'onore della chiamata nel luogo sacro wagneriano. La nuova produzione del Parsifal, della rappresentazione scenica sacra, ha in realta' poco di sacrale, specie per l'impostazione del regista Stefan Herheim, chiamato a sostituire l'allestimento pazzoide di Schlingensief ma comunque nel segno di una generazione nuova. E' quel che vuole Katharina Wagner, pronipote del capostipite, figlia di secondo letto di Wolfgang, che a 89 anni si dimettera' il 31 agosto dopo 58 anni di guida del Festival. Il giorno successivo si riunirá la fondazione pubblico-privata che ne controlla le sorti e decidera' quello che tutti attendono: la guida affidata a Katharina e alla sorellastra Eva, peraltro in ottimi rapporti. La soluzione dinastica e' manifesta: scomparsa la madre Gudrun, con Wolfgang in salute precaria, Katharina si palesa in questi giorni come la vera signora di Bayreuth. Forse è la donna che meno perpetua l'autorappresentazione dei Wagner. Herheim, che sembra innovare ma piu' che altro complica, sovrappone al Parsifal, gia' di per se' complesso, due altre storie: appunto l'autorappresentazione dei Wagner e del Festival e l'evolversi della storia tedesca da Richard a oggi. Cosi' si parte dalla rotonda sul giardino di Villa Wahnfried, ossia casa Wagner, e si finisce con una rappresentazione nella rappresentazione al Festspielhaus, il teatro creato da Wagner che per esso concepì il Parsifal. Alla fine, la riunione dei cavalieri del Graal e' una seduta del Bundestag tedesco, dopo esser passati per la Germania guglielmina, la Prima guerra mondiale, il nazismo come regno del male di Klingsor spezzato da Parsifal con la sacra lancia (un corto circuito ideologico, stante l'uso fattone), le macerie, la ricostruzione. In ciò Herheim si appiglia a un unico elemento, piegandolo a sua utilita': il tempo che si fa spazio, secondo la frase di Gurnemanz. Chi in realtà meglio comprende questo è Gatti, che attraverso la dilatazione del tempo crea lo spazio musicale: è la musica che diventa spazio, specie qui dove Wagner concepì la propagazione del suono da punti diversi, l'orchestra sotto il palcoscenico, le voci al centro, i cori fuori scena e dall'alto della cupola del tempio. Se vediamo la storia tedesca mentre la vicenda sacrale è molto appesantita da eccessi psicanalitici, dove Kundry e' tanto la seduttrice primigenia quanto la madre primigenia fino a venir presentata quale madre e seduttrice di Parsifal, Gatti e' l'antitesi della germanità e dell'analisi. La sua e' analisi musicale e il cuore wagneriano della lettura non e' tanto l'aspetto religioso, piuttosto quello schopenhaueriano: la compassione. La dolcezza e' ovunque, i fiati all'inizio faticano nel sostenere l'intonazione, ma in seguito il respiro fra il direttore, le masse e i cantanti e' unitario. E' una lettura che si sposa piu' con l'Amfortas non urlante di Detlef Roth o col Gurnemanz nobile di Kwangchoul Youn, meno con la Kundry netta di Mihoko Fujimura o col Parsifal insipido di Christopher Ventris. Bayreuth, Festspielhaus repliche fino al 28 agosto *** |
|
Bayreuth
Trionfa il "Parsifal" di Daniele Gatti, quinto direttore d'orchestra italiano nella storia del Festival. Ma il regista Herheim eccede negli effetti speciali e nelle perversioni di Carla Moreni Se c'era un suono mistico da trovare, impalpabile ma denso, a fraseggi larghi eppure con tutti i temi magnifcamente scontornati, fatto di voce pastosa di organo ma anche di passo araldico, fiero, con archi spronati a grandi falcate, ecco, questo suono ideale Daniele Gatti lo ha perfettanente trovato. È il suono di Parsifal, ultima opera di Wagner. Per il direttore milanese, 47anni ancora da compiere, la partitura del debutto a Bayreuth, nel fantastico tempio sulla collinetta verde. Qui arrivano da tutte le parti del mondo per un rito musicale che non conosce uguati. Appassionati e devoti: un piccolo anello – "der Ring" – li distingue. Lo portano come un trofeo sulla giacca dello smoking. Le dame al seguito in lungo obbligatorio alle quattro del pomeriggio, annuiscono consapevoli di tanta appartenenza. Sono 149 le associazioni wagneriane net mondo, l'ultima aperta a Dubai. Essere qui per l’apertura del Festival, nel teatro voluto dal compositore, acustica e fascino ineguagliabili, è privilegio e dovere insieme. Si ascolta assorti. Niente applausi a inizio d'atto – così che la musica sembra sprigionarsi per magia dall'invisibile golfo mistico –, niente pisolini. Quasi cirque ore, interrotte da due pause di un'ora esatta per adeguati rifornimenti alimentari. Si fa così da 97 stagioni. Per questa, il titolo d'apertura è Parsifal. Il direttore un italiano, il quinto nella storia di Bayreuth. dopo Toscanini, de Sabata, Erede, Sinopoli. E Parsifal è anche l'unica nuova produz lone di questa estate, affidata anch'essa a un debuttante. sconosciutissimo: si chiama Stefan Herheim, ha 38 anni e viene da Oslo. Ai saluti finali si e presentato in coppia con Gatti, che ha diretto in maglietta mezze maniche, con un abito panna luccicante stile mago Zurlì. Certo con tutte le invenzioni di doppi, gli effetti speciali, le penversioni molto tedesche di questo spettacolo (compreso un Klingsor in reggicalze e l'immancabile parata di bandiere nazi atterrate da scoppio di bombe) si sarebbe potuta realizzare un'intera Tetralogia. Ma Herheim è giovane e ha bella mano. Il tempo gli insegnerà a sostenere il vuoto. Qui solo grazie alla tensione del podio, densa. spirituale si è evitato un Parsifal luna-park. Bayreuth ha sperimentato tutto nelle regie e forse ora vuole ricominciare da capo. Dal racconto illustrato, metodico. Abbiamo persino it parto in diretta di Kundry, che diventa esplicitamente la madre di Parsifal. Lui nasce tra sangue copioso – tutto questo Parsifal ne gronda, tanto che quello delta ferita amorosa di Amfortas pare un dettaglio – e viene ostentato dalla levatrice-Amfortas, che lo porta nudoin trofeo tra cavalieri e cavalleressedel Graal. Il piccino sanguinolento è finto, per fortuna. Ma con le braccine a tempo fa ciao ciao. "Mein Gott" sobbalzano i wagneriani. C'è la socia di Caracas, venuta apposta dal Venezuela. Felice di essere stata sorteggiata per ben due opere quest'anno; c'è il pacioso signore di Brema, con moglie: da dieci anni era in testa per questi due biglietti, se li è fatti come regalo di Natale. Il palcoscenico è un iperbolico monta-smonta a vista: la casa di Wagner a Bayreuth, la famosa Wahnfried diventa prima il giardino del Venerdì Santo e poi relitto, come davvero fu dopo i bombardamenti del ’45. Regista e scenografa, Heike Scheele. vogliono raccontare, oltre alla storia di Parsifal già di suo complessa, anche quella della Germania. È troppo. Eroicamente nel bailamme generale riescono anche a cantare l'Amfortas di Detlef Roth, il narrativo Gurnemanz di Kwangchul Youn, il Klingsor in calze a rete modello Dietrich fatale, di Thomas Jesatko. La Kundry di Mihoko Fujimura spara acuti taglienti, ma nel registro centrale è opaca e di poco fascino timbrico. Svetta invece con grandiosa tenacia Christopher Ventris, in simbiotica tensione con i tempi mistici di Gatti nel finale. Finalmente qui ha deposto la divisa da marinaretto, poco consona a un Parsifal bambolotto. L'applauso finale scoppia liberatorio, è trionfo per tutti. "Parsifal",dl Richard Wagner, direttore Dantele Gatti, regia di Stefan Herheim, Bayreuth, fino al 28 agosto. |
|
UN LABIRINTO DI SEGNI IL PARSIFAL SECONDO HERHEIM Debutta a Bayreuth l’atteso „Parsifal" nella regia del norvegese Stefan Herheim. Il suo spettacolo complesso ed eccessivo si impone e convince, ma mette un po’ in ombra l’esecuzione musicale raffinata e preziosa di Daniele Gatti. L’ottima compagnia di canto e gli splendidi complessi del Festival contribuiscono in maniera determinante al successo di questa nuova produzione del festival wagneriano.
Stefano Nardelli |
|
CLASSICA LORENZO ARRUGA In due cerchi di fuoco è custodita la memoria di Richard Wagner: uno piccolo di devoti titolati a Bayreuth, per il festival estivo nel mitico teatro dalla buca d’orchestra invisibile, voluto dal maestro, quasi una confraternita, prenotazioni con anticipi d’anni, ritualità e privilegio; l’altro grande, tracciato in tutto il mondo, dei fedeli alle trasmissioni radio, dalle 16 a sera. E il giorno dopo, telefonate, blog, beatitudini e polemiche. Come quest’anno, specie dopo il Parsifal dell’inaugurazione. Stavolta ho fatto parte della cerchia più vasta, e son contento, perché non ho veduto la regia sanguinolenta con svastiche, fra moda e complesso di colpa, e ho goduto l’intensità del suono, la pienezza del fraseggio, la logica della meditazione e della purificazione, la bellezza vissuta e sognata della direzione di Daniele Gatti, in una quiete accentuata ma non immotivata; e il canto pertinente per voce ed espressione specie di Christopher Ventris e Delieth Roth. Il cerchio grande presto godrà anche delle trasmissioni dell’opera in internet: un’altra occasione per i tanti amanti della grande musica per salutare da lontano, senza rimpianto, gli ignoranti gestori delle tv. |


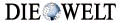


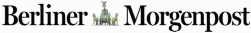


 Die SS marschiert ein
Die SS marschiert ein Kleine Brötchen backen
Kleine Brötchen backen




























 You may well wonder what swastikas were doing in an opera dripping with Christian symbolism. Until now the underbelly of Wagner's "festival stage consecration play" was thought to have been its purification rituals, linking Wagner with the Holocaust. But Norwegian director Stefan Herheim sidesteps that for a less judgmental interpretation. His thesis is that the transformations intrinsic to Parsifal - transformations of character, physique and ideology that are part of any historical process - are an analogy of the changes Wagner's ideas have undergone in the context of German history.
You may well wonder what swastikas were doing in an opera dripping with Christian symbolism. Until now the underbelly of Wagner's "festival stage consecration play" was thought to have been its purification rituals, linking Wagner with the Holocaust. But Norwegian director Stefan Herheim sidesteps that for a less judgmental interpretation. His thesis is that the transformations intrinsic to Parsifal - transformations of character, physique and ideology that are part of any historical process - are an analogy of the changes Wagner's ideas have undergone in the context of German history.











 Non si sa da dove cominciare a raccontare il nuovo "Parsifal" che Stefan Herheim ha allestito al Festspielhaus di Bayreuth, tanto lo spettacolo è complesso e denso di contenuti. Agli antipodi rispetto all’ascetica essenzialità di Wieland Wagner, Herheim costruisce uno spettacolo visivamente opulento nel quale racconta tre Parsifal: quello (appena riconoscibile) che si legge nel libretto wagneriano, quello che racconta di un rito di iniziazione alla vita a partire da una morte (della madre, già nel Preludio), ed infine quello che illustra la storia o piuttosto l’esegesi dell’opera più strettamente legata alla tradizione bayreuthiana e più aperta alle ideologizzazioni della storia tedesca. Nello spettacolo questi tre livelli narrativi si intrecciano e danno vita ad una macchina spettacolare complessa con molti momenti di grande fascino e che delude solo nell’enfatico (e un po' ruffiano) finale. Abilissima regia di Herheim a parte, molti dei meriti dello spettacolo vanno senza dubbio ascritti in pari misura alle sorprendenti scene di Heike Scheele – un rutilante universo citazionistico di memorabilia wagneriane dispiegate attorno al letto, perno della narrazione – alle preziose luci di Ulrich Niepel e alla fantasmagoria dei costumi di Gesine Völlm. Sopraffatta da tanta opulenza scenica, la preziosa direzione musicale di Daniele Gatti passa quasi inosservata. Gatti opta per un taglio intensamente lirico, quasi intimistico, in cui l’atmosfera sognante la cura del dettaglio strumentale è esaltata dalla scelta di tempi lentissimi. A questa concezione musicale risponde perfettamente l’impeccabile compagnia di canto, in cui convince pienamente per la vibrante umanità il Gurnemaz del musicalissimo Kwangchul Youn. Splendidi, come da aspettative, l’Orchestra e il Coro del Festival.
Non si sa da dove cominciare a raccontare il nuovo "Parsifal" che Stefan Herheim ha allestito al Festspielhaus di Bayreuth, tanto lo spettacolo è complesso e denso di contenuti. Agli antipodi rispetto all’ascetica essenzialità di Wieland Wagner, Herheim costruisce uno spettacolo visivamente opulento nel quale racconta tre Parsifal: quello (appena riconoscibile) che si legge nel libretto wagneriano, quello che racconta di un rito di iniziazione alla vita a partire da una morte (della madre, già nel Preludio), ed infine quello che illustra la storia o piuttosto l’esegesi dell’opera più strettamente legata alla tradizione bayreuthiana e più aperta alle ideologizzazioni della storia tedesca. Nello spettacolo questi tre livelli narrativi si intrecciano e danno vita ad una macchina spettacolare complessa con molti momenti di grande fascino e che delude solo nell’enfatico (e un po' ruffiano) finale. Abilissima regia di Herheim a parte, molti dei meriti dello spettacolo vanno senza dubbio ascritti in pari misura alle sorprendenti scene di Heike Scheele – un rutilante universo citazionistico di memorabilia wagneriane dispiegate attorno al letto, perno della narrazione – alle preziose luci di Ulrich Niepel e alla fantasmagoria dei costumi di Gesine Völlm. Sopraffatta da tanta opulenza scenica, la preziosa direzione musicale di Daniele Gatti passa quasi inosservata. Gatti opta per un taglio intensamente lirico, quasi intimistico, in cui l’atmosfera sognante la cura del dettaglio strumentale è esaltata dalla scelta di tempi lentissimi. A questa concezione musicale risponde perfettamente l’impeccabile compagnia di canto, in cui convince pienamente per la vibrante umanità il Gurnemaz del musicalissimo Kwangchul Youn. Splendidi, come da aspettative, l’Orchestra e il Coro del Festival.